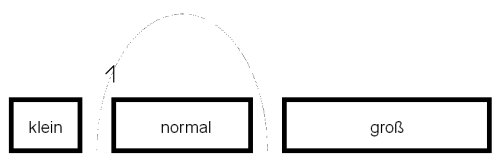
Peter Fleissner und Gregor Fleissner
Vorbemerkung
Spätestens seit dem Bau der ersten elektronischen
Rechner fasziniert die Frage, ob Maschinen denken können.
Die Diskussion darüber war und ist auch heute noch von mannigfaltigen
Veränderungen der Interpretation der Begriffe "Denken"
oder "Intelligenz" begleitet. Von 1950 bis in die frühen
80er Jahre setzte der Turing-Test eine praktisch nachprüfbare
Grenze, ob eine Maschine menschliches Intelligenzniveau erreicht
hat. Im Sinne behavioristischer Theorie wurde danach eine Maschine
"intelligent" genannt, wenn eine Person (ein Nichtexperte),
die über ein Terminal kommuniziert, durch Befragung nicht
mehr feststellen kann, ob sich hinter dem Terminal ein Mensch
oder ein Computer verbirgt (Turing 1950). Es ist klar, daß
der bestandene Test nicht heißt, daß Maschinen im
menschlichen Sinn denken können, sondern nur, daß sie
ein Verhalten zeigen, das sich auf der Ebene textueller Interaktion
von menschlichem Verhalten kaum mehr unterscheiden läßt
(ein mit einem Schraubenzieher bewaffneter Techniker würde
sich durch eine noch so perfekte Imitation menschlicher Schreibart
nicht von einer Maschine täuschen lassen - er würde
einfach nachsehen, was sich hinter dem Schirm befindet).
Im Jahre 1982 wurde der Turing-Test und seine
spezielle Auffassung von maschineller Intelligenz durch den Philosophen
John Searle herausgefordert (Searle 1982, 1990). In einem Gedankenexperiment,
das als das "Chinesische Zimmer" in die Geistesgeschichte
einging, beschrieb Searle ein System, das den Turing-Test in bezug
auf das Verständnis der chinesischen Sprache bestehen würde.
Searle selbst befindet sich in seinem Gedankenexperiment in einem
Raum, der mit Kärtchen auf chinesisch und mit Indexkarten
gefüllt ist, auf denen Instruktionen in englisch geschrieben
sind. Durch eine Öffnung in der Wand wird Searle, der uns
versichert, daß er keine Ahnung von chinesisch hat, ein
chinesischer Text durchgereicht, und danach Zettel, die - wieder
auf chinesisch - Fragen zu diesem Text enthalten. Im Lauf der
Zeit entwickelt Searle - eingesperrt in das chinesische Zimmer
- genügend Geschick, aufgrund der Instruktionen in englisch
diejenigen Kärtchen herauszureichen, die richtige Antworten
auf chinesisch auf die auf chinesisch gestellten Fragen enthalten.
Heißt die Tatsache, daß Searle im Experiment auf chinesische
Fragen die richtigen Antworten in chinesisch gibt, daß er
selbst chinesisch versteht? Obwohl der Turing-Test als bestanden
angesehen werden muß, meint Searle, daß er selbst
nach wie vor kein Wort chinesisch verstünde, und weiters
verallgemeinert er: "... and neither does any other digital
computer because all the computer has is what I have: a formal
program that attaches no meaning, interpretation, or content to
any of the symbols" (Searle 1982).
Searle beantwortet mit seinem Gedankenexperiment
die Frage nach der Denkfähigkeit von Maschinen durch eine
Engführung des Begriffs Intelligenz. Durch seine Wahl der
Fremdsprachenkenntnisse als speziellem Beispiel glaubt er, die
inneren Fähigkeiten (des Verständnisses von Sprache)
von der Anwendung dieser Fähigkeiten (korrekte Beantwortung
von Fragen) abtrennen zu können (Turkle 1995: 87). Sprachverständnis
und das Beantworten von Fragen können (so interpretieren
wir Searle) in seiner Sicht als voneinander unabhängige Aktivitäten
aufgefaßt werden. Damit weist er der Maschine zu, was der
Maschine, und dem Menschen, was des Menschen ist. Die Ordnung
der Dinge ist wiederhergestellt. Jedes hat seinen ihm zukommenden
Bereich, und der Mensch wird beruhigenderweise durch die Maschine
nicht entthront.
Obwohl wir die Schlußfolgerung von Searle
(die man vielleicht respektlos so ausdrücken kann, daß
ein Computer eben kein Mensch ist) klarerweise teilen, sehen wir
in seinem Gedankenexperiment zwei - einander entgegengesetzte
- Fehleinschätzungen: Die erste besteht in einer eher reduzierten
Sicht des Problems der Fragenbeantwortung, wobei er den Computer
und seine Möglichkeiten überschätzt. Wir
wissen heute, daß es praktisch nicht möglich ist, ein
vollständiges Set von Instruktionen für die Beantwortung
von Fragen in befriedigender Weise anzugeben, immer kann uns eine
Metafrage aus dem programmierten Korsett werfen. Dem entsprechend
sind nach wie vor die Ergebnisse von Übersetzungsprogrammen
ohne menschliche Bearbeitung nur eingeschränkt brauchbar,
was nicht heißt, daß sie in speziellen Fällen
und Disziplinen nicht eine wichtige Unterstützung menschlicher
Arbeit darstellen können. Auch die Grenzen der Anwendung
von Expertensystemen, etwa bei Vorhandensein von "tacit knowledge",
weisen auf diese Schwierigkeiten hin.
Andererseits zeigt sich Searle zu pessimistisch
und unterschätzt die Möglichkeiten des Computers,
"to attach meaning, interpretation, or content to any
of the symbols". Der vorliegende Beitrag entfaltet ein
Gegenbeispiel, das zeigen soll, daß in bestimmten Settings
auf dem Computer durchaus so etwas wie "Bedeutung" und
"Pragmatik" entstehen kann, ja, daß die von Searle
erwähnten "Instruktionen" durchaus nicht explizit
vom Programm vorgegeben sein müssen, sondern daß sie
sich erst im Lauf eines besonderen Interaktions- und Kommunikationsprozesses
herausbilden können. Anders als bei menschlicher Kommunikation
- und das ist die Einschränkung und der wesentliche Unterschied
- ist allerdings die Menge der Symbole, die den virtuellen Subjekten
des Programms insgesamt zur Verfügung steht, vom Programm
vorgegeben. Welche allerdings davon ausgewählt werden, und
welche Bedeutung sie erhalten, ist nicht voraussagbar.
Bei menschlicher Informationsverarbeitung ist
die Menge der Symbole nur in reduzierten Fällen vollständig
angebbar. Das Neue, das per definitionem nicht vorherzusehen ist,
kann daher auch nicht als Element einer Menge angegeben werden,
wie es die formale mathematisch-logische Behandlung erfordern
würde.
Zur Konstruktion eines Gegenbeispiels zu Searles
Auffassung werden anhand dieses Computerprogramms bestimmte Aspekte
von Selbstorganisation simuliert, die - wie wir meinen - dadurch
besser verstanden und präzisiert werden können, insbesondere
das Zusammenspiel von Vorgängen zwischen physischer und symbolischer
Welt (Pragmatik) sowie die Entstehung von Semantik durch diese
Interaktion. Das Modell wurde von den Paradigmata der "Körperbasierten
Artificial Intelligence", der "Emergent AI" (Turkle
1994: 125-148) und dem Setting der Freudschen Psychoanalyse inspiriert
. Zur besseren Einordnung des hier beschriebenen Verfahrens wird
das Modell mit der Lernmatrix von Steinbuch verglichen.
Das Szenario
Wir treffen einige allgemeine Voraussetzungen,
die darstellen sollen, von welchem Blickwinkel aus das Modell
aufgebaut wurde. Wir unterscheiden eine physische Welt, Welt A,
die durch physikalische Gesetze vollständig beschrieben werden
kann, von einer informatischen Welt, Welt B.
Jede Ursache besitzt in Welt A eine ihr eindeutig
zugeordnete Wirkung. Diese Welt ist die (wie wir heute wissen,
eingeschränkte Sicht der) Welt der klassischen Mechanik,
actio est reactio.
Die zweite Welt, Welt B, zunächst streng
von der ersten geschieden, ist die Welt der Information. Hier
ist der Gegenpol zur Eindeutigkeit gegeben, actio non est reactio.
Die Ursache erzeugt zwar eine Wirkung, aber welche aus einer Menge
möglicher Wirkungen das sein wird, ist nicht vorhersehbar.
Die Wirkung besitzt also gegenüber der Ursache bestimmte
Freiheiten, sie ist mehrdeutig. Die Ursache beruht zwar - wie
in Welt A - auf einer physischen Basis, diese ist in unserem Zusammenhang
aber irrelevant. Sie hat hier ausschließlich informativen,
symbolischen Charakter und führt als Wirkung zu weiteren
Symbolen bzw. Handlungen.
Im vorliegenden Computerprogramm werden beide
Welten simuliert und miteinander in Beziehung gesetzt, um eine
bestimmte Aufgabe in Welt A unter Mitwirkung von Welt B zu lösen.
Dabei wird von einem idealisierten Szenario ausgegangen, das kurz
beschrieben werden soll:
In Welt A existieren drei Hauptelemente: die
"Barriere", ein "Springer" und ein "Sprecher".
Springer und Sprecher erhalten ihre Namen nach der ihnen zugeordneten
Hauptaktivität. Die Barriere, ein Hindernis, dessen Breite
zufällig wechselt, repräsentiert die Physis, die "Natur".
Die Breite des Hindernisses nimmt zufällig u unterschiedliche
diskrete Werte an, wobei die einzelnen Werte mit dem Index k bezeichnet
werden sollen, also k=1...u. (siehe Abb. 1).
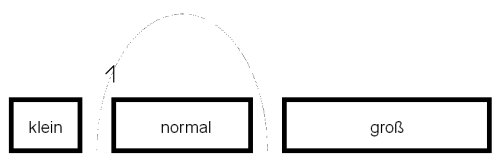
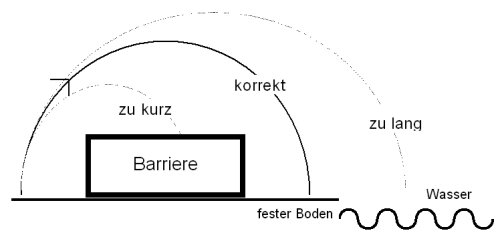
Die Aufgabe besteht darin, daß diese
Barriere vom "Springer" korrekt (d.h. mit einem Sprung,
der nicht zu kurz und nicht zu lang ist) übersprungen werden
soll. In Abbildung 2 sind mehrere Flugbahnen des Springers eingezeichnet.
Nur ein "korrekter" Sprung (durchgezogene Linie) gilt
als erfolgreich, zu lange oder zu kurze Sprünge (gestrichelte
Linien) werden als Mißerfolg gewertet. Die Schwierigkeit
dabei ist, daß der Springer blind ist, d.h. die Breite des
Hindernisses nicht selbst feststellen kann. Er ist auf Hilfe angewiesen.
Sie kommt vom "Sprecher", der die jeweilige Breite des
Hindernisses feststellen kann. Der Sprecher hat die Möglichkeit,
Laute auszustoßen, die der Springer hören und als Grundlage
für die Wahl seines Verhaltens nützen kann.
Der "blinde Springer" hat folgende Fähigkeiten:
1. Er kann "springen" (und zwar mit t vorher festliegenden Sprunglängen), aber nicht sprechen
2. Er kann "hören" (und zwar die s Sprachlaute des Sprechers), aber nicht sehen
3. Er kann das Gehörte mit bestimmter Wahrscheinlichkeit mit seiner "Entscheidung", wie weit er springt, verknüpfen.
4. Er kann den Erfolg oder Mißerfolg
seines Sprunges feststellen. Erfolg erhöht die entsprechende
Verknüpfungswahrscheinlichkeit zwischen gehörtem Laut
und seiner Sprungweite, Mißerfolg reduziert sie.
Die Beschreibung des Zusammenhangs zwischen
Hören und Springen erfolgt mittels einer Wahrscheinlichkeitsmatrix
H. Sie ist eine Markoff-Matrix mit den Zeilensummen 1,
also H1 = 1, die aus s Zeilen und t Spalten besteht.
Ihre Elemente h(i,j), i=1...s, j=1...t, haben anfänglich
alle die gleichen Werte: h(i,j) = 1/t.
Der Sprecher besitzt folgende Eigenschaften:
1. Er kann "sprechen", d.h. u unterscheidbare Laute ausstoßen, aber nicht springen
2. Er kann das Hindernis "sehen", die Breite der Barriere feststellen, aber nicht hören
3. Er kann die wahrgenommene Breite der Barriere mit bestimmter Wahrscheinlichkeit mit bestimmten Sprachlauten verknüpfen.
4. Er kann den Erfolg oder Mißerfolg
des Sprunges feststellen. Erfolg erhöht die entsprechende
Verknüpfungswahrscheinlichkeit zwischen wahrgenommener Barrierenbreite
und geäußertem Laut, Mißerfolg reduziert sie.
Die Beschreibung des Zusammenhangs erfolgt
mittels einer Wahrscheinlichkeitsmatrix G, einer Markoff-Matrix
mit den Zeilensummen 1, also G1 = 1, die aus u Zeilen
und s Spalten besteht. Die Elemente g(k,i), k=1...u, i=1...s,
haben anfänglich alle die gleichen Werte: g(k,i) = 1/s.
Der blinde Springer agiert in Welt A, seine
Hörfähigkeit ist er eine Schnittstelle zu Welt B. Der
Sprecher agiert in Welt B, durch seine Beobachterrolle besitzt
er eine Schnittstelle zu Welt A.
Einen Überblick über die Programmstruktur
bietet Abb. 3. In der Mitte der Abbildung ist die Barriere angedeutet.
Ein Zufallsgenerator wählt eine bestimmte Breite aus einer
Reihe von Möglichkeiten. Der senkrechte Doppelpfeil symbolisiert
die Variabilität der Barriere. Rechts von der Barriere ist
die Sprecher-Matrix in Form eines Rechtecks dargestellt. Das Rechteck
soll die Übergangsmatrix verkörpern, die eine spezielle
beobachtete Breite des Hindernisses (Zeileninput) mit einem Laut
verknüpft, der zufällig ausgewählt wird (Spaltenoutput,
als variabel dargestellt durch den waagrechten Doppelpfeil). Der
blinde Springer (Rechteck auf der linken Seite der Graphik) "hört"
den Laut (Zeileninput von H) und verknüpft ihn zufällig
mit einer Sprungweite (Spaltenoutput von H). In Abb. 3
ist die Matrix H gestürzt dargestellt (Spalten und
Zeilen vertauscht gegenüber der traditionellen Konvention,
daß die Zeilen horizontal verlaufen).
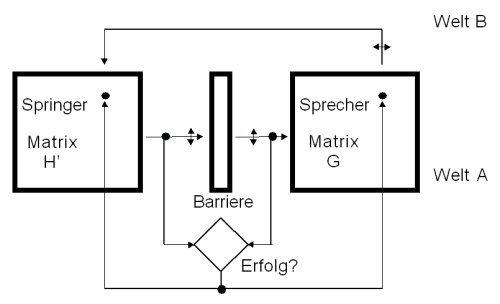
Die Schwierigkeit besteht darin, daß
der Beobachter zwar etwas sagen kann, aber die Bedeutung des Gesagten
anfänglich noch nicht festliegt. Er "stammelt"
also zunächst nur einen Laut. Der Springer kann den Laut
hören und dann springen, und zwar entweder kürzer, oder
länger als die Barriere, oder korrekt. Ein Vergleich zwischen
Barrierenbreite und tatsächlichem Sprung wird als Erfolg
bzw. Mißerfolg verbucht (siehe auch Abb. 2). Das korrekte
Springen bedeutet Erfolg, das nichtkorrekte einen Mißerfolg.
Erfolg bzw. Mißerfolg verändern die Kopplungswahrscheinlichkeiten
der Übergangsmatrizen bei Sprecher und Springer.
Die Realisierung des Simulationsmodells
Das Programm wurde mit einer graphischen Oberfläche
versehen (siehe Abb. 4), auf der sich Sprecher und Springer befinden.
Der Springer setzt mit einer Wurfparabel über die Barriere
hinweg, bzw. er springt zu weit (ins Wasser) oder zu kurz (auf
die Spitzen der Barriere).
Für die Barrierenbreiten wählten
wir u = 3, die möglichen Breiten werden mit KLEIN, NORMAL
und GROSS bezeichnet. Die Sprungweite des Springers umfaßt
t = 4 Möglichkeiten, ZUKURZ, KURZ, MITTEL und LANG. u und
t sind nicht unbedingt gleich. t ist in unserem Beispiel um 1
größer als u, da der Springer nach unseren Annahmen
auch noch kürzer als die kürzeste mögliche Barriere
springen kann. Die s = 3 Sprachlaute symbolisierten wir mit A,
B und C, obwohl die Wahl der Laute völlig beliebig ist.
Formal läßt sich der Ablauf der
Simulation wie folgt darstellen:
Ein Zufallsgenerator bestimmt zunächst
die Barrierenbreite k*, die der Sprecher feststellt (z.B. k* =
2; NORMAL). Zur Bestimmung des Sprachlauts zieht ein zweiter Zufallsgenerator
eine Zahl y*, 0 ² y* < 1, die zunächst einer Gleichverteilung
entnommen wird, da die g(k,i) noch alle gleich groß sind.
Das zu y* gehörige i*, das den Sprachlaut festlegt, wird
aus folgender Beziehung bestimmt:
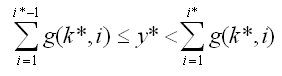
Für diese und die nächste Formel
soll folgende Konvention gelten: Ist der letzte Wert des Laufindex
der Summation kleiner als der erste, also z.B. 0 (der letzte Wert)
< 1 (der erste Wert), so wird gar keine Summation durchgeführt.
Das Ergebnis der linken Seite wäre in diesem Fall 0. Ferner
soll für i* = s bzw. für j* = t auf der rechten Seite
das "kleiner gleich" Zeichen anstelle des "kleiner"
Zeichens stehen. Z.B. sei y*=0.13426556, damit wird i* = 1, als
Sprachlaut also "A" ausgewählt. Der Sprecher sagt
"A" zum Springer.
Beim Springer spielt sich ein analoger Vorgang
ab. Er "wählt" auf Basis einer gleichverteilten
Zufallszahl z* unter der Bedingung des gehörten Sprachlauts
(im Beispiel: i*=1; Sprachlaut "A") seine Sprungweite
j* aufgrund der Beziehung
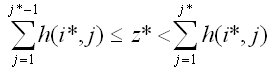
Z.B. sei z*=0,936274, damit wird j* = 4, als
Sprungweite also "LANG" ausgewählt. Der Springer
springt, aber zu weit, daher, wie beide feststellen, ein Mißerfolg.
Nun wird gelernt, d.h., die Wahrscheinlichkeiten
g und h werden verändert. Da ein Mißerfolg vorliegt,
wird
gesetzt, ebenso
Faktorg und Faktorh sind die Lernparameter,
Faktorg > 1 und Faktorh > 1. In unserem Beispiel wählten
wir Faktorg = Faktorh = 2, also
gesetzt, ebenso
Alle anderen Elemente der Markoff-Matrizen
bleiben unverändert.
Im Falle eines Erfolgs wären die Wahrscheinlichkeiten
vergrößert worden:
und
Nun ist aber die Zeilensummenbedingung der
Markoff-Matrix verletzt. Eine Normierung auf Zeilensumme = 1 behebt
dieses Problem. Es gilt also zusätzlich
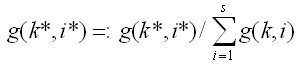 und
und
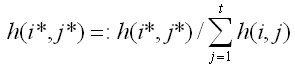
Das Ergebnis
Wenn in einer Iteration der Simulation ein
korrekter (nicht korrekter) Sprung erfolgte, werden die dazugehörigen
Elemente der beiden Markoff-Matrizen (also je eines pro Matrix)
vergrößert (verkleinert), alle anderen wegen der Normierungserfordernis
verkleinert (vergrößert). Die so entstandenen Zeilenmaxima
bzw. -minima können während der Anfangsphase eines Simulationslaufes
durchaus noch ihren Platz ändern. Nach einigen -zig Versuchen
"lernt" der Springer jedoch, auf den speziellen Zuruf
des Sprechers korrekt zu springen, der Sprecher "lernt",
die jeweilige Barrierenbreite mit einem jeweils dazugehörigen
Sprachlaut zu bezeichnen, der sich im Lauf der Zeit nicht mehr
ändert. Die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten konvergieren
gegen 1 (bzw. 0). Die anfänglich flexible "Wortwahl"
ist starr und irreversibel geworden. Die Worte besitzen eine für
die weitere Simulation unveränderliche Bedeutung.
Bei einer Wiederholung des Experiments können
sich unterschiedliche Bezeichnungen für eine bestimmte
Barrierenbreite herausbilden, z.B. könnte im ersten Fall
"KLEIN" mit "A" bezeichnet worden sein, in
der Wiederholung könnte "KLEIN" mit "C"
benannt werden. Die Semantik der Sprachlaute ist also arbiträr
wählbar (zufällig) geworden, aber einmal festgelegt,
gibt es innerhalb eines Durchlaufs ab einer bestimmten Anzahl
von Sprüngen nur noch äußerst selten (mit vernachlässigbarer
Wahrscheinlichkeit) eine Änderung.
Es ist interessant, daß sich während
eines Durchlaufs Situationen einstellen, die Äquivokationen
(gleicher Name für verschiedene Objekte) gleichen. So konkurrieren
z.B. die Barrierenbreiten "KLEIN" und "NORMAL"
durch längere Zeit hindurch um die Bezeichnung durch den
Buchstaben "B". "B" bedeutet für den
Springer, daß er mit etwa gleicher Wahrscheinlichkeit "KURZ"
oder auch "MITTEL" springen soll. Nach längerer
Laufzeit stellt sich jedoch die Eindeutigkeit her, indem ev. "KLEIN"
mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 "B" als Bedeutung
zugeordnet erhält, "B" bedeutet dann also "KLEIN",
"C" (oder "A") heißt dann etwa für
den Springer, er solle eine Sprungweite von "MITTEL"
(oder "LANG") wählen.
Auch das Umgekehrte zur Äquivokation
kann auftreten, nämlich zwei unterschiedliche Bezeichnungen
für dasselbe Objekt. In unserem Fall könnte die Barrierenbreite
"KLEIN" mit gleicher Wahrscheinlichkeit durch die Laute
"B" und "C" bezeichnet werden.
Die Sprungweite "ZUKURZ" (ihr entspricht
kein Zuruf durch den Sprecher) wird durch die Normierungsvorgänge
letztlich auf eine vernachlässigbar kleine Wahrscheinlichkeit
eingeschränkt. Der Springt springt dann so gut wie nie mehr
zu kurz.
Was sich in diesem Computerexperiment zeigt,
ist einerseits die Anpassung des Informationsapparates
an eine in bestimmter Weise wahrgenommene und erfahrene Umwelt,
andererseits stellt sich durch die zunächst zufällige
Kommunikation von Springer und Sprecher eine zuverlässige
Vereinbarung über die Bedeutung der in der Kommunikation
verwendeten Symbole her. In Welt B wird nach einer bestimmten
Lernzeit eine sprachliche Konstruktion von Welt A hergestellt,
d.h. es werden die als erfolgreich wahrgenommenen Zusammenhänge
von Welt A in Welt B übernommen. Zu Anfang der Simulation
gibt es eine Freiheit in der Zuordnung, die in Welt A, beschrieben
im klassischen physikalischen Bild, nicht vorkommt. Später
verliert sich die Zufälligkeit. Eindeutigkeit stellt sich
ein, und damit auch eine immer erfolgreichere Kooperation.
Es scheint erwähnenswert, daß sich
bei einer größeren Anzahl von möglichen Lauten
(Spalten der Sprechermatrix) oder möglichen Beobachtungen
(Zeilen der Sprechermatrix) als der Zahl angenommener Hindernisbreiten
dennoch Konvergenz gegen Wahrscheinlichkeit 1 einstellt, was bedeutet,
daß alle anderen Wahrscheinlichkeiten in der gleichen Zeile
gegen Null gehen. Dadurch "wählt" das System sozusagen
so viele Laute aus wie unterschiedliche Barrierebreiten auftreten.
Es beschränkt sein Repertoire auf das zur hinreichend differenzierten
Unterscheidung Notwendige.
Jenseits des chinesischen Zimmers
Der "blinde Springer" ist ein Beispiel
eines Programms, das in seinen Möglichkeiten über das
"Chinesische Zimmer" von Searle hinausweist. Man könnte
die beiden Simulationsmodelle in Gedanken vergleichbar machen,
indem man die chinesischen Fragekarten mit den Barrierebreiten
und die chinesischen Antwortkärtchen mit den Sprunglängen
identifiziert. Die Instruktionen stellen die Brücke zwischen
den Fragen und den Antworten dar. Sind bei Searle die Instruktionen
für die Zuordnung von Frage- und Antwortkarten fix vorgegeben
(und das ist nur für eine eingeschränkte Zahl von Fragen
und Antworten realisierbar), so bilden sich beim "blinden
Springer" diese Zuordnungen durch die Feststellung von Erfolg
oder Irrtum in Interaktion zwischen Springer und Sprecher erst
"von selbst" und unvorhersagbar heraus.
In bezug auf das eingeschränkte Repertoire (die Menge der vorhandenen Karten und Instruktionen bei Searle entspricht der endlichen Menge von Lauten bzw. Sprungweiten und Barrierebreiten beim blinden Springer) weisen die beiden Modelle durchaus die gleiche Komplexität auf. In dieser Hinsicht werden die Möglichkeiten des chinesischen Zimmers durch den blinden Springer nicht überschritten.
Natürlich kann nur dadurch von Selbstorganisation
gesprochen werden, indem wir bestimmte Prozesse im Computer als
unvorhersagbar annehmen, allen voran die Erzeugung von Zufallszahlen.
Der Zufallsgenerator wird in unserem Zusammenhang als black
box angesehen, obwohl auch die Zufallszahlen auf der Ebene
des Maschinencodes durch einen bestimmten Algorithmus erzeugt
werden. Diese willkürliche Einschränkung der Sicht entspricht
der Annahme des Turing-Tests für die Interaktion des Menschen
mit einem Terminal. Auch dort wird das Terminal als eine black
box phantasiert, hinter dem sich entweder ein lebendiger Mensch
oder eine Maschine verbergen kann. Der menschliche Forschungsdrang
wird sozusagen künstlich gelähmt.
Ein Vergleich mit Steinbuchs "Lernmatrix"
Abschließend soll die "Lernmatrix"
von Steinbuch (1961a; 1961b) mit dem hier beschriebenen Modell
verglichen werden. Die Lernmatrix war ursprünglich als anorganische,
elektronische Realisierung des "bedingten Reflexes"
gedacht , der bei höheren Lebewesen vorkommt. Im Gegensatz
zu angeborenen Reflexen (z. B. der Sehnenreflex: Durch Beklopfen
der Achillessehne oder der Patellarsehne läßt sich
eine Einzelzuckung der zugehörigen Muskeln bewirken; oder
der Fußsohlenreflex: Bei mechanischer Einwirkung auf die
Haut der Fußsohle werden die Zehen bzw. der Vorderfuß
kontrahiert) bilden sich bedingte Reflexe erst durch bestimmte
spezielle Erfahrungen aus. Ein berühmtes erstes Beispiel
ist der Hundeversuch von Iwan Petrowitsch Pawlow (Medizinnobelpreis
1904), der um die Jahrhundertwende nachwies, daß die verstärkte
Magensaftabsonderung bei Hunden, die einen angeborenen Reflex
darstellt und bei Anwesenheit von Futter zustandekommt, sich auch
dann einstellt, wenn z.B. nur ein Glockenton ertönt, falls
dieser Ton vorher mehrmals gemeinsam mit dem Futter angeboten
worden war. Steinbuch sieht in bedingten Reflexen "Schaltungen,
deren Verknüpfungsgesetz sich in Abhängigkeit von der
Eingangsinformation ändert" (Steinbuch 1961a: 37). Seine
"Lernmatrix" würde eine derartige Schaltung darstellen,
in deren Lernphase sich ein innerer "Zuordner" herausbilde,
der in der "Kannphase" die von außen vorgegebene
Zuordnung zwischen Input und Output widerspiegeln würde.
Zur Charakterisierung des Vorhandenseins eines Zusammenhangs zwischen
Input und Output schlägt Steinbuch einen speziellen Indikator,
er nennt ihn "Indiz" s,
vor, "ein Maß dafür ..., mit welcher Wahrscheinlichkeit
man auf Grund der bisherigen Beobachtungen schließen kann,
daß e ein Kennzeichen für b ist." (Steinbuch 1961a:
38). e meint dabei ein (binäres) Eingangssignal, b seine
zugehörige Bedeutung bzw. den gewünschten Output. s
= 1 heißt dabei, daß e mit maximaler Wahrscheinlichkeit
ein Kennzeichen für b ist, während s
= 0 besagt, daß aus den bisher angebotenen Datenpaaren von
e und b keinerlei Zusammenhang erschlossen werden kann. s
= -1 heißt, daß der Zusammenhang von b mit der Negation
von e höchste Wahrscheinlichkeit besitzt. s
wird dabei nicht aus einer einzigen Beobachtung errechnet, sondern
es wird eine gewisse (vorgebbare) Anzahl von Beobachtungen abgewartet,
die alle bei der Berechnung von s
berücksichtigt werden.
Nun wollen wir die Lernmatrix mit unserem Modell
des blinden Springers vergleichen. Es ist evident, daß in
unserem Modell nicht eine, sondern zwei Matrizen vorliegen, die
der Lernmatrix ähnlich sind. s
spielt eine analoge Rolle wie unsere g(k,i) bzw. h(i,j), die das
Ergebnis der kumulierten Erfahrung mit der Außenwelt repräsentieren.
Da wir aber keine Binärsignale benützen, sondern Ereignisse
welcher Art auch immer, verbleiben wir im nichtnegativen Bereich
der üblichen Definition von Wahrscheinlichkeiten (für
eine Lernmatrix mit nichtbinären Signalen siehe Müller
1964). Eine Veränderung von g(k,i) bzw. h(i,j) erfolgt in
unserem Modell zunächst bei Erfolg bzw. Mißerfolg nur
punktuell, an einem einzelnen Element der Matrix, durch die Normierungsvorgänge
werden aber alle Wahrscheinlichkeiten in der selben Zeile verändert.
Dieser Effekt bleibt im Steinbuchschen Modell aus. Hier wird ausschließlich
ein Element am Kreuzungspunkt eines einzelnen Inputs und eines
Outputs berücksichtigt. Eine weitere Differenz besteht in
der Trennung der Lern- von der Kannphase bei Steinbuch, während
unser Modell diese Trennung nicht kennt, sondern in Ausübung
seiner Aktivitäten lernt. Bei Steinbuch erfolgt der Übergang
zwischen "unbelehrtem" und "gelehrtem" Zustand
abrupt, im Sinne einer Sprungfunktion, bei uns verläuft er
inkremental über unterschiedlich große Wahrscheinlichkeiten.
Der größte qualitative Unterschied
zum Modell von Steinbuch ist unseres Erachtens im Vorhandensein
von zwei Matrizen in unserem Modell zu sehen, wonach (analog zu
Niklas Luhmanns systemtheoretischer Begriff der "doppelten
Kontingenz") eine bewertete (es muß die Unterscheidbarkeit
von Erfolg und Irrtum möglich sein) Interaktion von Individuen
(Pragmatik) die Konstruktion (also einen Entwurf, nicht ein Abbild)
von Semantik ermöglicht.
Die Steinbuchsche Lernmatrix führt zu
eindeutigen Ergebnissen und läßt keinen Platz für
Freiheitsgrade, während unser Modell die Wahl der Symbolik
ermöglicht. Von der pragmatischen Ebene aus betrachtet lernen
beide Modelle. Während Steinbuchs Matrix direkt lernt, mit
von außen vorgegebener Zuordnung zwischen Input und Output,
bringt der "blinde Springer" mittels einer in Kooperation
mit dem Sprecher festgelegten "Sprache" das gleiche
Ergebnis, aber auf einem Umweg, indirekt, zustande. Die Sprache
wird erst in Ausübung gemeinsamer Praxis konstruiert.
Letztere Beschreibung kann u. E. bestimmte Aspekte der Kommunikation
höherer Lebewesen besser darstellen als ein rigider Determinismus.
Ein soziales System?
Mit einiger Übertreibung könnten
wir beim Modell des blinden Springers sogar von der Entstehung
eines "sozialen Systems" sprechen, wenn wir Luhmanns
Definition heranziehen, in der die "doppelte Kontingenz"
eine zentrale Rolle spielt. Diese doppelte Zufälligkeit wäre
durch die Wahrscheinlichkeitsannahmen bei Springer und Sprecher
gegeben. Luhmann gibt bei einiger Phantasie im klaren Soziologendeutsch
eine Beschreibung unseres Modells. Man muß nur Springer
und Sprecher als black box ansehen: "Die Grundsituation der
doppelten Kontingenz ist einfach: Zwei black boxes bekommen es,
aufgrund welcher Zufälle auch immer, miteinander zu tun...Der
Versuch, den anderen zu berechnen, würde zwangsläufig
scheitern. Mit dem Versuch, ihn aus seiner Umwelt heraus zu beeinflussen,
kann man Glück haben und Erfahrungen sammeln... Die schwarzen
Kästen erzeugen sozusagen Weißheit, wenn sie aufeinandertreffen,
jedenfalls ausreichende Transparenz für den Verkehr miteinander.
Sie erzeugen durch ihr bloßes Unterstellen Realitätsgewißheit,
weil dies Unterstellen zu einem Unterstellen des Unterstellens
beim alter Ego führt...sie lernen jeweils selbstreferentiell
in ihrer je eigenen Beobachterperspektive. Das, was sie beobachten,
können sie durch eigenes Handeln zu beeinflussen versuchen,
und am feedback können sie wiederum lernen. Auf diese Weise
kann eine emergente Ordnung zustandekommen, die bedingt ist durch
die Komplexität der sie ermöglichenden Systeme, die
aber nicht davon abhängt, daß diese Komplexität
auch berechnet, auch kontrolliert werden kann. Wir nennen diese
emergente Ordnung soziales System." (Luhmann 1988: 156-157).
Schlußbemerkung
Anhand des hier vorgestellten Modells des blinden
Springers, das die Sicht der "Körperbasierten (embodied
and behavior-based) Artificial Intelligence" (wobei wir die
"Leiblichkeit" aus Kosten- und Zeitgründen ebenfalls
simulieren), der "Emergent AI" und des Freudschen Analysesettings
nützt, kann ein gewisser heuristischer Wert für Untersuchungen
im Bereich der Informationswissenschaften vermutet werden, die
sich nicht bloß entweder an sprachlichen oder an physischen
Phänomenen orientieren, sondern von einer interaktiven Kombination
beider Welten ausgehen. Es liegen uns Hinweise vor, daß
dieser kombinierte Ansatz bei geeigneter Modifikation eventuell
auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen fruchtbar gemacht
werden könnte. Eine Möglichkeit der Modifikation könnte
darin bestehen, daß die beiden Matrizen direkt miteinander
gekoppelt werden, also der Ausgang der einen Matrix direkt als
Eingang der anderen Matrix fungiert. Damit würde eine Reduktion
auf die sprachliche Ebene vorgenommen. Notwendig ist zusätzlich
irgend eine Art eines Algorithmus, der die Verknüpfungswahrscheinlichkeiten
zwischen Input und Output zu verändern erlaubt. Im Modell
des blinden Springers wählten wir ein Erfolgskriterium, wobei
die Übergangswahrscheinlichkeiten also bei Erfolg erhöht,
bzw. bei Mißerfolg reduziert werden. Interessanterweise
kann eine Kopplung und Koordination der beiden "Individuen"
auch dann zustandekommen, wenn kein Kriterium des äußerren
Erfolgs vorliegt, sondern wenn die Erhöhung bzw. Reduzierung
der Wahrscheinlichkeiten zufällig erfolgen. Im Rahmen einer
Dissertation im Bereich der Ethologie.wurde dieser Weg bereits
erfolgreich beschritten. Die Wahrscheinlichkeiten wurden sozusagen
selbstreferentiell verändert, also immer dann, wenn der/die
andere einen Laut geäußert hat, wurde zunächst
zufällig ein Laut produziert, der aber nicht nach außen
weitergegeben (sozusagen nur "gedacht") wurde, sondern
nur die Spalte zu bezeichnen half, in der die Wahrscheinlichkeit
erhöht werden sollte. Danach wurde mit demselben Mechanismus
aus der neuen (normierten) Verteilung ein Laut gezogen, der zur
Kommunikation mit dem/der anderen eingesetzt wird. In diesem Fall
kommt also ein Verfahren zur Anwendung, das nicht von einer direkten
Erfolgsverstärkung ausgeht, sondern vom indirekten Nutzen
koordinierten Verhaltens.
Eine weitere Modifikation könnte in der
verschachtelten wiederholten Anwendung des gleichen Prinzips von
Springer und Sprecher zur Herausbildung hierarchischer Strukturen
bestehen, wobei bestimmte Konstanten des vorliegenden Modells
(z. B. die Zahl der verfügbaren Laute oder der Anzahl unterschiedlicher
Sprungweiten) einer emergenten Veränderung unterworfen werden.
Derartige Forschungsarbeit muß aber erst in Zukunft geleistet
werden.
Literatur
Luhmann, N., Soziale Syteme, Grundriß einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1988
Müller, P., Lernmatrix für nichtbinäre Signale, in: Neuere Ergebnisse der Kybernetik, Oldenbourg, München, Wien 1964: 313-325
Prem, E., Körperbasierte Artificial Intelligence, Vortrag am Österreichischen Forschungsinstitut für Artificial Intelligence, am 17. Dezember 1996, Schottengasse 3, A-1010 Wien
Searle, J., The Myth of the Computer, in: New York Review of Books, 29. April 1982: 5
Searle, J., Is the Brain's Mind a Computer Program? in: Scientific American, January 1990: 26-31
Steinbuch, K., Die Lernmatrix, in: Kybernetik, Band 1, Heft 1, Jänner 1961a: 36-45
Steinbuch, K., Automat und Mensch - Über menschliche und künstliche Intelligenz, Springer, Berlin/Göttingen/Heidelberg 1961b: 153-176
Turing, A., Computing Machinery and Intelligence, in: Mind 59, 1950: 434-460
Turkle, S., Life on the Screen, Simon &
Schuster, New York etc. 1995