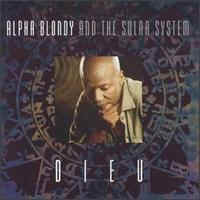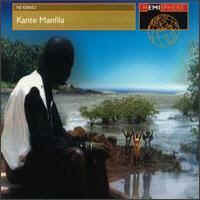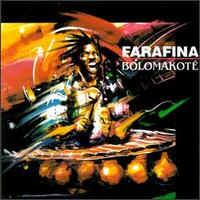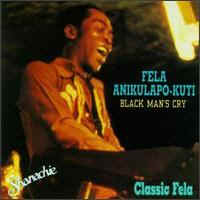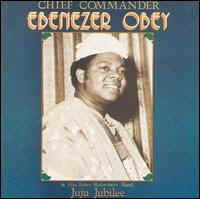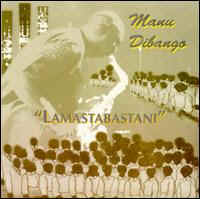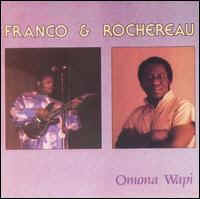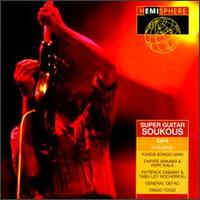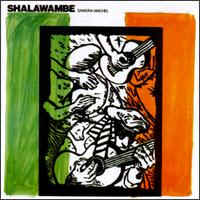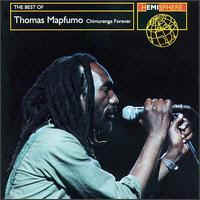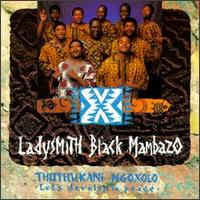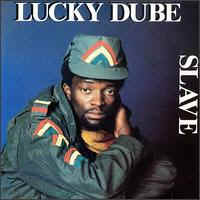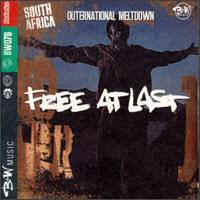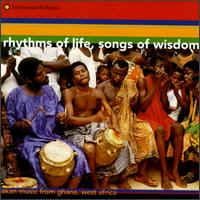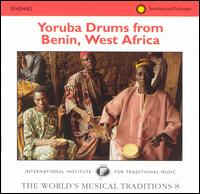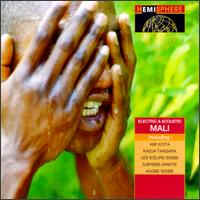
Ausgangspunkt unserer musikalischen Reise durch Afrika ist Mali. Dieses Land ist eines der wenigen in Afrika, dessen Künstler es wirklich geschafft haben, in ihrer Musik eine Balance zwischen Tradition und westlichen Einflüssen herzustellen. Einige der bekanntesten afrikanischen Musiker, wie Salif Keita oder Mory Kante, stammen aus diesem Land. "Electric & Acoustic Mali" (Hemisphere 7243 8 28186 2 5) ist ein sehr gut zusammengestellter Sampler, auf dem verschiedene Musiker, wie Kadja Tangara, Dounake Koita oder Ami Koita, eine der besten Sängerinnen des Landes, vertreten sind und der dadurch einen Querschnitt durch die Musikstile Malis bietet. In vielen Songs kommt der musikalische Background vom Balafon, über dessen Rhythmus die Melodielinien der elektrischen Gitarre gelegt werden.