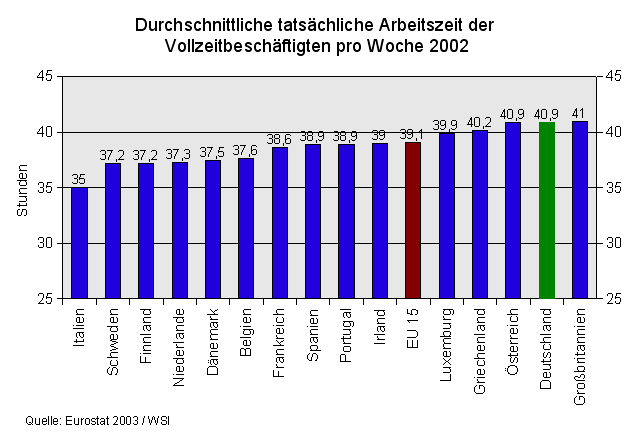
Michael Aharon Schüller's Private Office
[zurück] // [MAS private office] -> [Reflexionen] -> 1. Mai - Von den Floralien bis zum Kampftag der Arbeiter - und heute?
1. Mai - Von den Floralien bis zum Kampftag
der Arbeiter - und heute?
Arbeitszeit und Wirtschaftskrise
Der Maianfang stand
bei den Römern im Zeichen des Festes für die Blumen- und Frühlingsgöttin
Flora. Floralien, so hießen diese Festtage, breitete sich in die von Rom eroberten
Gebiete aus, nur in Kelten stieß es auf das zeitgleich
gefeierte Beltanefest; beide Feste verschmolzen später zu einem.
Volksbrauch ist nach wie vor das Tanzen in der Nacht vom 30. April auf den 1.
Mai, dem die Hexen - so alter Volksglaube - besonders wild frönten: sie ritten
mit ihren Besen durch die Lüfte, um am Brocken im Harz ihre Walpurgisnacht zu
feiern und dem Teufel zu huldigen.
Getanzt wird vor allem in Süd- und Mitteldeutschland, zumeist um einen besonders
geschmückten Baum, dem Maibaum.
Was machte das Frühlingsfest zum Arbeiterkampftag?
Die Industrialisierung der Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts führte zunehmend zu
einer Auflehnung der Arbeiterschaft gegen die unmenschlich langen Arbeitszeiten
von bis zu 16 Arbeitsstunden auch sonntags (max. Wochenarbeitszeit um 100 bis
112 Stunden), gegen die Kinderarbeit, gegen den fehlenden Arbeitsschutz.
Die erste dokumentierte Forderung nach einem 8-Stunden-Arbeitstag ist aus
Australien für das Jahr 1856 bekannt. Große Bedeutung erlangte die Rebellion
der nordamerikanischen Arbeiterbewegung, welche zu
einer Massenkundgebung in Chicago Ende April 1886 aufrief; auch sie forderte den
8-Stunden-Arbeitstag. Die Demonstration endete in den
ersten Maitagen in Chaos und Niederschlagung des Protests; zahlreiche Arbeiter
wurden verletzt, die Organisatoren der Verschwörung angeklagt und teilweise zum
Tode am Strang verurteilt, einer beging Selbstmord. Grund für die Zeitwahl war,
dass der 1. Mai in den USA traditionell als "Moving Day", als
Stichtag für den Abschluss oder die Aufhebung von Arbeitsverträgen, galt.
Dieser Protest ging in die Sozialgeschichte als Haymarket Riot ein. Seiner wurde
am Gründungstreffen der zweiten internationalen Arbeiterbewegung 1889 gedacht,
der 1. Mai als Kampftag der Arbeiterbewegung ausgerufen und erstmals 1890
abgehalten.
Ab 1900 legten in Österreich die Kollektivverträge fest, dass die Teilnahme an
den 1.Mai-Aufmärschen keinen Entlassungsrund mehr darstellt. 1955 anerkannte
Pabst Pius XII. den 1. Mai als Fest des "St. Josef der Arbeiter".
Was wurde am ersten "Kampftag der Arbeiterbewegung" gefordert?
In Österreich (Hainfelder Einigungsparteitag der Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei 1889) und Deutschland lauteten die Forderungen:
- 8-Stunden-Tag (in Österreich seit 1885 11-Stunden-Arbeitstag bzw.
66-Stunden-Arbeitswoche eingeführt)
- Verbot der Sonntagsarbeit (in Österreich seit 1885 eingeführt)
- Verbot der Kinderarbeit (in Österreich seit 1885 eingeführt)
- Arbeitschutzgesetze
- Allgemeines Wahlrecht
- Koalitionsfreiheit: das Recht, sich in Gewerkschaften zusammenzuschließen (in
Österreich teilweise ermöglicht ab den 1870er Jahren).
Wie entwickelten sich in Österreich politische Rechte, Arbeitszeit und
Erholungsurlaub?
1906 wird das allgemeine, gleiche, geheime Wahlrecht für erwachsene Männer
gewährt.
1919 wird unter Sozialminister Ferdinand Hanusch, Sozialdemokratische
Arbeiterpartei Österreichs, der 8-Stunden-Arbeitstag eingeführt.
1959 wird in Österreich im Generalkollektivvertrag die 45-Stunden-Arbeitswoche
bei vollem Lohnausgleich vereinbart; dies hatte der 1945 gegründete
Österreichische Gewerkschaftsbund 1957 gefordert.
1965 wird der gesetzliche Mindesturlaub von zwei auf drei Wochen verlängert.
1975 ist in Österreich die 5-Tage-Arbeitswoche mit insgesamt 40
Wochenarbeitsstunden bei vollem Lohnausgleich nach stufenweiser Einführung
Wirklichkeit geworden: 1970 - 43 Stundenwoche; 1971 - maximale Arbeitszeit auf
10 Stunden täglich begrenzt; 1972 - 42 Stundenwoche.
1975 wird abermals der gesetzliche Mindesturlaub um eine Woche auf vier Wochen
angehoben.
1985 wird in zahlreichen Kollektivverträgen die 38,5-Stunden-Arbeitswoche
verwirklicht.
1986 der der allgemeine Urlaubsanspruch letztmalig um eine weitere Woche auf 5
Wochen ausgedehnt.
Fazit: von vor 1885 bis heute wurde in Österreich die Wochenarbeitszeit von gut
100 Stunden auf 40 bzw.
38,5 Stunden gesenkt, der allgemeine Urlaubsanspruch auf 5 Wochen erweitert. Im
länderweiten Vergleich ergibt sich für 2002:
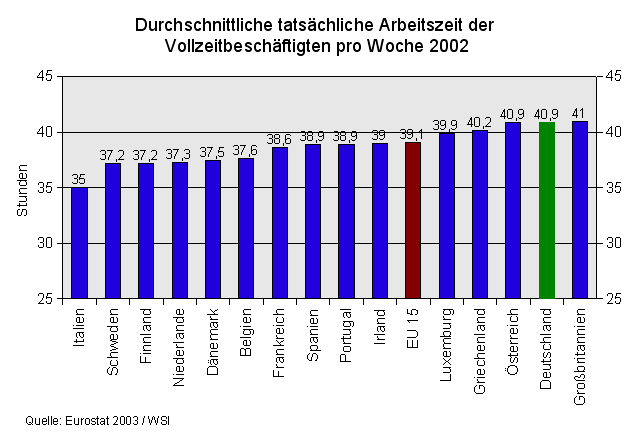
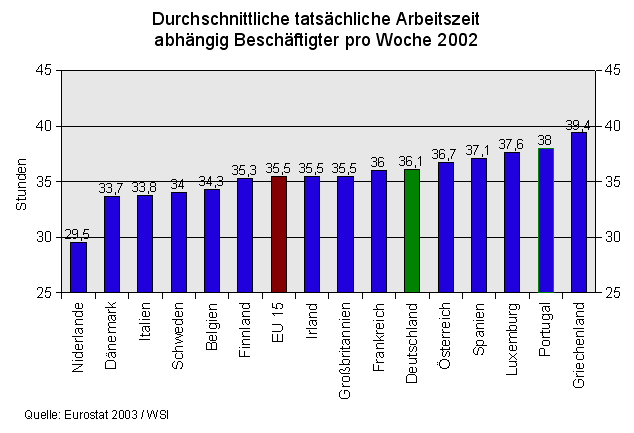
U.a. um die mit Blick auf Osteuropa und Dritte-Welt-Länder relativ hohen
Lohnstückkosten zu senken, fordert die österreichische
Industriellenvereinigung seit 2004 eine Verlängerung der täglichen
Normalarbeitszeit um zwei Stunden auf zehn Stunden; gewünscht wird außerdem
eine Reduktion der gesetzlichen Feiertage.
Fakt ist, das in Österreich bereits jetzt auf "freiwilliger" Basis die
Wochenarbeitszeit höher geworden ist: Arbeiter und Angestellte arbeiten in
Überstunden, teils auch samstags und sonntags. Grund für den scheinbaren
Arbeitseifer ist die zunehmende Sorge um den Arbeitsplatz, nicht zuletzt im
Hinblick auf die zurückgefahrenen Arbeitslosengelder- und sonstigen
Sozialansprüche. Stellten Anfang der 70er Jahre die Arbeiter und Angestellten
vor Antritt einer Arbeitsstelle noch recht hohe Forderungen nach Mehrurlaub und
anderen Vergünstigungen - was ihnen die arbeitskraftsuchende Unternehmerschaft
wohl oder übel einräumte -, so sind es nun die ArbeitgeberInnen, die
Entlohnung und Gehalt, Vergünstigungen und Rechte der Arbeitnehmer nach unten
zu drücken versuchen.
Kann durch Drehen an der gesetzlichen Arbeitszeit an der misslichen
wirtschaftlichen Lage etwas verbessert werden? Kann die hohe Arbeitslosigkeit
dadurch gesenkt werden?
Was bringt einer Volkswirtschaft mehr: die Arbeitszeitverlängerung ohne
Lohnausgleich - wie dies die ArbeitgeberInnen behaupten - oder die
Arbeitszeitverkürzung - wie jenes die Gewerkschaften und arbeitnehmernahen
Parteien und Organisationen vertreten?
Aus Arbeitergebersicht sänken bei Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich
die Lohnstückkosten, die Wettbewerbsfähigkeit stiege an, die Wirtschaft liefe
wieder rund, die Arbeitslosenzahlen nähmen ab. Arbeitnehmer halten dagegen, die Wettbewerbsfähigkeit sei kaum
mehr zu steigern, die Binnenkaufkraft aber schwände, die Wirtschaftskrise
verschärfte sich..
Aus Arbeitnehmersicht erscheint die Arbeitszeitverkürzung - z.T. als
Teilzeitarbeit - als echte Alternative: die Arbeitsproduktivität je
Arbeitsstunde stiege, die Kosten sänken (da geringere Beiträge zur
Arbeitslosenversicherung etc. zu bezahlen seien), die Arbeit würde sich auf
mehr Arbeitnehmer aufteilen, die Arbeitslosigkeit sänke. Nachteil dieses Modells ist, dass
die Brutto- und
Nettolöhne niedriger ausfielen, letztere wegen der Steuerprogression (Hineinrutschen in
niedrigere Steuerklassen) etwas weniger. Doch gerade die Aussicht auf geringere
Entlohnung bzw. kleineres Gehalt lässt Arbeitnehmer vor der Annahme einer
Teilzeitarbeitsstelle zurückschrecken. Eine Lohnerhöhung käme aber nach Meinung
der Arbeitgeber schon gar nicht in Frage, würde sie die wettbewerbsrelevanten
Lohnstückkosten erst recht erhöhen.
Unbestritten ist - und dies bemängeln die Globalisierungskritiker -, dass die
Unternehmen ungehindert Produktionen und Dienstleistungen in jenen Ländern
erwerben können, die ein niedriges Lohn- bzw. Gehaltsniveau aufweisen. Freier
Geld-, Waren-, Dienstleistungs- und Personenverkehr ist geradezu Motor dieser
"Umverteilung" von Arbeit aus Ländern mit hohen Arbeitskosten in
solche mit niedrigen.
Eine Frage ist nun: ist eine Umverteilung von Arbeit weltweit grundsätzlich
wünschenswert? Falls ja, wieweit kann man diese Umverteilung
"regulieren", ohne das Prinzip der vier Freiheiten ad absurdum zu
führen?
M.E. erfährt die Wirtschaft seit etwa zwei Jahrzehnten einen enormen,
lawinenartig anschwellenden Produktivitätszuwachs durch den Einsatz der
elektronischen Datenverarbeitung und der damit verknüpften Digitalisierung
zahlreicher Vorgänge in Produktion bzw. Dienstleistung. Direkt erzwingt dies
bei gegebener Produktions-/Dienstleistungsmenge ein Zurückfahren menschlicher
Arbeitskraft je Zeiteinheit. Indirekt ermöglicht der EDV-Einsatz eine
Ortsunabhängigkeit von Leistungen aller Art, die fremde Arbeitsmärkte in
bislang ungekannter Weise zugänglich machen. Arbeitskraft - und dazu noch
billige - steht in Hülle und Fülle zur Verfügung wie es noch nie die der Fall
war.
Daher lautet die zweite, vielleicht noch drängendere Frage: wie lange wird dieser
Prozess der Produktivitätssteigerung durch Einsatz von EDV und mittelbar durch
Ortsunabhängigkeit noch andauern: kommt er zu einem Ende und wann? Führt
die Entwicklung infolge zurückgehender Produktivitätssteigerung auf einen
Plafond, auf dem eine Konsolidierung möglich ist?
Die Antworten bleiben - trotz aller Gurus mit ihren lauthals verkündeten
Meinungen, Expertisen und Zukunftsvisionen - im Dunkeln oder im zumindest
kollektiv noch nicht Gewussten: Zu diesem zählt die von Sozialwissenschaftlern
in absehbarer Zeit erwartete Beendigung der Arbeitslosigkeit aus demographischen
Gründen - mit der Lupe würden in nicht ferner Zukunft die Unternehmen
Arbeitswillige suchen, der oben angesprochene Plafond wäre u.a. aus diesem
Grund erreicht ... Doch zurück: Resultat der unklaren und verdunkelten Zukunftssicht ist eine
Verunsicherung bei Arbeitnehmern, aber auch Arbeitgebern. Erstere sparen
eichhörnchenartig in größerem Ausmaß, um den Wechselfällen des Lebens
(Pensionsausfall, Krankheit, Pflegekosten etc.) parieren zu können - was aber
den Binnenmarkt schwächt, zweitere wissen nicht, wo investieren, da die
Nachfrage im Binnenmarkt, aber auch Außenmarkt weiterhin gering oder künftig
schwächer eingeschätzt wird. Das
überschüssige Geld aus den Gewinnen wird daher entweder ausgeschüttet in Form von Dividenden oder gleichsam
"vernichtet", indem Aktien des eigenen Unternehmens zurückgekauft
werden: für weitere Aktienoptionen für das Management, als Kurspflege für die Aktionäre, als
Aufziehen eines Schutzwalles vor (feindlichen) Übernahmen, um wichtige
Beispiele zu nennen. Jedenfalls: ganz
rosig sieht man die Zukunft in den Vorstandsetagen offenbar nicht, sonst würde
man Gewinne und gegebenenfalls das derzeit zinsgünstige Fremdkapital
möglichst rasch und möglichst reichlich in Sachinvestitionen anlegen; aber
noch nicht einmal Finanzanlagen lohnen sich: Zinstief und möglicherweise schon
weit vorausgelaufener Aktienmarkt laden nicht gerade zum Investment ein - und
Derivativmärkte mit ihren Hebeln sind nun einmal höherriskante Märkte als es
die Warenmärkte (hier: Wertpapiere) sind. Und Österreich kennt ein
Unternehmen, das sich in den 1980ern nichts anderes wusste als Optionsgeschäfte
abzuschließen - und millionenschwer verlor. Die Pikanterie am Rande: es war ein
staatseigener Betrieb ...
Doch zurück zum 1.
Mai: was ist er heute?
Während der 1. Mai als Tag der Arbeit gesetzlicher Feiertag in Österreich (mit
Beginn der 1. Republik ab 1919),
Deutschland, der Schweiz und anderen Ländern ist, gilt er in anderen Ländern
nicht als solcher, oder der Tag der Arbeit wird an einem anderen Tag abgehalten,
so in den USA im September als Labour Day. In einigen Ländern werden
Arbeiter, die den Tag der Arbeit zum Vorbringen ihrer Forderungen nutzen, durch
staatliche Gewalt eingeschüchtert und bedroht, so z.B. in Südkorea. Da kann
man sich schon freuen, wenn heute ein österreichischer Nachrichtenkommentator
die Situation seines Landes so wiedergibt: vor Jahrzehnten als Kampftag der Arbeiterbewegung
eingeführt, zeigt der 1.Mai heute Volksfestcharakter ...
Na denn: Prost!
MAS 1.5.2005