Michael Aharon Schüller's Private Office
zurück // MAS private office -> Tagesinformationen -> April 2005 -> Mittwoch 20.4.2005
![]()
NB 1: Bitte beachten: die hier angeführten Copyright-geschützten Texte und Graphiken u.a. sind nur für den persönlichen Gebrauch! Dies gilt auch für einen Teil der hier erwähnten LINKS!
NB 2: Die Artikel werden weitgehend ungeordnet präsentiert, sie sind nach Wichtigkeit ( durch !-Markierung) oder nach Rubrik nur ansatzweise geordnet.
vgl. auch NZZ 20.4., S. 4 (Schwedens Sozialdemokraten und Persson), S. 5 (Lösung der Flüchtlingsfrage im Nahostkonflikt)
1) Kardinal Ratzinger zum Papst gewählt (NZZ
20.4.) mehr...
Der neue Pontifex nennt sich Benedikt XVI.; dazu:
Freude in Deutschland über die Papstwahl
Schröder spricht von einer Ehre für die Bundesrepublik
Lebensstationen
Regensburg und Pabstbruder
NZZ-Kommentar: Keine «Verlegenheitslösung»
2) General Motors in miserabler Verfassung (NZZ 20.4.) mehr...
Rückzug der Ertragsprognose für 2005; dazu:
GM streicht die Gewinnprognose (HB 20.4.)
Milliardenverlust im Kerngeschäft
Gesundheitskosten belasten den weltgrößten Autokonzern
3) Pessimistische Stimmung unter Fondsmanagern (NZZ 20.4.) mehr...
Umschichtungen in defensive Aktien
4) Der Deutsche Joseph Ratzinger (HB 20.4.) mehr...
ist neuer Papst Benedikt XVI. Weißer Rauch schon am zweiten Tag des Konklaves
Köhler und Schröder gratulieren; dazu:
Die deutschen Pontifikate
5) Datenschützer greift Regierung an (HB 20.4.) mehr...
Bundesbeauftragter für Datenschutz wirft Rot-Grün mangelnden Respekt vor den Rechten der Bürger vor
6) Neue Hartz-IV-Regeln stärken Arbeitsanreize nur wenig (HB 20.4.) mehr...
Institut sieht geplante Zuverdienstregeln skeptisch – Kabinett berät Paket für ältere Arbeitslose
7) Volkswirte nehmen Rückgang des ZEW-Indexes gelassen (HB 20.4.) mehr...
Dresdner Bank erwartet in diesem Jahr einen Anstieg der Investitionen
8) Attacken gegen das Kapital rütteln die Basis auf (HB 20.4.) mehr...
SPD verzeichnet Mobilisierungseffekt im NRW-Wahlkampf
Meinungsforscher halten rot-grüne Mehrheit gleichwohl für unwahrscheinlich
9) Schwarze Zahlen bei den Sozialkassen (HB 20.4.) mehr...
10) Investitionen sinken im Osten auf Rekordtief (HB 20.4.) mehr...
Städtetag beklagt schlechte Finanzlage der Kommunen
11) China führt Afrikas Neu-Entdeckung an (HB 20.4.) mehr...
Asiens und Afrikas Staatschefs beleben die Süd-Süd-Kooperation
Kontinente ergänzen sich wirtschaftlich
12) FBI besorgt über Extremisten im eigenen Land (HB 20.4.) mehr...
US-Terrorabwehr warnt vor weißen Rassisten, Antisemiten und radikalen Umweltschützern
Bündnis mit Islamisten befürchtet
13) VERANTWORTUNG DER WIRTSCHAFT: Jobs und Moral (HB 20.4.) mehr...
14) München ist für Sandoz erste Wahl (HB 20.4.) mehr...
Novartis-Tochter will ihre Generika-Zentrale aus Wien verlagern
Zunächst 150 Arbeitsplätze betroffen; dazu:
SANDOZ - Alpen-Transfer (HB 20.4.); dazu weiters:
„Das bessere Bayern ist Österreich mit Sicherheit nicht“
(HB 20.4.)
15) FINANZMÄRKTE: Gesunder Realismus (HB 20.4.) mehr...
16) SPD: Ute in Absurdistan (HB 20.4.) mehr...
17) Götterdämmerung über Washington (HB 20.4.) mehr...
Amerika fürchtet den Tag X: Der Tod eines Supreme-Court-Richters könnte in den
USA einen Kulturkampf auslösen. Innenansichten des mächtigsten Gerichts der Welt.
18) Zwischen Potenzial und Kostendämpfung
(HB 20.4.) mehr...
Die deutsche Industrie will am erwarteten Wachstum der Gesundheitsbranche teilhaben
19) Kliniken rüsten sich für Wettbewerb (HB 20.4.) mehr...
20) Hedge-Fonds-Geschäft wird riskanter Experten rechnen mit sinkenden Renditen
(HB 20.4.) mehr...
Noch verzeichnet die Branche kräftiges Wachstum
21) Krankenversicherer DKV verliert Kunden (HB 20.4.) mehr...
Ergo-Tochter will 2005 durch neue Vertriebskonzepte die Wende einleiten
22) Ärzte müssen Rechnungen herausgeben (HB 20.4.) mehr...
Bundesgerichtshof: Kein Datenschutz in der Insolvenz
Urteil gilt auch für Anwälte und Steuerberater
23) Mittelstand nimmt sich eine Auszeit (HB 20.4.) mehr...
Perspektiven der inhabergeführten Unternehmen sind moderat – Angst vor den Billiglohnländern im Osten
24) Studie verglich europäische Institute (WZ 20.4.) mehr...
Heimische Banken wenig rentabel
25) Kampf gegen sinkende HV-Präsenzen (IVA-Homepage, 20.4.) mehr...
1) Kardinal Ratzinger zum Papst gewählt (NZZ
20.4.) nach oben
Der neue Pontifex nennt sich Benedikt XVI.
Am Dienstag ist der deutsche Kardinal Joseph Ratzinger zum Nachfolger von Papst Johannes Paul II. gewählt worden. Der 78-Jährige, der sich den Namen Benedikt XVI. gab, hatte unter seinem Vorgänger viele Jahre die Kongregation für die Glaubenslehre geleitet; er erlangte dabei den Ruf eines strengen Wächters über den Glauben.
Tz. Rom, 19. April
Am Dienstagabend ist um 17 Uhr 50 plötzlich weisser Rauch aus dem Kamin der Sixtinischen Kapelle aufgestiegen. Kurz nach 18 Uhr liess das Geläut der Glocken des Petersdoms und darauf aller Kirchen von Rom keine Zweifel mehr: Die 115 wahlberechtigten Kardinäle der katholischen Kirche hatten in nur vier Urnengängen einen neuen Papst aus ihrem Kreis ausgewählt. Nach weiteren 40 Minuten trat der Kardinaldiakon Jorge Arturo Medina Estévez auf die Loggia des Petersdoms, um dem wartenden Volk zu verkünden: «Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam» (Ich verkünde euch eine grosse Freude. Wir haben einen Papst).
Wächter über den Glauben
Der Prälat teilte der aufgeregt wartenden Menge mit, dass der deutsche Kardinal Ratzinger zum 264. Nachfolger Petri beziehungsweise zum 265. Bischof von Rom gewählt worden sei und dass er für sein Pontifikat den Namen Benedikt XVI. gewählt habe (das Pontifikat von Benedikt XV. hatte von 1914 bis 1922 gedauert). Kurz darauf trat der neue Pontifex, der erst gerade am letzten Samstag 78 Jahre alt geworden war, lächelnd auf den Balkon über dem Portal des Petersdoms, um in flüssigem Italienisch, aber mit gut hörbarem deutschem Akzent, zu erklären, dass die Kardinäle ihn, der nur ein einfacher, bescheidener Arbeiter im Weinberg des Herrn sei, zum neuen Kirchenoberhaupt gewählt hätten. Darauf erteilte der seit rund 500 Jahren erste deutsche und bereits zweite nichtitalienische Papst den obligaten Segen «Urbi et Orbi». Auf diese eindrücklichen, in alle Welt ausgestrahlten Szenen folgte auf Hunderten von Fernseh- und Radiokanälen sogleich ein unsägliches, geradezu an die babylonische Sprachverwirrung erinnerndes Gemisch von Kommentaren und Interpretationen von Journalisten, Vatikanisten, Priestern, Politikern und einfachen Leuten auf dem Petersplatz, die ebenfalls stürmisch nach ihrer Meinung zum neuen Papst befragt wurden.
Der aus Bayern stammende neue Oberhirte war von Johannes Paul II. im November 1981 zum Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre ernannt worden. Er leitete als Dekan des Kardinalskollegiums mit einer für ihn bisher eher ungewöhnlichen Emotionalität die Totenmesse für seinen Vorgänger. Zudem hielt er die letzte Predigt vor dem Konklave, in der er seine wahlberechtigten Kollegen mit Nachdruck vor der «Diktatur des Relativismus» warnte und zu einem klaren Glauben ermahnte, der allein dem wahren Humanismus verpflichtet sei und nicht den Wellen der Mode und des letzten Schreis folgen dürfe. Ratzinger hatte zwar während der letzten Wochen zu den Papabili, den Kronfavoriten für das Petrusamt, gezählt. Doch er schien derart gut im Rennen zu liegen, dass er über die Faustregel zu stürzen drohte, dass jene, die als Papst ins Konklave einziehen, die Sixtinische Kapelle wieder als Kardinal verlassen. Überraschend kam die Wahl auch insofern, als Ratzinger vorab ein Mann der Lehre und der Kurie ist, der als scharfsinniger Intellektueller gerne Streitgespräche führt; doch über pastorale Erfahrung von Bedeutung verfügt der neue Oberhirte kaum - dies im scharfen Kontrast zu seinem charismatischen Vorgänger aus Polen. Der am 16. April 1927 in Marktl am Inn geborene Sohn eines Gendarmeriemeisters trat während seiner steilen Laufbahn vorab als Professor und später in der Kurie auch als Zensor in Erscheinung. Er war in erster Linie ein Mann des Katheders und nicht der Kanzel.
Nicht zuletzt in seiner eigenen Heimat wurde Ratzinger immer wieder als rigider Dogmatiker, als allzu rigoroser Wächter über die Lehren der katholischen Kirche gesehen und kritisiert. Tatsächlich setzte sich Ratzinger nicht nur kritisch mit der lateinamerikanischen Theologie der Befreiung auseinander, sondern tolerierte auch in Sachen Empfängnisverhütung und Frauenordination kein Entgegenkommen. Und er lehnte auch für andere christliche Glaubensgemeinschaften den Begriff von Schwesterkirchen ab. Die Federführung hatte Ratzinger auch beim neuen Weltkatechismus, der 1992 publiziert wurde und für einige Diskussionen sorgte.
Ein Mann des Übergangs?
Kritiker des neuen Papstes werden natürlich rasch darauf hinweisen, dass Ratzinger in bloss vier Urnengängen von einem Gremium gewählt wurde, das sich fast ausschliesslich aus Kardinälen zusammensetzte, die von Johannes Paul II. «kreiert» worden waren. Tatsächlich waren von den 115 wahlberechtigten Purpurträgern, die sich am Konklave beteiligt hatten, bloss 2, nämlich Ratzinger und der amerikanische Kardinal Baum, vor der Zeit Johannes Pauls II. ernannt worden. Wie das Pontifikat von Ratzinger aussehen wird, lässt sich vorderhand aber höchstens vermuten. Schon Johannes Paul II. hatte ja für einige Überraschungen gesorgt, wobei er allerdings für viele Beobachter noch ein unbekannter Outsider gewesen war.
Mit der Wahl von Ratzinger dürften sich die Kardinäle allerdings nicht nur für die bisherige Linie in der Glaubenslehre ausgesprochen haben, sondern auch einen Kandidaten vorgezogen haben, dessen Pontifikat deutlich kürzer zu werden verspricht als das vorangegangene. Johannes Paul II. war ja bei seiner Wahl im Jahre 1978 erst 58 Jahre alt und damit zum Zeitpunkt des Konklaves 20 Jahre jünger als sein Nachfolger. Zudem soll Ratzinger bereits zwei Schlaganfälle hinter sich haben. Und in den vergangenen Jahren habe er auch schon wiederholt den Wunsch geäussert, aus gesundheitlichen Gründen von seiner Aufgabe als Präfekt der Glaubenskongregation entbunden zu werden. In seiner letzten Predigt vor dem Beginn des Konklaves hatte Ratzinger selber noch dafür gebetet, dass Gott einen «Seelsorger nach seinem Herzen» bestimmen möge, einen «Hirten, der zur Erkenntnis Christi führt, zu seiner Liebe und zur wahren Freude».
dazu:
Freude in Deutschland über die Papstwahl nach oben
Schröder spricht von einer Ehre für die Bundesrepublik
Die Wahl von Kardinal Joseph Ratzinger zum Papst hat in der Bundesrepublik Freude und Stolz ausgelöst. Zugleich hat ein Teil der deutschen Katholiken zu dem Vertreter einer konservativen Grundhaltung eine konfliktbeladene Beziehung.
eg. Berlin, 19. April
Mit einer so raschen Einigung der Kardinäle in Rom auf einen Nachfolger für Johannes Paul II. hatte in Deutschland kaum einer gerechnet, und so dauerte es am Dienstagabend einige Zeit, bis die ersten Stellungnahmen zur Wahl von Joseph Ratzinger zum Papst eingingen. Kanzler Schröder bezeichnete die Entscheidung als grosse Ehre für Deutschland. Er sagte, er freue sich schon jetzt, das neue Kirchenoberhaupt beim Weltjugendtag in Köln willkommen zu heissen. Die Oppositionsführerin Merkel erklärte, die Wahl eines Deutschen sei ein Moment des Stolzes. Bayerns Ministerpräsident Stoiber sprach von einem historischen Tag für Bayern und ganz Deutschland.
Zwiespältiger Ruf
Ratzinger ist der erste deutsche Papst seit dem Mittelalter, wobei sich damals in der Mitte Europas ein Nationalgefühl erst zu regen begann. Die sieben «Deutschen» auf dem Stuhl Petri entstammten dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, das auch in seiner territorialen Ausdehnung wenig Ähnlichkeit mit dem Deutschland der Neuzeit hatte. So kam der letzte der «deutschen» Päpste im ausgehenden Mittelalter, der 1522 gewählte Hadrian VI., aus Utrecht in den heutigen Niederlanden. Dennoch bedeutet die Wahl eines Deutschen zum Pontifex eine Zäsur. Im letzten Jahrhundert wäre diese undenkbar gewesen: erst wegen des gleichsam natürlich erscheinenden Anrechts der italienischen Kardinäle auf den Papstthron, dann als Reaktion auf die in deutschem Namen begangene Barbarei. Dass diese dunkle Vergangenheit keinen Hinderungsgrund darstellt, gehört aus deutscher Perspektive sicher zu den Besonderheiten dieser Papstwahl.
In seinem Heimatland geniesst der neue Papst Benedikt XVI. einen zwiespältigen Ruf. Nirgendwo sonst haderte man so offen mit dem Konservatismus des Erzbischofs von München, der 1981 zum Präfekten der Glaubenskongregation im Vatikan berufen worden war. Die Spannungen kulminierten in den neunziger Jahren, während des quälend langen Streits um die Abtreibungsfrage. Obwohl Ratzinger und Papst Johannes Paul II. identische Auffassungen vertraten, verübelte man die apodiktische Haltung Roms vor allem dem aus Bayern stammenden Kardinal. Im Juni 1998 forderte Ratzinger die deutschen Bischöfe unmissverständlich auf, ein neues Konzept für die Schwangerenberatung vorzulegen. Katholische Organisationen sollten keine Bestätigungen mehr ausstellen, welche die Voraussetzung für einen straffreien Abbruch darstellten. Widerstrebend beugten sich die Bischöfe.
Ein Zeichen in einem säkularen Land
Seit diesem Konflikt sahen viele Deutsche - sofern sie überhaupt am Geschehen in den Kirchen teilnahmen - in Ratzinger den «Grossinquisitor aus Marktl am Inn», wie ihn die «Süddeutsche Zeitung» apostrophierte. Zugleich erzielten seine Bücher auch in der Bundesrepublik hohe Auflagen; er galt als Theologe, der eine klare Orientierung zu geben verstand und als Protagonist der Wertediskussion. Am Dienstagabend überwog in Zentren des Katholizismus wie Köln in ersten Reaktionen von Gläubigen die Freude. Die Wahl eines deutschen Oberhirten stärkt die katholische Kirche, die seit dem historischen Jahr 1989 noch deutlicher die Folgen der allgemeinen Säkularisierung verspürt. Durch den Beitritt der DDR ist Deutschland protestantischer, vor allem aber atheistischer geworden. Zu den wenigen dauerhaften Folgen des kommunistischen Regimes zählt eine breite Entkirchlichung in allen Bereichen der ostdeutschen Gesellschaft. Dies trifft zunächst den Protestantismus, der jenseits der Elbe traditionell dominierte. Doch die Entwicklung geht über Ostdeutschland hinaus, und so ist seit der Wiedervereinigung auch die Stimme des Katholizismus schwächer geworden. Johannes Paul II., der erste Nichtitaliener der jüngeren Geschichte, kam aus
einem katholischen Land. Über Benedikt XVI. lässt sich dies nicht sagen.
Lebensstationen Benedikts XVI.
16. April 1927 Geburt in Marktl am Inn, Bayern.
1946-1951 Studium der Theologie und der Philosophie in München und Freising.
1951 Priesterweihe.
1957-1969 Professor für Dogmatik und Fundamentaltheologie, nacheinander in Freising, Bonn, Münster und Tübingen.
1962 Berater von Kardinal Joseph Frings am Zweiten Vatikanischen Konzil.
1969-1977 Professor für dogmatische Theologie an der Universität Regensburg.
1977 Ernennung zum Erzbischof von München und zum Kardinal.
1981 Ernennung zum Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre sowie zum Vorsitzenden der Päpstlichen Bibelkommission und der Internationalen Theologenkommission.
1986-1992 Präsident der Kommission zur Ausarbeitung des Katechismus.
2002 Wahl zum Dekan des Kardinalskollegiums.
er Papst von nebenan
Stolz der Regensburger auf ihren Papst Benedikt XVI. nach oben
afr. Regensburg, 19. April
Georg Ratzinger, der ältere Bruder des neuen Papstes, ist kreidebleich. Den vielen Journalisten, die sich seit dem Beginn des Konklaves in Regensburg aufhalten und die nun vor seiner Haustüre stehen, zeigt sich der 81-Jährige nur kurz vom Balkon aus. Interviews möchte er jetzt lieber keine geben, sagt der sichtlich erschöpfte Mann zu den Reportern. Nur so viel: «Mir wäre es lieber gewesen, es wäre anders gekommen.» Der Bruder von Papst Benedikt XVI. lebt in einer kleinen Wohnung in der Regensburger Altstadt, nur einen Steinwurf vom Dom entfernt. Auch er ist katholischer Geistlicher. Die Ähnlichkeit mit seinem Bruder Joseph ist unübersehbar, das gleiche schlohweisse Haar, die gleiche Stimme. Noch vor zwei Tagen hatte Georg Ratzinger Reportern ins Mikrofon gesagt: «Ich bin der festen Überzeugung und hoffe, dass der Kelch an ihm vorübergeht.»
Mit Regensburg verbunden geblieben
Doch nun ist es anders gekommen. Als Joseph Ratzinger Anfang der siebziger Jahre seine Lehrtätigkeit an der Theologischen Fakultät der Universität Regensburg aufnahm, kaufte er ein Haus in Pentling, einer kleinen Vorortgemeinde von Regensburg. Ein schlichter Bau, nichts Besonderes. Der Wahlheimat in der Oberpfalz blieb er treu, auch als er später zum Erzbischof von München und Freising und schliesslich in den Vatikan berufen wurde. Regelmässig verbrachte Joseph Ratzinger seinen Urlaub bei seinem Bruder in Bayern, hielt - wenn der örtliche Pfarrer verreist war - Gottesdienste in der Pfarrkirche von Pentling. Auch im benachbarten Regensburger Stadtteil Ziegetsberg half er regelmässig aus und las die Messe. Auf dem kleinen Friedhof neben der dortigen Pfarrkirche liegen die Schwester des neuen Papstes, Maria Ratzinger, begraben, und auch die Eltern. Die Brüder Ratzinger hatten die Gebeine der Eltern eigens vor einigen Jahren von ihrem Heimatort Marktl in Oberbayern hierher umbetten lassen.
Um das Ratzinger-Haus in Pentling, das die meiste Zeit unbewohnt ist, kümmert sich ein freundlicher älterer Herr von nebenan. Der Kardinal, wie er bis jetzt genannt worden ist, ist in der kleinen Gemeinde und in Regensburg gut bekannt, in der Nachbarschaft hört man nur Gutes über den berühmten Mann aus Rom. Hans Hopfensperger etwa, der Kommandant der freiwilligen Feuerwehr, weiss so manche nette Geschichte zu erzählen. «Wenn der Kardinal hier Urlaub macht und ich sage <Guten Morgen, Herr Kardinal> zu ihm, dann grüsst er immer mit den Worten <Guten Morgen, Herr Kommandant> zurück.» In den vergangenen Jahren erteilte der zweitwichtigste Mann der katholischen Kirche immerhin drei neuen Löschfahrzeugen der freiwilligen Feuerwehr Pentling den Segen.
Freude an den Domspatzen
Stolz gab sich am Dienstagabend auch der Oberbürgermeister von Regensburg, Hans Schaidinger. Er hatte, als er in den siebziger Jahren Volkswirtschaftslehre studierte, gelegentlich auch die Theologie-Vorlesungen des Dozenten Ratzinger besucht. Mucksmäuschenstill sei es im Hörsaal immer gewesen, erinnert sich der CSU-Politiker. Ratzinger sei ein begnadeter Redner und ein hoch angesehener Denker gewesen. Vielleicht, fügt der Kommunalpolitiker hinzu, falle nun ein wenig vom Glanz des neuen Papstes auf seine Wahlheimat ab. Oft konnte man die beiden Brüder Ratzinger gemeinsam in den Konzerten der Regensburger Domspatzen sehen. Georg Ratzinger war 30 Jahre lang Leiter des weltberühmten Knabenchores. Beide Brüder verbindet nicht nur der Beruf, sondern auch die Liebe zur Wissenschaft und zur klassischen Musik. «Mittags haben wir bei mir gegessen, abends bei Joseph», erzählt Georg Ratzinger. Das Abspülen danach hätten beide gemeinsam erledigt. Tatsächlich, das bestätigen auch die Leute in Pentling, habe man den Kardinal noch nie in einem Wirtshaus gesehen.
Nein, Georg Ratzinger konnte sich das, was am Dienstag in der Sixtinischen Kapelle geschehen ist, wirklich nicht vorstellen. «Seine Kräfte sind begrenzt», sagte er noch am Sonntag über seinen Bruder in Rom. «Joseph würde gerne auch einmal Literatur oder Geschichte lesen, nicht nur Theologie.»
NZZ-Kommentar: Keine «Verlegenheitslösung» nach oben
In bemerkenswert kurzer Zeit hat die katholische Kirche das Interregnum an ihrer Spitze beendet und einen neuen Papst gekürt. Vier Wahlgänge - das deutet nicht auf ein gespaltenes, durch den Tod des Charismatikers Johannes Paul II. verunsichertes Wahlgremium hin, das sich erst nach langem Ringen auf einen neuen Pontifex einigen konnte. Die wahlberechtigten Kardinäle haben Benedikt XVI. den Makel erspart, eine nach qualvoller Suche gefundene «Verlegenheitslösung», bloss ein «Kompromisskandidat», gewesen zu sein. Joseph Ratzinger kann sein schwieriges Amt mit der Gewissheit antreten, dass ihm eine grosse Mehrheit der Kardinäle wohlgesinnt ist. Zumindest von dieser Seite werden ihm wenig Widerstände erwachsen, im Gegensatz etwa zum kalten Wind, der ihm von katholischer Seite aus seiner ursprünglichen Heimat entgegenweht.
Ratzinger mag keine «Verlegenheitslösung» sein. Aber entspricht die Wahl auch einem mutigen, vorwärts weisenden Entscheid? Benedikt XVI. ist am 16. April 78 Jahre alt geworden; ein ebenso langes Pontifikat, wie es seinem Vorgänger beschieden war, darf er nicht erwarten - es sei denn, die Natur begünstige ihn in aussergewöhnlicher Weise. Die Wahl Ratzingers steht wohl für ein eher kurzes Pontifikat, das den Kardinälen Zeit lässt, sich in aller Ruhe Gedanken über eine langfristige Regelung der Kirchenführung zu machen.
Zum andern ist damit zu rechnen, dass Ratzinger als Benedikt XVI. die Akzente zumindest in der Glaubenslehre nicht anders setzen wird, als er sie als Präfekt der Glaubenskongregation gesetzt hatte: als standfester Verteidiger der Orthodoxie. Ihn zeichnet aus, was er in der Messe für die Wahl des neuen Papstes keinesfalls als rigorosen Fundamentalismus gelten lassen wollte: ein fester Glaube, der sich durch keine der zahlreichen «Ismen» der Moderne, nicht einmal durch den Liberalismus, beirren lässt.
Solche Standfestigkeit mag auch Kardinäle aus der Dritten Welt bewogen haben, Ratzinger ihre Stimme zu geben, sehen sie ihre Teilkirchen doch einer immer stärkeren Konkurrenz durch Sekten und charismatische Heiler aller Art ausgesetzt. Ein klares Glaubenslehre-Profil des Papstes kann ihnen in dieser Auseinandersetzung nur behilflich sein. Sie haben zwar noch keinen der Ihren mit der Führung der Kirche betrauen können, aber die Zeiten, da fast automatisch ein Italiener zum Papst erkoren wurde, sind nun wohl endgültig vorbei.
Mit der Wahl des deutschen Kurienkardinals Ratzinger zum Papst hat das Kardinalskollegium auch dem verstorbenen Pontifex seine Reverenz erwiesen. Es entschied sich dafür, einen der engsten Mitarbeiter von Johannes Paul II. zu dessen Nachfolger zu bestimmen. Nichts deutet darauf hin, dass Benedikt XVI. aus dem Schatten seines Vorgängers heraustreten und in der Lehre gänzlich neue Pfade beschreiten möchte. Dass er nicht dasselbe Flair für fernsehgerechte Massenauftritte besitzt, hat seine Wähler offensichtlich nicht abgeschreckt. Zumindest in dieser Hinsicht ist Ratzinger kein «Klon» Johannes Pauls II.
ach.
2) General Motors in miserabler Verfassung
(NZZ 20.4.)
Rückzug der Ertragsprognose für 2005
Cls. New York, 19. April
General Motors Corp. (GM) hat für das erste Quartal einen Reinverlust von 1,1 Mrd. $ oder $ 1.95 je Aktie ausgewiesen, verglichen mit einem Gewinn von 1,21 Mrd. $ oder $ 2.12 im gleichen Vorjahresabschnitt. Dies ist der erste Verlust seit dem dritten Quartal 2002 und der höchste seit Anfang 1992. GM hatte Mitte März einen Fehlbetrag in dieser Grössenordnung in Aussicht gestellt. Damals wurde die Gewinnprognose für das ganze Jahr 2005 von ursprünglich 4 $ bis 5 $ auf 1 $ bis 2 $ revidiert. Diese Voraussage nahm GM jetzt ersatzlos zurück. Entscheidende Faktoren seien so ungewiss, hiess es, dass weder für das zweite Quartal noch für das ganze Jahr eine Prognose gestellt werden könne. Die Börse reagierte negativ auf die Kunde, der Kurs fiel am Dienstagmorgen um über 4%.
Ein Plan für Nordamerika
Der Quartalsumsatz schrumpfte um 4,3% auf 45,77 (i. V. 47,83) Mrd. $. In Nordamerika ging das Geschäftsvolumen um 12,7% auf 25,4 Mrd. $ zurück, während es in Europa um 6,7% auf 8,0 Mrd. $ expandierte. Die wesentlichen Probleme von GM liegen in Nordamerika. Auf diesem wichtigsten Markt gingen die Autoverkäufe im Berichtsquartal um 5,1% zurück, und der Marktanteil fiel auf 25,2%, von 26,3% im Vorjahr. Das Ziel von 29,0% wurde damit bei weitem verfehlt. Mit der neuen Produktelinie ist GM auf wenig Anklang gestossen, und preislich kann die Nummer eins mit den Japanern, die den Grossteil ihres Nordamerika-Absatzes in den USA produzieren, nicht Schritt halten. CEO Rick Wagoner hat unlängst die Verantwortung für Nordamerika persönlich übernommen. Man habe «gut ausgedachte Pläne» für eine Sanierung des Geschäftes, meinte Wagoner am Dienstag, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen. Im Urteil von Branchenanalytikern kommt GM nicht darum herum, von der Autogewerkschaft namhafte Konzessionen zu erwirken, namentlich was die hohen Gesundheitskosten und die Regelungen für Betriebsschliessungen angeht. GM hat im Berichtsquartal die Produktion um 12% zurückgefahren. Laut Experten müsste die Produktionskapazität um 1 Mio. Fahrzeuge reduziert werden.
Negativer Cashflow
Im Ergebnis eingeschlossen sind netto 265 Mio. $ an Sonderbelastungen, vorwiegend für die Restrukturierung in Europa. Auf bereinigter Basis betrug das Defizit im Autogeschäft 1,83 Mrd. $, verglichen mit einem Gewinn im Vorjahr von 444 Mio. $. Die Finanztochter GMAC schrieb einen Gewinn von 728 (i. V. 764) Mio. $. Im nordamerikanischen Autogeschäft verlor GM 1,34 (+0,40) Mrd. $. In Europa konnte der Verlust leicht auf 103 (116) Mio. $ reduziert werden. Im asiatisch-pazifischen Raum wurde ein Gewinn von 60 (275) Mio. $ erzielt, in Lateinamerika/
Afrika ein solcher von 46 (1) Mio. $. Der operative Cashflow im Autogeschäft war mit 3,0 Mrd. $ negativ, die Restrukturierungskosten in Europa sowie die Verpflichtung gegenüber Fiat infolge der Auflösung der Partnerschaft in Höhe von 2 Mrd. $ nicht inbegriffen. Die Liquidität wurde per Ende März noch mit 19,8 Mrd. $ ausgewiesen, verglichen mit 23,3 Mrd. $ Ende Dezember. Die miserable Finanzlage hat Befürchtungen aufkommen lassen, dass die Rating-Agenturen eine weitere Rückstufung auf «Junk»-Status vornehmen könnten. GM hat rund 300 Mrd. $ an Schulden ausstehend. Die Finanzierungskosten haben sich im ersten Quartal auf 460 Basispunkte über 10-jährigen Schatzpapieren verteuert, von 220 Basispunkten vor einem Jahr.
dazu:
GM streicht die Gewinnprognose (HB 20.4.)
Milliardenverlust im Kerngeschäft
Gesundheitskosten belasten den weltgrößten Autokonzern
HANDELSBLATT, 20.4.2005
hz/je FRANKFURT. Der weltgrößte Automobilhersteller General Motors (GM) steckt tiefer in der Krise als erwartet. Nach einem Milliardenverlust im ersten Quartal wagte der US-Konzern gestern wegen zahlreicher Unsicherheiten keine Gewinnprognose mehr für das laufende Jahr. Bereits Mitte März hatte das Unternehmen seine Prognose stark reduziert. Allein im Kerngeschäft verlor der Autobauer in den ersten drei Monaten des Jahres 1,98 Mrd. Dollar.
Wie schon zuvor war es allein der Finanztochter GMAC zu verdanken, dass der Verlust nicht noch höher ausfiel. Die hoch profitable Finanzsparte drückte mit einem Quartalsgewinn von 728 Mill. Dollar das Minus im Konzern auf etwa 1,1 Mrd. Dollar. Das ist der höchste Fehlbetrag in einem Quartal seit 1992. Damals stand das Unternehmen kurz vor dem Konkurs.
Der gestern vorgestellte Quartalsbericht legt das ganze Ausmaß der Misere offen und dämpfte zugleich Hoffnungen auf eine baldige Erholung. Auto-Analyst John Casesa von der US-Bank Merrill Lynch bezeichnete die aktuellen Nachrichten als „Hiobsbotschaft“ und empfahl die GM-Aktie zum Verkauf. Das Papier verlor gestern deutlich an Wert.
Auch GM-Anleihen gaben nach. Experten halten inzwischen eine Herabstufung von GM-Anleihen auf einen Ramsch-Status noch im Laufe des Sommers für unausweichlich. Senken die Agenturen den Daumen, würde dies die Anleihemärkte erschüttern und GM bei der Refinanzierung weitere Milliarden kosten. Mit ausstehenden Anleihen im Nominalwert von 113 Mrd. Dollar ist GM einer der größten Schuldner von Unternehmensanleihen weltweit. Die Märkte handeln GM-Anleihen nur noch mit hohen Risikoprämien.
Analysten bewerteten die GM-Zahlen als schlechtes Omen für den Konkurrenten Ford, der heute Einzelheiten zur künftigen Ausrichtung ankündigen will. Nach GM hatte auch der zweitgrößte US-Autobauer Anfang April die Märkte mit einer Gewinnwarnung geschockt und seine Prognose für 2005 deutlich gesenkt.
Die Situation von GM und Ford hat sich seit Jahresanfang deutlich verschlechtert, weil der Absatz beider Konzerne auf dem Heimatmarkt massive zurückgeht. Wachsende Konkurrenz, insbesondere durch asiatische Hersteller, sowie steigende Treibstoffpreise fordern ihren Tribut, vor allem bei den Sprit fressenden Pick-ups und Geländewagen, mit denen die US-Hersteller bisher noch die besten Margen verdient haben.
„Das Ergebnis in Nordamerika ist enttäuschend“, räumte GM-Chef Rick Wagoner gestern ein. „Wir müssen die Umsätze erhöhen und die Kostenseite verbessern. Allerdings brauche der Konzern dringend eine Begrenzung der Gesundheitskosten. Sie sind für die US-Autokonzerne zu einer Belastung geworden. Wagoners Hoffnungen, deutliche Entlastungen durchzusetzen, scheiterten bislang am Widerstand der Automobilbauer-Gewerkschaft UAW.
Sie ist bislang auch nicht bereit, den vor zwei Jahren vereinbarten Tarifvertrag zu ändern. Die bis 2007 gültige Vereinbarung mit der UAW sieht für 2005 und 2006 Lohnsteigerungen zwischen zwei und drei Prozent vor. Zudem macht sie Werksschließungen unattraktiv, da GM für die unbeschäftigten Arbeiter mindestens ein Jahr lang fast den vollen Lohn und alle Sozialkosten weiterzahlen muss.
3) Pessimistische Stimmung unter Fondsmanagern (NZZ 20.4.)
nach oben
Umschichtungen in defensive Aktien
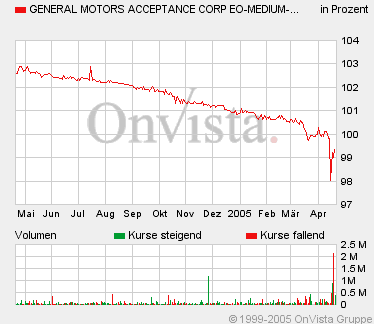 mkr. An den Finanzmärkten macht sich allmählich eine pessimistische Stimmung breit. Die Anfang April von Merrill Lynch befragten Fondsmanager äusserten sich skeptisch zur Entwicklung der Weltwirtschaft. Sie positionierten sich auf dem Wirtschaftszyklus ungefähr zwischen der mittleren und der späten Phase. Falls sich die Einschätzungen in der bisherigen Geschwindigkeit entwickeln, wird die Phase der Rezession innert Jahresfrist erreicht sein. In diesem Umfeld dürften vor allem zyklische Aktien einen schweren Stand haben. Einige Fondsmanager haben bereits reagiert und Aktien aus zyklischen Branchen wie Energie oder Industrie in defensive Sektoren wie Konsumgüter oder Pharma umgeschichtet.
mkr. An den Finanzmärkten macht sich allmählich eine pessimistische Stimmung breit. Die Anfang April von Merrill Lynch befragten Fondsmanager äusserten sich skeptisch zur Entwicklung der Weltwirtschaft. Sie positionierten sich auf dem Wirtschaftszyklus ungefähr zwischen der mittleren und der späten Phase. Falls sich die Einschätzungen in der bisherigen Geschwindigkeit entwickeln, wird die Phase der Rezession innert Jahresfrist erreicht sein. In diesem Umfeld dürften vor allem zyklische Aktien einen schweren Stand haben. Einige Fondsmanager haben bereits reagiert und Aktien aus zyklischen Branchen wie Energie oder Industrie in defensive Sektoren wie Konsumgüter oder Pharma umgeschichtet.
Doch nicht nur das rückläufige Wachstum bereitet Sorgen, sondern auch die Tatsache, dass die Gewinnmargen der Unternehmen schrumpfen könnten. Dies liegt unter anderem an den steigenden Faktorkosten, welche die Firmen im zurzeit kompetitiven Umfeld nicht an die Kunden weiterreichen können. Ausserdem vergeht einer wachsenden Zahl von Fondsmanagern der Risikoappetit. Netto bezeichnete ungefähr ein Fünftel dieser Investoren seine Risikobereitschaft als unterdurchschnittlich und zog die Konsequenzen. Die verwalteten Gelder werden zusehends aus riskanten Anlageklassen wie Aktien oder unsicheren Regionen gewisser Schwellenländer abgezogen und am Geldmarkt parkiert.
In einer Spezialfrage äusserten sich die Fondsmanager zu möglichen Auswirkungen, falls die chinesische Zentralbank den Yuan um 10% aufwerten sollte. Netto fanden rund 40% der Investoren, dies würde auf die Kurse amerikanischer Staatsanleihen drücken. Zum einen ginge die Nachfrage nach Dollars, woran der Yuan gebunden ist, und mithin nach «Treasuries» zurück; zum andern entwertete eine aus dem boomenden China importierte Inflation die Staatspapiere. Dagegen könnten die Aktien amerikanischer Exportunternehmen von einer stärkeren chinesischen Währung profitieren, weil diese Firmen ihre Güter und Dienstleistungen in China zu geringeren Preisen anbieten können.
Beigefügt links oben der Einjahres-, unten der
Dreijahres-Chart einer beispielhaft ausgewählten General Motors - Anleihe mit
einem Couponzins von 5,5%:
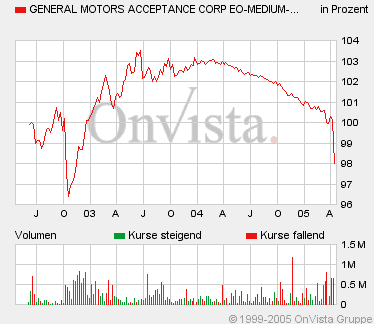
4) Der Deutsche Joseph Ratzinger (HB 20.4.)
nach oben
ist neuer Papst Benedikt XVI. Weißer Rauch schon am zweiten Tag des Konklaves
Köhler und Schröder gratulieren
HANDELSBLATT, 20.4.2005
HB ROM. Die 115 in Rom versammelten Kardinäle haben schon am zweiten Tag des Konklaves den deutschen Kardinal Joseph Ratzinger zum neuen Papst gewählt. Er erhielt die erforderliche Zweidrittelmehrheit, also mindestens 77 Stimmen. Als Nachfolger des verstorbenen Johannes Paul II. trägt der 78-Jährige den Namen Benedikt XVI. Zehntausende Gläubige jubelten dem neuen Papst auf dem Petersplatz zu. Er ist jetzt das Oberhaupt von weltweit 1,1 Milliarden Katholiken.
Vom Balkon des Petersdoms winkte Ratzinger der Menge zu und erteilte ihr seinen ersten Segen als Papst. „Liebe Brüder und Schwestern. Nach dem großen Papst Johannes Paul II. haben die Kardinäle mich gewählt, einen einfachen, bescheidenen Arbeiter im Weinberg des Herrn“ , sagte er. Ihn tröste aber die Tatsache, dass Gott auch „mit ungenügenden Werkzeugen“ handeln könne. „Ich vertraue mich euren Gebeten an.“
Zuvor hatte der chilenische Kardinal Jorge Arturo Medina Estévez die Entscheidung des erst am Vorabend begonnenen Konklaves mit den Worten bekannt gegeben: „Habemus Papam“ (Wir haben einen Papst). Die Kardinäle erzielten offenbar schon im vierten Wahlgang die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Von der Sixtinischen Kapelle des Vatikans stieg gegen 18 Uhr Rauch auf. Allerdings war dessen Farbe erst nach mehreren Minuten eindeutig als weiß erkennbar – das Signal für die Wahl eines Papstes. Anschließend setzten die Glocken des Petersdoms ein. Die auf dem Petersplatz versammelte Menge rief in Sprechchören: „Viva il papa! – Lang lebe der Papst!“
Ratzinger ist der erste deutsche Pontifex seit 480 Jahren (siehe „Die deutschen Pontifikate“). Als Kardinaldekan leitete er nach dem Tod Johannes Paul II. die katholische Kirche und saß dem Konklave vor. Ratzinger war als einer von mehreren Favoriten ins Konklave gezogen. Der Sohn eines Gendarmeriemeisters aus Marktl am Inn hatte schon als Junge den Wunsch, Kardinal zu werden. Nach dem Theologie- und Philosophiestudium wurde er 1951 zum Priester geweiht. Mit erst 30 Jahren habilitierte er sich und wurde Dogmatik-Professor an der Freisinger Hochschule. Später lehrte er in Bonn, Münster, Tübingen und Regensburg. 1977 wurde er zum Erzbischof von München und Freising berufen, wenig später zum Kardinal. Der entscheidende Karrieresprung gelang Ratzinger 1981, als Papst Johannes Paul II. ihn zum Präfekten der Glaubenskongregation berief.
Der neue Papst Benedikt XVI. gilt als streng konservativer Theologe. Zu Beginn des Konklaves hatte er die Kardinäle aufgerufen, das konservative Vermächtnis Johannes Paul II. zu bewahren. In der Eröffnungsmesse hatte Ratzinger gesagt, der künftige Pontifex müsse zum Auftakt des dritten christlichen Jahrtausends die Kirchendoktrin verteidigen und Modernisierungsbestrebungen eine Absage erteilen.
Bundespräsident Horst Köhler gratulierte dem neuen Papst. Köhler betonte, an Benedikt XVI. würden große Erwartungen geknüpft. „Und ich bin sicher, dass er diesen Erwartungen auf ganz besondere Weise mit Klugheit und Glaubensfestigkeit begegnen wird.“ Bundeskanzler Gerhard Schröder begrüßte die Wahl Ratzingers zum neuen Papst als Ehre und Freude für Deutschland. „Ich gratuliere ihm im Namen der Bundesregierung und aller Bürger seines Heimatlandes“, sagte der Kanzler. Ratzinger sei ein weltweit geachteter Theologe, der die Weltkirche wie kaum ein anderer kenne. Er freue sich darauf, Papst Benedikt XVI. anlässlich des Weltjugendtages im August in Köln begrüßen zu können.
Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel würdigte die Wahl Ratzingers zum neuen Papst als „historisch. „Dass ein Deutscher zum Papst gewählt wurde, ist ein Moment des Stolzes. Es ist eine Ehre“, sagte sie. FDP-Chef Guido Westerwelle wünschte dem neuen Kirchenoberhaupt neben Kraft, Weisheit und Gesundheit auch „das notwendige Maß an gesellschaftlicher Aufgeschlossenheit“. Die Grünen-Vorsitzende Claudia Roth erhofft sich nach der Papstwahl eine Öffnung der Kirche. Sie wünsche sich „einen Papst, der den Willen hat, Reformen durchzusetzen und die Kirche zu öffnen“, sagte sie.
Reformkräfte der katholischen Kirche in Deutschland und evangelische Kirchenführer zeigten sich enttäuscht von der Papstwahl. Sie äußerten Skepsis, ob es innerkirchliche Reformen und Fortschritte in der Ökumene geben werde. Der evangelische Landesbischof Ulrich Fischer sagte in Freiburg: „So glücklich sind wir über die Wahl nicht.“ Ratzinger habe als Leiter der Glaubenskongregation dem ökumenischen Gedanken keine Chance gegeben.
dazu:
Die deutschen Pontifikate
In der Kirchengeschichte hat es bisher sieben deutsche Päpste gegeben.
Gregor V. (996-999). bereits als 24-Jähriger bestieg der Sohn Herzog Ottos von Kärnten und Urenkel Ottos des Großen als Gregor V. den Stuhl Petri.
Clemens II. (1046-1047). Vorher Suidger, aus sächsischem Adel, wurde vergiftet und starb am 9. Oktober 1047.
Damasus II. (17. Juli - 9. August 1048). Sein Pontifikat ist eines der kürzesten der Geschichte, nur 23 Tage – er starb wahrscheinlich an Malaria.
Leo IX. (1049-1054). Heilig gesprochen. In sein Pontifikat fiel die endgültige Trennung Roms von Konstantinopel (1054).
Viktor II. (1055-1057). Der letzte deutsche Bischof auf dem Papstthron.
Stephan IX. (1057 - 1058). Friedrich, Sohn Gozelos I., Herzogs von Lothringen. Setzte sich für Kirchenreformen ein.
Hadrian VI. (1522- 1523). Stammt aus Utrecht, das damals zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gehörte. Er ist der letzte Papst, der sich selber als Deutschen betrachtete, und der letzte nicht-italienische Papst bis zur Wahl des Polen Karol Wojtyla 1978.
5) Datenschützer greift Regierung an (HB 20.4.)
nach oben
Bundesbeauftragter für Datenschutz wirft Rot-Grün mangelnden Respekt vor den Rechten der Bürger vor
RÜDIGER SCHEIDGES
HANDELSBLATT, 20.4.2005
BERLIN. In seinem ersten Tätigkeitsbericht hat der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Peter Schaar, gestern schweres Geschütz gegen die Bundesregierung aufgefahren. In wesentlichen Bereichen ihrer Politik nehme die rot-grüne Regierung den Datenschutz „nicht ernst genug“. Schaar kritisierte die mangelnde Beachtung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung des Bürgers. Die Behörden überwachten stetig mehr Telefone und griffen öfter auf Kontodaten zu. Zudem seien eine Vorratsspeicherung von Internetdaten und ein besserer Einblick in die Verhältnisse von Arbeitslosen geplant.
„Gerade die Kontenabfrage macht deutlich, wie staatliche Stellen zunehmend Zugriff auf Datenbestände der privaten Wirtschaft nehmen“, kritisierte Schaar. Er halte es auch für „sehr bedenklich“, wie hier die Eingriffsbefugnisse der Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden durch das Telekommunikationsgesetz drastisch ausgenutzt würden: „2004 wurden in fast drei Millionen Fällen Daten von Telekommunikationskunden bei der Regulierungsbehörde nachgefragt. Diese hat daraufhin zehn Millionen Abfragen bei Unternehmen gestellt“, kritisierte Schaar die Ausdehnung der Abfragemöglichkeiten.
Eindringlich appellierte Schaar an die Bundesregierung, nicht wie geplant schon 2005 biometrische Merkmale wie den digitalen Fingerabdruck oder das digitale Bild für Pässe einzuführen. „Eine unausgereifte Technik und unsichere Verfahren“ dürften nicht neue Gefahren bringen. So befürchtet Schaar die „heimliche Überwachung der Einzelnen durch den Staat“. Es frage sich, ob die Eile nicht kontraproduktiv sei, Kernfragen seien bislang nicht geklärt. Schaar plädierte für ein Moratorium, da auch die EU eine Einführung biometrischer Merkmale erst für Mitte 2006 fordere.
In seinem 245 Seiten langen Bericht kritisiert Schaar massiv die geplante Vorratsspeicherung von Telekommunikationsdaten für 12 bis 18 Monate. „ Das betrifft jeden Bürger, unabhängig davon , ob er eine Straftat begangen hat oder nicht.“ Als Alternative empfahl er das US-Vorgehen, „Quick Freeze“ genannt: Die Provider werden dazu verpflichtet, die Kommunikationsdaten 90 Tage nicht zu löschen. Herausgegeben werden sie indes nur in den von den Strafverfolgungsbehörden begründeten Einzelfällen. Es sei nicht nachvollziehbar, warum ausgerechnet deutsche Sicherheitsbehörden darauf angewiesen seien, Provider zu Hilfssheriffs zu machen. Schaar setzt bei diesen auf EU-Ebene, aber auch von Innenminister Otto Schily (SPD) betriebenen Pläne jetzt auf den Deutschen Bundestag, von dem er ein Veto erhofft.
In der Kontroverse um die Nutzung des menschlichen Genoms durch die DNA-Analyse bei Kriminalfällen rät Schaar zu größter Vorsicht. Die gesellschaftlichen Umwälzungen durch die DNA-Analyse als „Fingerabdruck des 21. Jahrhunderts“ kündige sich bereits in der Debatte um die Zulässigkeit heimlicher Vaterschaftstests an. Vor allem werde die Frage drängend, ob das Persönlichkeitsrecht noch bewahrt werden könne. Schaar hält es jedoch für unnötig, vor dem Abgleich von DNA in Tatortspuren die Zustimmung eines Richters einzuholen, wenn die Polizei noch keinen Hinweis auf den Täter hat.
Schaar drängte darüber hinaus auf eine zügige Überprüfung der neuen Befugnisse von Sicherheitsbehörden seit den Anschlägen in New York und Washington im September 2001. Der Gesetzgeber müsse nun seiner Verpflichtung nachkommen und bewerten, welche dieser Eingriffsrechte wirklich mehr Sicherheit bringen und welche das Selbstbestimmungsrecht der Bürger nutzlos einschränken. „Hier stellt sich die Frage nach dem verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.“ Im Grundsatz, so das Fazit Schaars, sei bei den Sicherheitsgesetzen „leider auch der Datenschutz ins Visier geraten und eingeschränkt worden“.
6) Neue Hartz-IV-Regeln stärken Arbeitsanreize nur wenig (HB
20.4.)
nach oben
Institut sieht geplante Zuverdienstregeln skeptisch – Kabinett berät Paket für ältere Arbeitslose
HANDELSBLATT, 20.4.2005
asr/dc BERLIN/DÜSSELDORF. Nach Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft schafft die geplante Neuregelung der Hinzuverdienstmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose keine nennenswerten Anreize, einen Job anzunehmen. Nach wie vor schmälere zusätzliches Einkommen das Arbeitslosengeld II (ALG II) sehr deutlich. „Die Grenzbelastung bleibt fast unverändert hoch“, sagte der Kieler Finanzwissenschaftler Alfred Boss dem Handelsblatt.
Die Grenzbelastung gilt als ökonomisch zentrales Kriterium für den Arbeitsanreiz. Es gibt an, wie viel Geld ALG-II-Beziehern unterm Strich von einem zusätzlich mit Arbeit verdienten Euro bleibt. Die geplante Reform werde die Regeln klar vereinfachen und das verfügbare Einkommen der Betroffenen leicht erhöhen, sagte Boss. Letzteres führe beim Staat zu Mehrausgaben.
Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD) hatte sich mit dem CDU-Arbeitsmarktexperten Karl-Josef Laumann am Freitag auf Eckpunkte für eine Lockerung der Hinzuverdienstregeln geeinigt. Danach werden die bisherigen Absetzbeträge etwa für Werbungskosten durch einen allgemeinen Grundfreibetrag von 100 Euro ersetzt. Jenseits davon soll es zusätzliche prozentuale Freibeträge geben: 20 Prozent bis zu einem Bruttoeinkommen von 800 Euro und zehn Prozent für Einkommen darüber. Die Freibeträge sind bei 1 500 Euro gedeckelt.
Nach den Kieler Berechnungen sinkt die Grenzbelastung eines Ledigen mit 200 Euro Bruttolohn als Zuverdienst von heute 87,3 auf 84 Prozent; bei 1 000 Euro Bruttolohn sinkt sie von 92 auf 91,7 Prozent. Verdient ein Langzeitarbeitsloser 500 Euro brutto, würde sich die Grenzbelastung sogar von heute 81,2 auf 83,5 Prozent erhöhen. Damit blieben die eigentlich als Hilfslösung gedachten Ein-Euro-Jobs für viele Langzeitarbeitslose attraktiver als marktübliche Niedriglohnjobs, betonte Boss. So verfüge ein Ein-Euro-Jobber, der 30 Stunden pro Woche für zwei Euro Stundenlohn arbeite, über 926 Euro netto, da er keine Abzüge von seinem ALG II hinnehmen müsse. Für das gleiche Gesamteinkommen müsste der Langzeitarbeitslose auf dem regulären Arbeitsmarkt rund 1 000 Euro hinzuverdienen.
Nach den Plänen der Regierung sollen die neuen Zuverdienstregeln durch die Koalitionsfraktionen auf den Gesetzgebungsweg gebracht werden. Sie könnten dann an ein Änderungsgesetz zum Dritten Sozialgesetzbuch angekoppelt werden, mit dem sich heute das Bundeskabinett befasst. Dieses wiederum ist die Basis eines Pakets, mit dem Rot-Grün vor allem die Beschäftigungschancen Älterer verbessern will.
Dabei soll etwa die so genannte Entgeltsicherung um zwei Jahre verlängert werden, die derzeit bis Ende 2005 befristet ist. Danach erhalten ältere Arbeitslose einen Lohn-Zuschlag der Arbeitsagentur, wenn sie nach dem Verlust ihrer früheren Stelle zügig einen niedriger entlohnten Job annehmen. Auch das Instrument der Ich-AG soll mit dem Gesetz bis Ende 2007 verlängert werden. Ähnliches gilt für die Regelung, wonach Arbeitgeber ältere Arbeitnehmer immer wieder von neuem befristet beschäftigen dürfen. Das Paket soll die einzelnen Instrumente übersichtlicher machen und Skepsis der Unternehmen gegenüber älteren Bewerbern abbauen. Bei der Verbreitung der Informationen will die Regierung die Wirtschaftsverbände einbinden. „Wir müssen gemeinsam deutlich machen, dass es keine Hürden für Neueinstellungen Älterer mehr gibt“, sagte SPD-Arbeitsmarktexperte Klaus Brandner.
Durch einen Pakt mit den Ländern will Minister Clement zudem 50 000 geförderte Zusatzjobs speziell für Langzeitarbeitslose über 58 Jahren schaffen. Diese Ein-Euro-Jobs sollen anders als üblich nicht nur sechs Monate laufen, sondern bis zu drei Jahre und damit einen „aktiven“ Übergang zur Rente ermöglichen. Neben der Bundesagentur für Arbeit (BA) sollen die Länder einen Teil der Finanzierung beisteuern. Als Vorbild dient Clement dabei ein bereits laufendes Programm in Sachsen-Anhalt. Inwieweit sich die anderen Länder gewinnen lassen, blieb gestern nach einem Bund-Länder-Gespräch offen. Das Geld des Bundes soll nicht zusätzlich bereit gestellt werden, sondern aus nicht genutzten Mitteln des BA-Etats fließen.
Das gilt auch für einen weiteren Pakt, mit dem Clement 50 besonders erfolgversprechende regionale Projekte zur Eingliederung älterer Arbeitsloser mit je fünf Mill. Euro fördern will. Auch dieses Vorhaben bedarf aber noch der Abstimmung mit den Ländern: Sie wollen die Verteilung des Geldes nicht allein dem Bundesminister überlassen und fordern eine starke Mitsprache.
7) Volkswirte nehmen Rückgang des ZEW-Indexes gelassen (HB
20.4.)
nach oben
Dresdner Bank erwartet in diesem Jahr einen Anstieg der Investitionen
HANDELSBLATT, 20.4.2005
mak/pbs FRANKFURT/DÜSSELDORF. Die Zahl der optimistischen Analysten hat im April deutlich abgenommen. Das signalisiert der Einbruch des ZEW-Indexes zu den Konjunkturerwartung von Finanzmarktprofis. Damit ist eine Beschleunigung des Wachstums in Deutschland nicht in Sicht.
Der von den Finanzmärkten viel beachtete ZEW-Index fiel von 36,3 Punkten im März auf 20,1 Zähler im April. Im Vorfeld der Veröffentlichung befragte Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Rückgang auf 30,5 Zähler gerechnet. Der Index basiert auf einer Umfrage des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) unter 311 Finanzmarktexperten.
Nur noch 27,9 Prozent der Befragten erwarten, dass sich die gesamtwirtschaftliche Situation in den kommenden sechs Monaten verbessern wird. Im März waren es noch 40,8 Prozent. Die Zahl der Pessimisten ist leicht von 4,5 auf 7,8 Prozent gestiegen. Die meisten ehemaligen Optimisten sind in das mit 64,3 Prozent große Lager derjenigen gewechselt, die keine Veränderung der Situation erwarten. Das erklärt, warum Ökonomen – die oft selbst die Fragebögen des ZEW ausfüllen – den Rückgang des Indexes gelassen nehmen: „Der Indikator enthält keine neuen Informationen zum Stand der wirtschaftlichen Aktivität“, sagt Matthias Rubisch, Ökonom bei der Commerzbank.
Volkswirte erwarten nach einem wachstumsstarken ersten Quartal mit einem realen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um rund 0,5 Prozent gegenüber dem Schlussquartal 2004 ohnehin eine Abschwächung des Wachstums. Rubisch rechnet für das zweite Quartal mit rund 0,3 Prozent Wachstum. Holger Schmieding von der Bank of America schließt sogar eine Stagnation nicht aus.
Das passt zur Botschaft des ZEW-Indexes: Er liegt nun wieder deutlich unter seinem historischen Mittelwert von 34,4 Punkten und signalisiert damit in den kommenden sechs Monaten „eine leichte Abschwächung der Konjunkturerholung“, schreibt das ZEW. Werte über dem langfristigen Durchschnitt zeigen eine Beschleunigung des Wachstums. Der Index läuft der Entwicklung der Industrieproduktion etwa fünf Monate voraus, sagt Volker Kleff, Volkswirt beim ZEW.
Ursache für die Stimmungsverschlechterung ist für das ZEW der „enttäuschende Auftragseingang“. Die Industrieproduktion war im Februar um 2,2 Prozent gegenüber Januar gesunken – die Aufträge der Branche waren im gleichen Zeitraum um 2,6 Prozent eingebrochen.
Aus Sicht von ZEW-Präsident Wolfgang Franz sind die „mageren Ergebnisse des Jobgipfels, die anschließend wieder teilweise zerredet werden“, auch nicht gerade geeignet, die Stimmung zu verbessern. „Ohne eine Fortsetzung des Reformkurses wird sich das Vertrauen in eine nachhaltige Konjunkturerholung nicht einstellen“, sagte der Wirtschaftsweise.
Auf Grund der allgemein schwachen Entwicklung revidierten gestern die Volkswirte der Dresdner Bank ihre Wachstumsprognose für Deutschland von 1,4 auf 0,8 Prozent nach unten. Chefvolkswirt Michael Heise begründete dies mit dem unerwartet starken Ölpreisanstieg. „Außerdem haben wir die kurzfristigen Auswirkungen von Hartz IV unterschätzt“, sagte Heise. Die Reform habe die Konsumstimmung beeinträchtigt. Trotzdem gibt sich Heise verhalten optimistisch: „Wir sehen die Wirtschaft vor einer neuen Konjunkturerholung.“ Seine Zuversicht basiert auf Fortschritten bei den Unternehmen. Diese hätten bereits 2004 höhere Gewinne erzielt. Von ihrem Tief im Jahr 2002 seien die Sachkapitalrenditen wieder gestiegen; die Unternehmens- und Vermögenseinkommen der Kapitalgesellschaften dürften auch in diesem Jahr weiter zulegen. Die Konsolidierung der Unternehmensbilanzen sei praktisch abgeschlossen. Heise erwartet, dass die realen Ausrüstungsinvestitionen in diesem Jahr um vier Prozent zulegen werden. Deutschland liege aber sowohl mit seinen Direktinvestitionen im Ausland als auch mit den ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland international im Mittelfeld. Die bisherige Zurückhaltung der Unternehmen begründet Heise mit ungünstigen Absatzerwartungen der Firmen.
8) Attacken gegen das Kapital rütteln die Basis auf (HB 20.4.)
nach oben
SPD verzeichnet Mobilisierungseffekt im NRW-Wahlkampf
Meinungsforscher halten rot-grüne Mehrheit gleichwohl für unwahrscheinlich
KARL DOEMENS, THOMAS SIGMUND
HANDELSBLATT, 20.4.2005
BERLIN. Mit seiner massiven Kapitalismuskritik hat SPD-Chef Franz Müntefering nicht nur die Partei vorübergehend geeint. Die Attacke scheint auch die Basis aufzurütteln. Mitglieder der Parteispitze berichten von überwiegend positiven Reaktionen auch im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf. „Das Thema kommt bei den Leuten an“, sagte SPD-Landeschef Harald Schartau dem Handelsblatt. Von einem „Mobilisierungseffekt“ sprach auch der aus Düsseldorf stammende Vizevorsitzende der Bundestagsfraktion, Michael Müller. Meinungsforscher werteten den Vorstoß gegen die „totale Ökonomisierung“ der Gesellschaft als „gelungenen Beitrag zur Mitgliederpflege“.
Bislang freilich schlägt sich Münteferings Kritik an „bestimmten Finanz-Unternehmen“, die mit ihren Profit-Maximierungsstrategien die Demokratie gefährdeten, nicht positiv in den Erhebungen der Demoskopen nieder. Nach einer Umfrage von Infratest-dimap in den vergangenen beiden Wochen büßte die SPD an Rhein und Ruhr einen Punkt auf 35 Prozent ein, während die CDU stabil bei 45 Prozent blieb. Die CDU baute damit ihren Vorsprung auf die regierende SPD wieder auf zehn Punkte aus. Die Grünen verlieren einen Punkt, die FDP bleibt konstant bei 7 Prozent (siehe „CDU liegt weit vorne“)
Ob die SPD den Vorsprung noch aufholen kann, ist unter Parteienexperten umstritten. Einig ist man sich lediglich darin, dass die Wirtschaftskritik Münteferings mobilisierend wirke. Laut Infratest-Geschäftsführer Reinhard Schlinkert war es für die SPD dringend notwendig, in ihrem Kern-Kompetenzgebiet der sozialen Gerechtigkeit ein Zeichen zu setzen. Ulrich Eith, Parteienforscher aus Freiburg, nannte die Äußerungen Münteferings „ein probates Mittel, um die unteren Mittelschichten, die traditionell SPD wählen, wieder zurück zu gewinnen.“ Müntefering beschreite allerdings auch einen gefährlichen Weg, da er die Wähler der „Neuen Mitte“ durchaus abschrecken könne, sagte Eith.
Dieses Risiko hält der nordrhein-westfälische Landeschef Schartau für eher gering. Nach seinen Erfahrungen wird die „Kritik am reinen Shareholder-Value-Prinzip“ auch von vielen Mittelständlern und Familienunternehmern geteilt: „Die Thesen von Müntefering finden einen breiten Resonanzboden“, behauptet er. Auch der Berliner Fraktionsvize Gernot Erler glaubt, der Parteichef habe ein weit verbreitetes Gefühl aufgegriffen: Bei „vielen Mitgliedern“ und in „breiten Teilen der Gesellschaft“ herrsche regelrechte „Wut“ darüber, dass Unternehmen und Verbände die derzeitige Wirtschaftsflaute „weit über das rationale Maß ausnutzen“, um immer neue Forderungen zu formulieren, ohne für die Beschäftigten eine Gegenleistung zu bringen.
Jedenfalls ist es Müntefering gelungen, alle Flügel der Partei hinter sich zu scharen. In der gestrigen Fraktionssitzung erhielt er für seine Rede spontanen Beifall. Nicht nur Vertreter der Parlamentarischen Linken wie Müller und Erler stärkten ihm in den vergangenen Tagen den Rücken. Die entfachte Debatte sei „wichtig und unverzichtbar“, sagte auch Klaas Hübner, der Sprecher des rechten „Seeheimer“-Kreises. Thüringens SPD-Chef Christoph Matschie stellte sich als Vertreter der pragmatischen „Netzwerker“ hinter Müntefering: Der Parteichef habe gerade den Menschen aus den neuen Bundesländern aus dem Herzen gesprochen.
In dieser Situation mochte auch Wirtschaftsminister Wolfgang Clement, der sich lange einer Äußerung enthalten hatte, nicht abseits stehen. Müntefering habe auf tatsächliche Fehlentwicklungen hingewiesen, sagte sein parteiinterner Gegenspieler in einer Fernseh-Talkshow. Allerdings deutete Clement eine gewisse Distanz an, indem er hinzusetzte, der Parteichef habe sich in seiner „sauerländischen Art drastisch ausgedrückt“. Massive Kritik an Münteferings Vorstoß wurde nur auf der Homepage der Bundes-SPD laut. Im Forum meldeten sich dort gestern überwiegend verärgerte Bürger zu Wort, die dem „scheinheiligen Franz“ ein „durchsichtiges Ablenkungsmanöver“ und „plumpe Wahlkampfrhetorik“ vorwarfen. Diese Äußerungen seien aber in keiner Weise repräsentativ, hieß es im Willy-Brandt-Haus.
Trotz des großen Vorsprungs der CDU ist die die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen nach Meinung der Demoskopen noch nicht entschieden. „Die SPD kann aus der Defensive heraus, die eigene wahlmüde Klientel mobilisieren“, sagte Eith. Die CDU habe ihr Potenzial schon sehr stark ausgenutzt, Umfragen würden daher auch schiefe Bilder liefern. Schlinkert bezeichnete es dagegen als kaum wahrscheinlich, dass Rot-Grün den Rückstand noch aufholen kann. „Wenn weltbewegende Ereignisse jetzt noch eintreten, dann kann sich alles nochmal ändern.“ Unter normalen Umständen sei allerdings nicht damit zu rechnen, sagte Schlinkert.
9) Schwarze Zahlen bei den Sozialkassen (HB 20.4.)
nach oben
HANDELSBLATT, 20.4.2005
pt BERLIN. Die gesetzliche Sozialversicherung hat das vergangene Jahr mit einem Überschuss von insgesamt 2,1 Mrd. Euro abgeschlossen. Dies teilte das Statistische Bundesamt mit. Im Jahr zuvor hatten die Sozialkassen noch mit einem Minus von sechs Mrd. Euro abgeschlossen. Verantwortlich für die positive Entwicklung 2004 seien vor allem die gesetzlichen Krankenkassen. Sie hätten als einzige der klassischen Sozialversicherungszweige einen Überschuss erzielt, so die Statistiker.
Grund dafür ist die 2004 in Kraft getretene Gesundheitsreform. Sie führte dazu, dass die Kassen ihr Defizit von 2,9 Mrd. Euro im Jahr 2003 in einen Überschuss von vier Milliarden Euro verkehren konnten. Das Defizit der Rentenversicherung hat sich 2004 gegenüber 2003 auf 1,4 Mrd. Euro fast halbiert. Diese Entwicklung gehe allerdings vor allem auf den Verkauf der Beteiligungen an der Wohnungsgesellschaft Gagfah für 2,1 Mrd. Euro zurück, schreibt das Bundesamt.
Die gesetzliche Pflegeversicherung schloss 2004 mit einem Defizit von knapp 0,8 Mrd. Euro ab. Bei der Bundesagentur für Arbeit lag das Defizit bei 4,2 Mrd. Euro nach 6,2 Mrd. Euro im Vorjahr. Es wurde vom Bund mit einem entsprechenden Zuschuss ausgeglichen, so dass es nicht zum Gesamtdefizit der Sozialversicherung beitrug.
Insgesamt beliefen sich die Ausgaben der Sozialversicherung auf 466,1 Mrd. Euro und waren damit 1,3 Prozent niedriger als noch 2003. Die Einnahmen gingen mit 468 Mrd. Euro um 0,3 Prozent zurück. Die Ausgaben der Krankenkassen sanken um 3,5 Prozent auf 138,9 Mrd. Euro. Die Einnahmen stiegen um 1,4 Prozent auf 142,8 Mrd. Euro. Bei der Pflegeversicherung stagnierten die Einnahmen bei 16,9 Mrd. Euro, während die Ausgaben sich um 0,7 Prozent auf 17,6 Mrd. Euro erhöhten. Die Bundesagentur konnte durch Kürzungen bei der Arbeitsmarktförderung ihre Ausgaben um 4,2 Prozent auf 54,5 Mrd. Euro senken. Die Einnahmen gingen um 0,6 Prozent auf 50,3 Mrd. Euro zurück.
10) Investitionen sinken im Osten auf Rekordtief (HB 20.4.)
nach oben
Städtetag beklagt schlechte Finanzlage der Kommunen
HANDELSBLATT, 20.4.2005
ap GERA. Die Investitionen der ostdeutschen Städte sind auf ein Rekordtief gesunken. Angesichts der kritischen Finanzlage dürften die Ostkommunen in diesen Jahr lediglich 4,4 Mrd. Euro investieren, sagte Städtetagsvizepräsident Peter Röhlinger auf einer Konferenz in Gera. Das wäre der niedrigste Stand seit der Wiedervereinigung 1990, sagte der FDP-Politiker und Jenaer Oberbürgermeister.
An der Konferenz in Ostthüringen nahmen auf Einladung des Deutschen Städtetags die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte in den neuen Bundesländern teil. Röhlinger betonte, die kommunalen Investitionen in Ostdeutschland seien bereits 2004 gegenüber dem Vorjahr um 7,1 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro gesunken. Dass dieser Rückgang etwas geringer ausfiel als im Bundesdurchschnitt, liege nur daran, dass im vergangenen Jahr vor allem in Sachsen noch erhebliche Mittel zur Beseitigung der Flutschäden aus dem Jahr 2002 aufgewendet worden seien. „Ohne diesen Sondereffekt lägen die Investitionen der ostdeutschen Kommunen nur noch bei 40 Prozent des Niveaus von 1992“, sagte Röhlinger.
Trotz einer positiven Entwicklung vor allem bei der Gewerbesteuer betrügen die Steuereinnahmen der ostdeutschen Städte und Gemeinden pro Einwohner immer noch nur 46 Prozent des Westniveaus. Röhlinger kritisierte, damit blieben die ostdeutschen Städte und Gemeinden weiter in hohem Maße abhängig von staatlichen Zuweisungen, die die Länder aber im vorigen Jahr um fast 300 Mill. Euro gekürzt hätten. Die Ausgaben dieser Städte seien um 1,6 Prozent zurückgegangen.
Der Hauptgeschäftsführer des Städtetages, Stephan Articus, sagte „die Reduzierung des Finanzierungsdefizits der Städte in den neuen Ländern konnte nur durch einen weiteren Personalabbau sowie durch weitere schmerzhafte Kürzungen bei den kommunalen Investitionen erkauft werden“.
11) China führt Afrikas Neu-Entdeckung an (HB 20.4.)
nach oben
Asiens und Afrikas Staatschefs beleben die Süd-Süd-Kooperation – Kontinente ergänzen sich wirtschaftlich
W. DRECHSLER, O. MÜLLER
HANDELSBLATT, 20.4.2005
KAPSTADT/NEU DELHI. Spitzenpolitiker aus über achtzig afrikanischen und asiatischen Ländern treffen sich ab morgen in Jakarta, um eine Brücke zwischen beiden Kontinenten zu schlagen und eine neue Süd-Süd-Kooperation zu begründen. Wirtschaftlich hat Chinas Aufschwung längst eine engere Kooperation zwischen Afrika und Asien angeschoben. Politisch steht die Zusammenarbeit noch ganz am Anfang. Sie bekommt durch das von Indien, China, Brasilien und Südafrika angeführte Erstarken der großen Schwellenländer (G20) bei den Welthandelsgesprächen aber immer mehr Bedeutung.
Historisch knüpft die zweite Asien-Afrika-Konferenz in der indonesischen Hauptstadt an den legendären Bandung-Gipfel vor 50 Jahren an, der zur Geburtsstunde der Blockfreien-Bewegung wurde. Damals hatten sich in Bandung Staatsmänner wie Chou Enlai, Jawarhalal Nehru, Ho Chi Minh und Gamal Abdel Nasser getroffen und nach einem „dritten Weg“ zwischen US-Kapitalismus und Sowjet-Sozialismus gesucht. Aufbruchstimmung markierte diese erste internationale Konferenz von Entwicklungsländern, die gerade der Kolonialzeit entronnen waren. Inzwischen ist der Kalte Krieg vom Krieg gegen den Terror abgelöst worden; der von hehren Prinzipien geprägte „Geist von Bandung“ ist längst verflogen. Die größte Aufmerksamkeit bei dem Folge-Gipfel erhält bezeichnenderweise der Streit zwischen Japan und China unter dem Vorzeichen neu aufflammenden Nationalismus (siehe Kasten).
Ein Ziel der Konferenz ist die Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen beiden Kontinenten. Zwar hat sich die Entwicklungskluft zwischen Asien und Afrika in den vergangenen 50 Jahren stark vergrößert. Aber das hohe Wachstum in Fernost hat neue Kooperationschancen eröffnet (siehe Grafik). Bereits 13 Prozent aller afrikanischen Exporte gehen nach Asien. Treibende Kraft hinter dem aufblühenden Handel ist Chinas Heißhunger auf Rohstoffe. Das Gesamtvolumen des chinesisch-afrikanischen Handels steigt seit 2001 jedes Jahr um mehr als 30 Prozent – und wird jetzt auf fast 30 Mrd. $ geschätzt.
Bei Investitionen auf dem Kontinent hinkt China noch zurück. Doch beobachtet die Weltbank seit 2000 auch hier einen phänomenalen Anstieg. „In fünf Jahren könnte China zu den drei größten Investoren des Kontinents zählen“, sagt Iraj Abedian, ein südafrikanischer Wirtschaftsexperte. „China braucht Rohstoffe aus Afrika und Afrika braucht billige Fertigwaren aus China“, ergänzt der chinesische Geschäftsmann Hansen Luo, der seit acht Jahren eine Mine in Südafrika betreibt, „das ist eine ideale Kombination“.
Neben China sucht jetzt aber auch Indien fieberhaft nach Ressourcen in Afrika, um seinen explodierenden Energiehunger zu stillen – oft in direkter Konkurrenz zu China. Auch Indiens staatliche Energiekonzerne kennen keine Berührungsängste mit autoritären Regimen, die in der Kritik des Westens stehen. Und selbst das rohstoffarme Japan bekundet Interesse an verstärkter Energiekooperation mit afrikanischen Ländern.
China hat bei der Jagd nach Öl und Gas jedoch die Nase vorn und bezieht inzwischen rund 25 Prozent seiner Ölimporte aus Afrika. Im Gegenzug erhalten seine Staatsfirmen in Bürgerkriegsländern wie dem Sudan Großaufträge zum Bau von Pipelines und anderen Öleinrichtungen.
Jetzt gehen die Geschäfte aber auch über Energie hinaus: Ein chinesischer Telefonkonzern erhielt kürzlich den Zuschlag zur Wartung der Mobilfunknetze in Kenia, Simbabwe und Nigeria. Simbabwes bankrottes Regime kauft bei der Volksrepublik sechs Kampfflugzeuge im Wert von 120 Mill. $.
Gleichzeitig nehmen Firmen aus asiatischen Schwellenländern im Zuge ihrer Internationalisierung-Strategien verstärkt Afrikas weniger anspruchsvolle Konsumenten ins Visier. Die Spanne reicht von chinesischen Hausgeräteherstellern wie Haier bis zu indischen Autobauern wie Mahindra und Tata. Sogar die ersten indischen IT-Dienstleister haben Filialen in Südafrika eröffnet.
12) FBI besorgt über Extremisten im eigenen Land (HB 20.4.)
nach oben
US-Terrorabwehr warnt vor weißen Rassisten, Antisemiten und radikalen Umweltschützern – Bündnis mit Islamisten befürchtet
HANDELSBLATT, 20.4.2005
bac WASHINGTON. Zehn Jahre nach dem Bombenanschlag von Oklahoma warnen amerikanische Sicherheitsbehörden vor einer unverändert hohen Terror-Gefahr durch extremistische Gruppen aus dem eigenen Land. „Wir gehen täglich einer Vielzahl von Attentats-Drohungen nach“, sagte John Lewis, stellvertretender Chef der Abteilung Gegenspionage bei der Bundespolizei FBI. Seine Behörde habe sich zwar in den letzten Jahren auf ausländische Terroristen konzentriert, halte jedoch die inneramerikanische Extremisten-Szene weiterhin für einen beträchtlichen Risiko-Faktor.
Die US-Bürger gedachten gestern des Bombenanschlags vom 19. April 1995 auf ein mehrstöckiges Bundesgebäude in Oklahoma. Urheber war der Armee-Veteran Timothy McVeigh, der aus Hass gegen die Regierung die Tat beging, bei der 168 Menschen getötet wurden. Es handelte sich damals um den bis dato schlimmsten Terrorakt auf amerikanischem Boden, der bei vielen Amerikanern ein tiefes Gefühl der Verwundbarkeit hinterließ.
Experten befürchten derzeit jedoch weniger die Gefahr durch paramilitärische Milizen, die Mitte der 90er Jahre für Aufsehen gesorgt hatten. Im Blickpunkt stehen vielmehr rassistische und antisemitische „Hassgruppen“. Deren Zahl habe von knapp 500 im Jahr 1997 auf 762 im vergangenen Jahr zugenommen, berichtete das Southern Poverty Law Center, eine Anwaltsfirma in Montgomery (Alabama). Eine interne Studie des Ministeriums für Heimatschutz listet radikale Öko-Gruppen und Tierschützer als die höchsten Terror-Gefahren auf. Die Gruppe „Earth Liberation Front“ hatte sich in den vergangenen zwei Jahren zu Brandanschlägen auf ein Immobilien-Projekt im kalifornischen San Diego sowie auf ein Ski-Hotel in Colorado bekannt, bei denen Schäden in Höhe von 70 Mill. Dollar entstanden.
Terror-Spezialisten und Polizisten sind vor allem mit Blick auf Einzeltäter alarmiert, die sich mit extremistischen Gruppen verbünden könnten. Sie verweisen dabei auf Beispiele wie Eric Rudolph, der in der vergangenen Woche zugegeben hatte, mehrere Anschläge auf Abtreibungskliniken sowie die Olympischen Spiele in Atlanta 1996 begangen zu haben. 2003 verhafteten Sicherheitsbehörden den weißen Rassisten William Krar in Texas. In Krars Wohnung wurden 500 000 Schuss Munition, 60 Rohrbomben sowie Bestände von Sodiumzyanid entdeckt, die ausgereicht hätten, 6000 Menschen zu töten.
In den USA operieren nach einem Geheimbericht des FBI 22 einheimische Terrorgruppen. In dem Report, der vom Fernsehsender ABC veröffentlicht wurde, werden auch weiße Rassisten wie die „Aryan Nations“ oder die Neonazi-Organisation „National Alliance“ aufgeführt. Insgesamt liefen 338 Ermittlungsverfahren. Die Gruppen würden für Bombenanschläge, Drohbriefe, Morde und Raubdelikte verantwortlich gemacht, hieß es in dem Dossier. „Das sind tickende Zeitbomben, die eine größere Zerstörung anrichten können als Timothy McVeigh vor zehn Jahren“, sagte Brian Levin von der California State University in San Bernardino. Nach Ansicht von Experten könnte es jedoch noch schlimmer kommen: „Wenn rechtsradikale Milizen ein Zweckbündnis mit islamischen Extremisten schließen, haben wir ein Albtraum-Szenario“, warnt der Strafrechtler Robert Friedmann von der Georgia State University.
13) VERANTWORTUNG DER WIRTSCHAFT: Jobs und Moral (HB 20.4.)
nach oben
Von TORSTEN RIECKE
Bundeskanzler Schröder nennt sie schlicht und verletzend „unpatriotisch“. Gemeint sind jene deutschen Unternehmer, die trotz mehr als fünf Millionen Arbeitslosen in Deutschland Jobs ins Ausland verlagern.
Der Kanzler greift mit seinem feinen Gespür ein verbreitetes Unbehagen auf: Ist es nicht Ausdruck „totaler Ökonomisierung“ (Müntefering), wenn die Unternehmen Rekordgewinne melden, zu Hause aber Stellen streichen und neue Fabriken in Bratislava oder im indischen Bangalore bauen? Das widerspricht auf den ersten Blick nicht nur dem deutschen Sinn für soziale Gerechtigkeit, sondern auch der Pflicht, das Land aus der Krise zu führen. Doch bei genauer Betrachtung überwiegen die ökonomischen und moralischen Argumente für das Outsourcing: Viele Verlagerungen dienen dem Gemeinwohl.
Der Streit darüber ist keineswegs auf Deutschland beschränkt. In Amerika wurde das Thema zum Wahlkampfschlager. Ähnlich wie Schröder verglich der demokratische Präsidentschaftskandidat John Kerry die Global Player mit „vaterlandslosen Gesellen“. Anders als bei uns wird der gesellschaftspolitische Streit jenseits des Atlantiks jedoch von einer ernst-haften ökonomischen Debatte begleitet, ohne die eine moralische Bewertung von Jobverlagerungen schlicht unmöglich ist.
Zunächst muss man mit dem scheinbaren Widerspruch von Rekordgewinnen und Jobverlagerungen aufräumen: Nur weil deutsche Unternehmen in den vergangenen Jahren massiv ihre Produktion in Billiglohnländer verlagert haben, können sie heute glänzende Bilanzen präsentieren. Deutschland ist nur deshalb Exportweltmeister, weil die Firmen viele Vorprodukte in Osteuropa oder Asien fertigen lassen und so auf den Weltmärkten konkurrenzfähig bleiben. Wer also den Erfolg von „made in Germany“ feiert, sollte nicht über Vaterlandsverräter in den Chefetagen maulen.
Damit ist die ökonomische Antwort auf die moralische Frage nach dem Für und Wider des Outsourcings keineswegs erschöpft. Die Entscheidung über eine Verlagerung von Arbeitsplätzen muss der Unternehmer nach Kosten-, Konkurrenz- und Marktgesichtspunkten treffen. Ein staatlicher Eingriff in diese unternehmerische Freiheit wäre das Ende der Marktwirtschaft. Wem dieses Argument zu engstirnig ökonomisch und zu wenig moralisch erscheint, der muss die Frage nach der Qualität der Lebensbedingungen in staatlich gelenkten Volkswirtschaften beantworten.
Nicht viel besser ist es, den internationalen Austausch von Gütern, Kapital und Arbeitsplätzen durch Handelsbarrieren einzuschränken. In keinem einzigen Fall ist es bislang hoch entwickelten Industrieländern gelungen, den Niedergang bestimmter Branchen durch Protektionismus zu verhindern. Weder die Landwirtschaft noch die Textilindustrie, noch der Bergbau haben dem Druck des globalen Wettbewerbs standgehalten. Die Anpassung wurde nur verzögert und damit der Aufbau neuer Industriezweige und neuer Arbeitsplätze. Wer heute also den Arbeitnehmern vorgaukelt, ein staatlicher Schutzschild könne ihre Jobs dauerhaft erhalten, verspielt seine moralische Autorität.
Der entscheidende Gradmesser für die moralische Bewertung der Jobverlagerungen ist jedoch, ob sie dem Gemeinwohl dienen oder nicht. Studien vom Institute for International Economics (IIE) in Washington und der Unternehmensberatung McKinsey zeigen, dass der Nutzen des Outsourcings die Kosten deutlich überwiegt. So erhält Amerika für jeden Dollar, den es durch Jobverlagerungen ins Ausland verliert, zwischen 1,12 und 1,14 Dollar zurück: sei es in Form von billigeren Importen, höheren Profiten und Dividenden oder neuen Absatzmärkten für US-Produkte. Nach Berechnungen der IIE-Ökonomin Catherine Mann hat das Outsourcing wesentlich zum Produktivitätsschub in den USA in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre beigetragen.
Die Kosten-Nutzen-Rechnung für Deutschland fällt nicht so positiv aus, weil die deutschen Arbeitnehmer es auf Grund eines starren Arbeitsmarktes schwerer haben, einen neuen Job zu finden. Mit den Worten von Ifo-Chef Hans-Werner Sinn: „Die von ausländischer Konkurrenz verdrängten Industriearbeiter werden nicht für höherwertige Stellen freigesetzt, sondern für gar nichts.“ Die Hauptschuld daran tragen nicht die Unternehmer, sondern hat die Arbeitsmarktpolitik.
Outsourcing ist also kein Gegensatz zu einem „modernen Patriotismus“. Staat und Unternehmen sollten allerdings gemeinsam dafür sorgen, dass die von Jobverlagerungen Betroffenen rascher als heute wieder ein Beschäftigungsverhältnis finden: durch Lohnzuschüsse und eine bessere Aus- und Weiterbildung. Wer legt
in einer internationalen Wirtschaft noch Rechenschaft über sein Wirken ab?
14) München ist für Sandoz erste Wahl (HB 20.4.)
nach oben
Novartis-Tochter will ihre Generika-Zentrale aus Wien verlagern
Zunächst 150 Arbeitsplätze betroffen
CASPAR BUSSE, OLIVER STOCK
HANDELSBLATT, 20.4.2005
WIEN. Die Pharmafirma Sandoz wird ihren Konzernsitz voraussichtlich nach München verlagern. Wie gestern aus Unternehmenskreisen verlautete, wird die Tochterfirma des Schweizer Novartis-Konzerns die endgültige Entscheidung noch im April bekannt geben. Sandoz wollte dazu gestern keinen offiziellen Kommentar abgeben. Auch das bayerische Wirtschaftsministerium, das in die Verhandlungen über den Umzug eingebunden ist, hält sich bedeckt.
Den Informationen zufolge wird Sandoz die Zentrale für das weltweite Geschäft mit der Herstellung und dem Verkauf von Generika-Präparaten von der Wiener Donau-City nach Holzkirchen vor die Tore Münchens verlegen. Hier ist auch die Familienfirma Hexal beheimatet, die Novartis im Februar für 5,65 Mrd. Euro übernommen hatte. Zusammen steigen Sandoz und Hexal zum Weltmarktführer für Generika auf, jenen Nachahmermedikamenten, die nach Ablauf des Patentschutzes günstig hergestellt und angeboten werden können.
Grund für das erwachende Interesse großer Pharmafirmen am Generikasektor ist die Aussicht auf überdurchschnittliche Wachstumsraten. Sandoz-Chef Andreas Rummelt verweist auf Schätzungen, wonach sich der Weltmarkt für Generika von derzeit etwa 58 Mrd. Dollar bis Ende des Jahrzehnts auf 100 Mrd. Dollar nahezu verdoppeln wird.
Anders als Novartis bringen die meisten etablierten Pharmariesen jedoch wenig Erfahrung in diesem Geschäft mit, das durch relativ intensiven Preiswettbewerb und kurze Produktzyklen geprägt ist. Die Renditen sind meist deutlich niedriger als im innovativen Pharmageschäft. In Europa wurde die Generikabranche im vergangenen Jahr zudem auch von staatlichen Preisrestriktionen beeinträchtigt. Etliche große Generikahersteller holen aus dem operativen Geschäft nur einen bescheidenen freien Cashflow heraus.
Die deutsche Sandoz-Tochter hat bereits ihren Konzernsitz in München. Zudem sind die zwei Produktionsstätten des Konzerns im österreichischen Tirol, wo insgesamt 2 500 Mitarbeiter vor allem Antibiotika herstellen, von der bayerischen Landeshauptstadt leichter zu erreichen, hieß es. Im Standortrennen war zuletzt noch der Sitz der Novartis-Zentrale in Basel.
Betroffen von dem Umzug sind zunächst 115 Verwaltungsmitarbeiter in Wien. Möglicherweise wird mittelfristig auch ein größerer Teil der Forschung verlagert. Das wären dann bis zu 50 zusätzliche Mitarbeiter. Der Umzug ist einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte bei der Konzernbetriebsratssitzung Ende nächster Woche. Vorher will Sandoz keine offizielle Stellungnahme abgeben. „Es ist abzusehen, dass Wien den Standort nicht behält“, hieß es jedoch gestern von möglicherweise betroffenen Mitarbeitern.
Für die bayerische Landesregierung bedeutet die Entscheidung auch einen Prestigeerfolg. Denn schon seit längerem versucht gerade Österreich, deutsche Firmen mit guten Standortbedingungen und günstigen Unternehmensteuern ins Land zu locken. In München wird aber darauf verwiesen, dass Sandoz keine speziellen Subventionen durch den Bund oder die Landesregierung erhält. Dies sei schon aus EU-Wettbewerbsgründen nicht möglich. In Wiener Regierungskreisen ist man da skeptisch. Aus der Landesregierung in München wird denn auch eingeräumt, dass es etwa bei der Höhe der Gewerbesteuer ein Entgegenkommen für Sandoz gegeben haben könnte.
dazu:
SANDOZ - Alpen-Transfer (HB 20.4.)
nach oben
Der Erfolg, den Bayern mit der Verlegung der Sandoz-Konzernzentrale von Österreich vor die Tore Münchens demnächst verbuchen kann, tut Not. Denn die Bayern haben in den vergangenen Wochen gerade gegenüber dem Nachbarn in Österreich Federn lassen müssen.
Infineon kündigte an, sein Stammwerk in München zu schließen und will dafür Ende dieser Woche seine Europazentrale neu im österreichischen Kärnten eröffnen. Walter Bau aus Augsburg stellte Insolvenzantrag und wurde so ein günstiges Kaufobjekt für den Strabag-Konzern des österreichischen Bauunternehmers Hans Peter Haselsteiner. Der Modekonzern Escada verlegt sein Logistikzentrum von München nach Reichersberg in Oberösterreich. Bayerns Vorzeigeunternehmen BMW baut sein Motorenwerk in Steyr aus. Die staatliche Betriebsansiedlungsgesellschaft Austrian Business Agency meldet unterm Strich einen noch nie da gewesenen Ansturm deutscher Firmen. Offenbar sind nicht nur die osteuropäischen EU-Beitrittsländer eine Konkurrenz für Deutschland, sondern auch Österreich hat als Unternehmensstandort dank günstiger Steuersätze inzwischen die Nase vorn. Sandoz dürfte nun das angeschlagene Selbstvertrauen der bayrischen Wirtschaftsförderer wieder ein wenig stärken.
Doch die Deutschen werden weiter um jede Ansiedlung ringen müssen. Denn die Investitionsanreize anderswo sind stark. Die Regierung in Wien wirbt vor allem mit der jüngst beschlossenen Senkung der Körperschaftsteuer. Der Steuersatz für Kapitalgesellschaften liegt in Österreich auf dem Niveau von Tschechien und Slowenien. Solange Berlin hier nicht gleichzieht, werden Erfolge wie der der Bayern eine Ausnahme bleiben. oli
dazu:
„Das bessere Bayern ist Österreich mit Sicherheit nicht“ (HB 20.4.)
nach oben
HANDELSBLATT, 20.4.2005
cbu MÜNCHEN. Seit zwei Jahren wirbt Österreich massiv um deutsche Unternehmen. „Kommt nach Österreich und investiert hier“, forderte etwa Wiens Finanzminister Karl-Heinz Grasser kürzlich die Firmenlenker aus dem Nachbarland auf. Österreich habe etwas zu bieten: Zum Jahresanfang trat eine Unternehmenssteuerreform in Kraft. Die Standortbedingungen seien gut.
Doch das will sich Bayerns Wirtschaftsminister Otto Wiesheu (CSU) nicht länger gefallen lassen und geht in die Offensive. In einer Vergleichsstudie hat er die Standorte Österreich und Bayern untersuchen lassen. Das – keineswegs überraschende – Ergebnis der Bayern: Deutschland insgesamt mag zwar schlechtere Standortbedingungen haben, Bayern aber nicht. „Das bessere Bayern ist Österreich mit Sicherheit nicht“, betont Wiesheu.
Beispiel Forschung und Entwicklung: Hier liegt Bayern laut Wiesheu deutlich vorne. Höhere F & E-Ausgaben, mehr Patentanmeldungen, hochqualifiziertes Personal.
Beispiel Produktivität: In Bayern ist laut Wiesheu die Produktivität deutlich höher als im Nachbarland. Zudem habe sich der Abstand zwischen der besten bayerischen und der besten österreichischen Region seit 1995 deutlich vergrößert. Zudem sei die Zahl der Insolvenzen geringer.
Bei Steuern und Abgaben sieht Wiesheu beide Standorte gleichauf, auch wenn es noch erheblichen Handlungsbedarf gebe. In Österreich gebe es zwar keine Gewerbesteuer mehr, dafür aber eine Lohnsummenabgabe, die die Substanz besteuere. Letztlich aber sieht sich Bayern mit Österreich im Kampf gegen die Billiglohnkonkurrenz in einem Boot. Wiesheus Forderung lautet deshalb: „Man soll im Standortwettbewerb die Albernheiten einstellen.“
15) FINANZMÄRKTE: Gesunder Realismus (HB 20.4.)
nach oben
Die Turbulenzen um General Motors haben ein Gutes: Sie führen die Finanzmärkte in die Normalität zurück. Das gilt für die zu hoch bewerteten Unternehmensanleihen genauso wie für die lange Zeit auf den Aktienmärkten herrschende Sorglosigkeit. Für die Firmen verteuern sich durch den neuen Realismus zwar Investitionen, weil Anleger wieder höhere Zinsen verlangen. Doch das ist besser, als wenn Risiken zu lange ausgeblendet werden und es später zu einer harten Landung kommt.
Seitdem der amerikanische Autobauer GM Milliardenverluste einräumen musste, ist die Stimmung umgeschlagen. Anleger verkaufen Aktien und Unternehmensanleihen, weil sie plötzlich überall Risiken sehen. Wegen der Schwierigkeiten eines Herstellers gleich alle Unternehmen in Sippenhaft zu nehmen scheint überzogen, ist aber gerechtfertigt, weil Investoren zu lange Zinsen von weniger als vier Prozent akzeptierten. Das steht in keinem Verhältnis zum Risiko.
GM führt in die Realität zurück. Und die ist keineswegs so rosig, wie es die Euphorie bei Anleihen und die Sorglosigkeit bei Aktien suggerierten. Denn die Wachstumslokomotive USA verliert an Zugkraft. Obendrein schränken das US-Haushaltsdefizit und die Verschuldung der Verbraucher künftige Ausgaben ein. Schließlich wird China nicht immer weiter boomen. All das haben Investoren lange ignoriert.
Die Risiken haben sich nicht über Nacht verschärft. Sie sind nur wieder ins Bewusstsein gerückt. Das ist keine Gefahr für Konjunktur und Finanzmärkte, sondern gesunder Realismus. Wenn dabei Kredite angemessen verzinst werden, nutzt das nicht nur den Geldgebern. Auch die Firmen profitieren langfristig: Wenn keine unangemessen niedrigen Zinsen locken, werden sie nicht mehr leichtfertig am Markt vorbei investieren. som
16) SPD: Ute in Absurdistan (HB 20.4.)
nach oben
Der sozialdemokratische Angriff gegen das Kapital nimmt absurde Züge an. Gestern hat die stellvertretende SPD-Chefin Ute Vogt den Vogel abgeschossen mit ihrer Aufforderung an die Konsumenten, jene Unternehmen zu meiden, die Arbeitsplätze in Deutschland abbauen. Da hätte Frau Vogt auch gleich sagen können: Leute, geht nicht mehr zu Karstadt! Eröffnet bitte kein Konto mehr bei der Deutschen Bank! Und schafft euch auch keinen Porsche Cayenne mehr an, denn der wird ja zum großen Teil im Ausland gefertigt! Dass solche Aufrufe nicht sehr patriotisch klingen, haben die Sozialdemokraten immerhin noch gemerkt und ihre baden-württembergische Spitzenfrau eiligst wieder eingefangen.
Der Vorgang zeigt, wie schnell die emotionale Kampagne gegen die Unternehmer außer Kontrolle geraten kann. An der ökonomischen Realität in unserem Land läuft sie sowieso total vorbei. Der globalisierte deutsche Konsument schert sich schon lange nicht mehr darum, ob seine Produktwahl der Beschäftigung in unserem Land nützt. Jüngster Beweis dafür sind die gestrigen Erfolgsmeldungen von Toyota. Obwohl der japanische Konzern in Deutschland keine Autos baut, verkauft er hier mehr davon als je zuvor. Offenkundig überzeugen die Asiaten ihre deutsche Kundschaft mit einem relativ besseren Preis-Leistungsverhältnis.
Was einmal mehr zeigt, dass nicht der Kampf gegen das Kapital dem deutschen Standort nützt, sondern der Kampf um niedrigere Kosten und um mehr Qualität. Dazu gehört eine vernünftige Wirtschaftspolitik, die Arbeitskosten senkt und Innovationen fördert. Doch diese Wahrheit will die SPD ihrer Gefolgschaft in Wahlkampfzeiten nicht mehr zumuten und setzt stattdessen auf Stammtischparolen. rut
17) Götterdämmerung über Washington (HB 20.4.)
nach oben
Amerika fürchtet den Tag X: Der Tod eines Supreme-Court-Richters könnte in den USA einen Kulturkampf auslösen. Innenansichten des mächtigsten Gerichts der Welt.
CHRISTOPH NESSHÖVER,
WASHINGTON
HANDELSBLATT, 20.4.2005
So logieren nur Götter. Die Vorhalle ist groß wie eine Kirche. Der Fußboden ist aus Marmor, die Wände sind aus Marmor, die Säulen davor sind aus Marmor. Das Weiß des edlen Steins kneift in den Augen. Der majestätische Hall verleitet zu ehrfürchtigem Flüstern.
Im Arbeitszimmer der Götter da-hinter: noch mehr Marmor. Der schwarze am Boden stammt aus Marokko, der weiße der Säulen aus Italien, der rote aus Spanien. Die neun Stühle der Götter und ihr langer Tisch auf dem Podium sind aus Mahagoni. Ehe Amerikas Oberste Richter auf ihren Thronen Platz nehmen, schreiten sie zwischen acht Meter langen Samtvorhängen hindurch.
Marmor ist für die Ewigkeit. Die Götter in diesem Tempel aber sind sterblich. 70,7 Jahre alt im Schnitt sind die auf Lebenszeit ernannten sieben Männer und zwei Frauen im US Supreme Court, dem Obersten Gericht Amerikas. Heute feiert ihr Senior, John Paul Stevens, seinen 85. Geburtstag. Präsident Gerald Ford ernannte ihn zum Verfassungsrichter. Das war 1975.
Mit jedem Geburtstag der betagten Richter-Götter, mit jedem Gerücht über eine Grippe im weißen Tempel an der First Street gleich hinter der Kuppel des Kapitols rückt die verbissene Schlacht um Amerikas Seele näher. Der Kampf um die Neubesetzung eines oder mehrerer Posten des vielleicht mächtigsten Gerichts der Welt dürfte in den USA einen Kulturkampf auslösen.
Der Ewigkeit am nächsten steht wohl William H. Rehnquist, 81. Seit Oktober ward der Vorsitzende Rich-ter nur einmal gesehen im Marmor-palast zu Washington, D.C.: Schild-drüsenkrebs. Bei seinem einzigen öffentlichen Auftritt, als er Präsident George W. Bush am 20. Januar den Amtseid abnahm, steckte über dem Kragen seiner schwarzen Robe eine Kanüle in seinem Hals, die Folge eines Luftröhrenschnitts. Einem solchen unterzog sich auch Papst Johannes Paul II. kurz vor seinem Tod.
Sobald Amerikas Präsident einen Nachfolger für Rehnquist nominiert, hat die Spaltung Amerikas in Konservative und Liberale ein neues Schlachtfeld. Über die Jahrzehnte hat das Gericht mit seinen Urteilen immer wieder die US-Gesellschaft verändert – und gespalten. 1954 verbot es die Rassentrennung an Schulen. 1973 erlaubte es Abtreibungen. Anno 2000 machte es Bush zum Präsidenten, als es die Stimmennachzählungen stoppte.
Und kürzlich verbot es die Exekution Minderjähriger und sprach Guantanamo-Häftlingen das Recht auf Haftprüfung zu. Das Verbrennen der US-Flagge hält es indes für legal: als Ausdruck der Meinungsfreiheit. Der Supreme Court ist so nicht nur die höchste richterliche, sondern auch die höchste moralische Instanz Amerikas – und das macht ihn auch zu einer politischen Machtzentrale.
„Es wird ein riesiger Kampf“, sagt Vicki Saporta in ihrem kleinen Eckbüro in Washington. Die glatten Haare in Pilzkopfform geben ihr etwas Lehrerinnenhaftes. Saporta ist Präsidentin der „National Abortion Federation“ und damit eine der Göttermacher. Denn Abtreibung, „abortion“, gehört zu den umstrittensten sozialen Fragen Amerikas, seit das Oberste Gericht 1973 zur Freude Saportas im Urteil „Roe gegen Wade“ Schwangerschaftsabbrüche landesweit legalisierte.
Es war der Beginn einer Art Bürgerkrieg. Ärzte wurden erschossen, Kliniken in Brand gesetzt. Neuerdings weigern sich viele Apotheker, Verhütungsmittel zu verkaufen.
Hauptkampfarena blieb jedoch stets das Gericht. Regelmäßig bringen Abtreibungsgegner neue Fälle in den Marmorhallen zu Washington vor. Den Kern des Urteils von 1973 konnten sie aber nicht kippen.
„Noch haben wir im Obersten Gericht eine Mehrheit von fünf zu vier für ,Roe gegen Wade’“, sagt Vicki Saporta. Und das drohende Tremolo in ihrer Alt-Stimme unterstreicht, dass sie alles dafür tun wird, dass das auch so bleibt.
Weil die Obersten Richter so gespalten sind wie ihr Land, konzentriert sich der Kampf um die Deutungshoheit über das, was „amerikanisch“, was richtig und falsch ist, auf die Neubesetzung ihrer Sessel. „Schon eine einzige Neubesetzung könnte alles kippen“, sagt Saporta. Abtreibung ist eine der wichtigsten Gewissensfragen für Kandidaten, die in den Supreme Court wollen. Bush hat keinen Zweifel gelassen, was für Kandidaten er nominieren wird, wenn ein Richter stirbt oder den Ruhestand wählt: Konservative und Abtreibungsgegner.
Zwar schlägt der US-Präsident die Obersten Richter vor. Bestätigt werden müssen sie aber mit einfacher Mehrheit vom Senat. Was die NAF-Präsidentin sorgt: Präsident Bushs Republikaner haben dort 55 Stimmen – eine klare Mehrheit gegenüber den 44 Demokraten, aber auch eine trügerische.
Der Kampf hat längst begonnen: Es wird gedroht, blockiert und eingeschüchtert. Generalprobe war der Streit um das Leben der Komapatientin Terri Schiavo im März. Nachdem mehrere Gerichte es abgelehnt hatten, Schiavo zwangsweise zu ernähren, und der Supreme Court den Fall gar nicht erst annahm, wetterte Tom DeLay, erzkonservativer Fraktionschef der Republikaner im Repräsentantenhaus, über eine „außer Kontrolle geratene, unverantwortliche Richterschaft. Die Zeit wird kommen, zu der sich die Männer, die dafür verantwortlich sind, für ihr Verhalten werden rechtfertigen müssen.“
Die Bühne für den Kulturkampf werden die öffentlichen Anhörungen der Kandidaten im Senat bieten. Dort läuft das Kräftemessen schon seit drei Jahren. So lange warten sieben Kandidaten Bushs für das Amt eines Bundesrichters, eine Stufe unter Verfassungsrichtern, auf ihre Bestätigung durch das Parlament. Weil den Demokraten Bushs Juristen zu konservativ sind, blockieren sie sie durch Endlosdebatten: das so genannte „Filibuster“.
Dafür lesen Senatoren im Hohen Haus auch mal stundenlang Gedichte von Walt Whitman oder aus dem Lukas-Evangelium vor. Abgewürgt werden kann der Redefluss nur mit einer Mehrheit von 60 Stimmen. So viele brachten die Republikaner bisher aber nie zusammen.
„So zeigen wir, dass wir in der Lage sind, auch einen Kandidaten für das Oberste Gericht zu kippen“, sagt Saporta. Das ist selten, aber nicht unmöglich. 1987 fiel nach einer politischen Schlammschlacht ohnegleichen mit Robert Bork ein Republikaner-Kandidat für das Oberste Gericht im Senat durch.
Sogar auf Überläufer hofft Abtreibungsbefürworterin Saporta: „Einige republikanische Senatoren haben uns versichert, dass sie an einem ,Filibuster’ gegen Supreme-Court-Kandidaten teilnehmen würden, wenn diese gegen das Recht auf Abtreibung sind.“ Das könnte Bush zwingen, einen moderateren Kandidaten vorzuschlagen, hofft sie.
Saportas NAF, die 400 Abtrei-bungskliniken und Tausende Ärzte im ganzen Land vertritt, hat ihre Truppen längst geeint. „Wir haben eine sehr effektive Allianz geschlos-sen mit anderen Gruppen“, sagt sie und meint Umweltbewegung, Bürgerrechtler, Demokraten. Für den Tag X eines Todes oder Rücktritts am Obersten Gerichtshof sei „alles vorbereitet“. „Millionen Dollar“ an Spenden lägen bereit, um TV-Spots gegen unliebsame Kandidaten zu schalten. Freiwillige sparen Urlaubstage an.
Um ihre Macht in Erinnerung zu rufen, ließ Saporta vor einem Jahr eine Millionen Frauen vor dem Kapitol für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch demonstrieren. Die Aktivistin braucht nur den Schlüssel im Zündschloss umzudrehen, und die Maschine läuft an.
Wanda Franz hält den Schlüssel für die Gegenmaschinerie in der Hand. 1973 hörte sie auf dem Weg in die Uni im Autoradio vom Roe-Urteil und war empört. Umgehend gründete sie mit Gleichgesinnten das „National Right to Life Committee“. Heute ist ihr NRLC mit 3 000 Gruppen eine der mächtigsten Anti-Abtreibungslobbys Amerikas.
Die Medizinerin und das NRLC haben gute Jahre hinter sich. Der Kongress, der bis November amtierte, sei im „Kampf für das Leben“ der erfolgreichste der Geschichte gewesen, sagt Franz. „Wir haben dafür gesorgt, dass mehr ,Für-das-Leben’- Kandidaten in den Senat und ins Repräsentantenhaus gewählt wurden“, sagt sie – mit Spenden, TV-Spots und Zehntausenden Stunden freiwilliger Arbeit im Wahlkampf.
Seinen größten Sieg feierte das NRLC im November 2003. Da stand Franz beim Präsidenten, als der ein Gesetz unterzeichnete, das Abtreibungen nach der 13. Schwangerschaftswoche untersagt. In Kraft getreten ist es indes bis heute nicht: Franz’ Erzfeind, Saportas NAF, zog vor ein Bundesgericht und siegte im August 2004.
Ihre mütterliche Stimme wird eiskalt, wenn Wanda Franz über den Supreme Court spricht. „Dieses Gericht maßt sich die Rolle eines Über-Parlaments an“, sagt sie. „Neue Forschungsergebnisse zu den Schmerzen, die ein Fötus bei einer Abtreibung erleidet, nehmen viele Richter nicht zur Kenntnis.“
Im Gegensatz zu Saporta zählt Franz die Mehrheit der Abtreibungs-befürworter im Obersten Gericht auf 6 zu 3. Das liegt daran, dass das Gericht immer wieder über Einzelaspekte der Abtreibungsfrage befand, aber nicht immer mit gleicher Mehrheit entschied. Rechtsprofessoren wie Mark Tushnet vom Georgetown University Law Center in Washington gehen davon aus, dass es mindestens zwei neuer konservativer Richter bedarf, um die Abtreibungsfrage dauerhaft zu kippen.
Franz wird alles tun, um das zu er-reichen, Saporta, um es zu verhindern. Franz’ „Pro-Life Coalition“ umfasst fundamentalistische Christengruppen ebenso wie Republikaner und den einflussreichen Juristenclub „Federalist Society“, der seit Jahren dafür wirkt, erzkonservative Richter nach dem Modell der Supreme-Court-Richter Clarence Thomas und Antonin Scalia auf Richterstühle in ganz Amerika zu hieven.
Der Präsident ein Republikaner, im Parlament republikanische Mehrheiten, todkranke Richter: Ist alles schon entschieden? Sind liberale wie Saporta auf lange Sicht chancenlos? „Nicht unbedingt“, sagt Jura-Professor Mark Tushnet, der kürzlich ein Buch geschrieben hat über das Gericht unter Rehnquist: „Die Politik wird ins Spiel kommen.“
Auch Bush müsse bei seinen No-minierungen Rücksicht nehmen. Stürbe der erste Richter erst 2006, sei der Präsident möglicherweise gezwungen, einen moderaten Kandidaten aufzustellen, um sich eine hässliche Kampagne zu ersparen und nicht als Spalter zu erscheinen. 2006 sind Kongresswahlen. „Aber wenn ich wetten müsste, würde ich darauf setzen, dass der Supreme Court konservativer wird“, sagt Tushnet. Mitentscheidend werde das Kräfteverhältnis in der Abtreibungsdebatte sein.
Und wann geht der Kulturkampf los? Tushnet: „Die große Unbekannte ist die Gesundheit von Richter Stevens. Wenn ein 85-Jähriger einen Schnupfen bekommt, kann das sehr ernst werden.“
Ein wahrhaft ewiges Andenken ist indes nur Vorsitzenden Richtern garantiert. Stirbt Rehnquist, darf seine Büste in die Marmorhalle des Gerichts einziehen – neben die seiner 15 Vorgänger.
18) Zwischen Potenzial und Kostendämpfung (HB 20.4.)
nach oben
Die deutsche Industrie will am erwarteten Wachstum der Gesundheitsbranche teilhaben
PETER THELEN
HANDELSBLATT, 20.4.2005
BERLIN. In der deutschen Politik geht es seit den späten 70er-Jahren vor allem um Kostendämpfung, wenn über den Gesundheitsmarkt geredet wird. Ein Sparprogramm jagt das nächste. Gleichwohl haben sich die Gesundheitsbranchen von Krankenhaus bis Medizintechnik und Biotechnologie in aller Stille zum Wachstumsmotor entwickelt.
Während die Gesamtwirtschaft in den vergangenen zehn Jahren (1992 bis 2003) nur um 28,8 Prozent wuchs, stiegen die Gesundheitsausgaben um 44,6 Prozent und überrundeten andere große Wirtschaftszweige. Mit 4,2 Millionen Beschäftigten in über 800 Berufen sind bereits heute mehr Menschen im Gesundheitswesen beschäftigt als beispielsweise in der Elektroindustrie oder im Maschinenbau.
Mehr als 240 Mrd. Euro werden derzeit jährlich umgesetzt. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt ist in den vergangenen zehn Jahren von knapp über zehn auf über elf Prozent gestiegen. Hinzu kommen die rund 70 Mrd. Euro, die die Bürger inzwischen für Wellness ausgeben – mit steigender Tendenz.
Dieses wachsende Gesundheitsbewusstsein, der immer schnellere medizinisch-technische Fortschritt und die in Zukunft wegen der Alterung der Bevölkerung stark wachsende Nachfrage werden nach Ansicht des Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Jürgen Thumann, dafür sorgen, dass der Gesundheitsmarkt weiter wächst. „Eine lang anhaltende strukturelle Wachstumsphase auf der Grundlage neuer Technologien zeichnet sich ab. Daran sollte die deutsche Gesundheitsindustrie partizipieren“, fordert Thumann im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Wirtschaftsfaktor Gesundheit. Chancen und Potenziale für Deutschland“ hat der BDI deshalb die Veranstaltung genannt, mit der er heute in Berlin dafür werben will, das Gesundheitssystem wachstumsfreundlicher zu gestalten.
Sozialministerin Ulla Schmidt ist als Gastrednerin geladen. Sie sehe das große Wachstumspotenzial, sagte die SPD-Politikerin dem Handelsblatt – und anders als ihre Kritiker ist sie der Meinung, dass die aktuelle Gesundheitspolitik dem auch Rechnung trage.
Dietrich Grönemeyer von der Universität Witten/Herdecke, einer der prominentesten Kritiker der jahrzehntelangen Fixierung der Politik „aufs Kostenreduzieren“, gesteht Schmidt immerhin zu, dass sie mit ihrer jüngsten Reform die bürokratischen Fesseln verringert und durch neue Formen wie der integrierten Versorgung die Grundlage dafür gelegt hat, die wachstumsdämpfenden starren Grenzen zwischen den einzelnen Gesundheitssektoren zu überwinden.
In seinem Buch „Gesundheitswirtschaft, die Zukunft für Deutschland“, outet sich der Anhänger alternativer Heilmethoden als Fan des Zukunftsforschers Leo Nefiodow. Dieser glaubt, dass der Gesundheitsmarkt das Zeug hat, weltweit zum Träger eines lang anhaltenden Wirtschaftsaufschwungs zu werden. Allerdings seien in Deutschland die Wachstumskräfte noch durch das starre Gesundheitssystem und die permanente Sparpolitik gefesselt.
Thumann beklagt vor allem den Bedeutungsverlust der deutschen Pharmaindustrie, die einst Apotheke der Welt genannt wurde. Unter den zehn größten Unternehmen weltweit, so der BDI-Chef, sei heute kein deutsches mehr. Allerdings wächst die Branche nach wie vor. Allein der Export hat sich seit 1992 verdoppelt.
Wie der deutschen Pharmaindustrie laufen auch der hochinnovativen Medizintechnikbranche die Konkurrenten aus den USA und Japan teilweise den Rang ab. Doch auch hier liegen die jährlichen Wachstumsraten mit fünf Prozent weit über dem Durchschnitt der gesamten Wirtschaft.
Anders ergeht es klassischen Anbietern wie den Krankenhäusern und Ärzten. Sie stehen vor einem Konsolidierungsprozess. Zu Recht. Denn hier hat das immer noch überwiegend von den Krankenkassen finanzierte Gesundheitssystem zu Überkapazitäten geführt. Die Weichen wurden gerade erst in Richtung mehr Wettbewerb um Qualität und Effizienz gestellt. Der aber, so Ulla Schmidt, sei für einen erstklassigen Gesundheitsstandort nötig und Voraussetzung dafür, dass er seine Wachstumschancen nutzen könne.
19) Kliniken rüsten sich für Wettbewerb (HB 20.4.)
nach oben
ANNA SLEEGERS
HANDELSBLATT, 20.4.2005
FRANKFURT/M. Gleiches Geld für gleiche Leistung – von diesem Prinzip sind deutsche Krankenhäuser noch weit entfernt. Heute variiert etwa die Vergütung für die operative Entfernung einer Gallenblase nach Angaben des Verbands der Angestellten Krankenkassen zwischen 1 076,80 und 5 922,40 Euro. In einigen Jahren sollen diese Preise vereinheitlicht werden – ein Umbruch, dem die Branche und ihre Zulieferer mit gemischten Gefühlen entgegensehen. Einerseits zwingt er viele Häuser zu schmerzlichen Reorganisationen, um ihre Kostenstruktur konkurrenzfähig zu machen. Andererseits sehen manche Klinikmanager das neue Abrechnungssystem als Chance, weil es den Abschied von der seit 1993 geltenden Budgetdeckelung verspricht.
Vor allem die Hersteller von Medizintechnik warten auf den Nachfrageschub von deutschen Kliniken. Nach Einschätzung des Industrieverbands Spectaris ist in inländischen Krankenhäusern und Arztpraxen ein Investitionsstau von bis zu 15 Mrd. Euro aufgelaufen, weil die Kassen lieber veraltete Geräte reparieren ließen, als neue Technik anzuschaffen.
Dabei rechnen die Krankenhäuser schon seit Anfang 2004 nach den neuen Fallpauschalen ab – zumindest auf dem Papier. Für die tatsächliche Höhe ihres Budgets waren diese Rechenspiele derzeit bislang jedoch unerheblich. Das soll in diesem Jahr anders werden. Zunächst sollen nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums die bislang zwischen jedem Krankenhaus und den Kassen individuell ausgehandelten Preise in den Bundesländern schrittweise auf ein einheitliches Niveau gebracht werden. Ab 2009 sollen nur noch einheitliche Preise gelten und die Budgetobergrenzen wegfallen.
Um sich für das neue System fit zu machen, haben inzwischen private, aber auch städtische Klinikbetreiber Randbereiche wie die Wäscherei und die Küche an externe Dienstleister vergeben. Auch im medizinischen Kerngeschäft passiert einiges: Die Managements des Rhön-Klinikums und des städtischen Klinikums Mannheim etwa vereinbarten mit den Chefärzten ein Ende der Privatliquidation und führte stattdessen leistungsbezogene Vergütungssysteme ein.
20) Hedge-Fonds-Geschäft wird riskanter Experten rechnen mit sinkenden Renditen
(HB 20.4.)
nach oben
Noch verzeichnet die Branche kräftiges Wachstum
UDO RETTBERG
HANDELSBLATT, 20.4.2005
FRANKFURT/M. Die noch junge Branche der Hedge-Fonds wird nach Experteneinschätzung in den nächsten Jahren weiter kräftig zulegen, allerdings schlechtere Anlagerenditen erzielen. Der wichtigste Grund dafür ist, dass die Hedge-Fonds Opfer ihres bisherigen Erfolgs werden. Denn die Manager dieser weitgehend unregulierten Kapitalsammelstellen nutzen Schwachstellen an den Märkten aus. Damit können sie bei steigenden oder fallenden Kursen Gewinne erzielen. Die Vielzahl der Hedge-Fonds hat nach dieser Argumentation nun die Märkte so effektiv gemacht, dass die Arbitragestrategien immer weniger Rendite abwerfen. Hinzu kommt, dass die Kosten für diese Produkte zunehmen. In Deutschland sind Hedge-Fonds seit dem vergangenen Jahr zugelassen.
In der Finanzwelt galten Hedge-Fonds viele Jahre lang als Geheimtipp, was angesichts der Wertentwicklung dieser Investmentvehikel nicht überraschte. Während des Zeitraums von 1985 bis 2000 hatten findige Fondsmanager mit teilweise komplexen Strategien im Durchschnitt Renditen zwischen 13 und 15 Prozent pro Jahr erwirtschaftet. Der von CSFB-Tremont errechnete Hedge-Fonds-Index ist seit dem Start 1994 im Schnitt um 10,81 Prozent pro Jahr gestiegen. Seit dem Jahr 2000 kam es allerdings zu herben Enttäuschungen; denn die Ergebnissteigerungen lagen nur noch im einstelligen Prozentbereich.
Zwar werden die Zahl der Hedge-Fonds und das von ihnen verwaltete Vermögen in den nächsten Jahren weiter kräftig steigen, wie etwa die Experten von Pictet & Cie. vorhersagen (siehe „Hedge-Fonds legen weltweit zu“). Die Anleger müssen sich aber mit geringeren Erträgen zufrieden geben. Lars Jaeger von der Partners Group warnt vor überzogenen Erwartungen. „Wir haben nicht viel Hoffnung, dass das Alpha wieder größer wird“, sagt Jaeger. Unter „Alpha“ versteht man jenen Teil des Anlage-Ergebnisses, der über die Marktrendite hinausgeht und vom Fachwissen des Fonds-Managers abhängig ist. Jaeger rechnet jedoch damit, dass Hedge-Fonds auch in den kommenden Jahren im Durchschnitt Renditen von über acht Prozent abwerfen, was sie nicht zuletzt für Versicherungen und Pensionskassen interessant mache.
Ein weiterer Grund für sinkende Ertragserwartungen sind steigende Kosten. Experten erwarten, dass die Branche stärker institutionalisiert wird. Das Geld privater und institutioneller Anleger werde nicht mehr so stark in einzelne Hedge-Fonds, sondern in die als weniger riskant geltenden Hedge-Fonds-Dachfonds oder aber in Produkte fließen, die auf Strategien der Branche basieren.
Fachleute argumentieren, diese „Verpackung“ von Hedge-Fonds-Strategien koste Rendite, denn bei der Gründung eines Dachfonds oder der Emission eines Zertifikats fielen schließlich Kosten an. So erwartet Stefan Zopp vom weltweit größten unabhängigen Hedge-Fonds-Anbieter Man Investments, dass auf Dachfonds bis 2007 mehr als 50 Prozent des von der Branche insgesamt verwalteten Vermögens entfallen werden. Im Jahr 2004 lag dieser Anteil noch etwa bei lediglich 35 Prozent.
Das Problem der nicht mehr so ergiebigen Renditequellen wollen Hedge-Fonds dadurch lösen, dass sie sich auf ihre Stärken besinnen. Sie wollen ihr Geld in Märkte und Produkte investieren, die von der breiten Masse bisher noch nicht entdeckt worden sind und in denen sie durch Nutzung ihres Fachwissens Ineffizienzen nutzen und höhere Renditen erzielen können. Dies gilt unter anderem für die Kredit- und Rohstoffmärkte sowie für neu entstehende Märkte wie den Stromhandel und den Handel mit Kohlendioxid-Emissionsrechten.
21) Krankenversicherer DKV verliert Kunden (HB 20.4.)
nach oben
Ergo-Tochter will 2005 durch neue Vertriebskonzepte die Wende einleiten
HANDELSBLATT, 20.4.2005
cd KÖLN. Die zur Ergo-Gruppe gehörende Deutsche Krankenversicherung (DKV) hofft, durch die jüngsten Vertriebsmaßnahmen den Versichertenschwund zu stoppen. 2004 war die Zahl der Vollversicherten unter die Marke von 800 000 gesunken. Im Neugeschäft setzt Vorstandschef Günter Dibbern auf die Vertriebskooperationen mit dem Gerling-Konzern, der Zürich Gruppe Deutschland, einschließlich des dazugehörenden Deutschen Herold und der Bonnfinanz, die Deutsche Bank sowie die Kooperationen mit gesetzliche Krankenkassen. Die DKV hatte kürzlich die Krankenversicherer der Zürich und von Gerling übernommen.
Lange Jahre war die DKV größter deutscher privater Krankenversicherer, bis dann 2003 die Debeka vorbeizog. „Daran dürfte sich 2004 nichts geändert haben“, sagte Dibbern. Die Kölner verloren 0,5 Prozentpunkte Marktanteile, er liegt gemessen in Beiträgen bei 12,6 Prozent. So muss das Unternehmen alleine eine jährliche Abwanderung von 20 000 bis 30 000 Kunden verkraften, die aus der bereits vor Jahren erfolgten Trennung vom ehemaligen Kooperationspartner Allianz resultiert. Diese war ein Ergebnis der Entflechtung von Allianz und der DKV-Muttergesellschaft Münchener Rück.
Als Grund für den Verlust von Marktanteilen nannte Dibbern auch die vergleichsweise niedrige Preisanpassungen von 2,3 Prozent im vergangenen Jahr. Dadurch sank der Anteil am Beitragskuchen der Branche.
In diesem Jahr müssen die Versicherten der DKV deutliche Beitragserhöhungen von teils mehr als zehn Prozent in Kauf nehmen, im Durchschnitt liegen sie bei 7,3 Prozent. Dies begründet Vorstandsmitglied Hans-Josef Pick mit den in den Jahren 2001 bis 2003 deutlich gestiegen Kosten. Solche dreijährige Intervalle bilden die Grundlage für mögliche Kostenerhöhungen in der privaten Krankenversicherung. Hinzu kam die Anpassung der neuen Sterbetafeln an die gestiegene Lebenserwartung.
Pick sieht vor allem im medizinischen Fortschritt weitere Risiken auf der Kostenseite für die Unternehmen. Eine völlig neue Dimension könne sich hier in Zukunft ergeben, wenn für Kranke genetische Wirkstoffe individuell produziert werden könnten.
Mehr erwartet hatte sich die DKV von dem Kooperationsgeschäft mit den gesetzlichen Krankenkassen. Hier bietet die DKV so genannte Ergänzungstarife für gesetzlich Versicherte an, insbesondere solche der AOK. Bisher wurden hier 100 000 Policen verkauft. „Dies entsprach nicht unseren Erwartungen“, räumte Vorstand Jürgen Lang ein.
Trotz der Vertriebsprobleme stieg der Jahresüberschuss um mehr als ein Drittel auf 46,6 Mill. Euro. Zudem wurden die stillen Lasten beseitigt. Dies waren unterlassene Abschreibungen auf Verluste in den Kapitalanlagen, welche aus der vergangenen Börsenkrise resultieren.
Wie die gesamt Branche kämpft die DKV mit dem Schreckgespenst möglicher Gesundheitsreformen wie der Bürgerversicherung. „Dies würde uns die Existenzgrundlage entziehen“, sagte Dibbern, gleichzeitig würden die Probleme der Sozialsysteme wie die Langlebigkeit nicht gelöst. Gleichwohl beharrt er darauf, dass die Vollversicherung von Kranken im Inland das Kerngeschäft bleibe. Die jüngste Expansion in Märkte wie China, Südkorea oder Spanien will er denn auch nicht als mögliche Exitstrategie aus dem deutschen Markt für den Fall verstanden wissen, dass die Politik von der Branche unerwünschte Reformen durchsetzen könnte.
In diesem Jahr wolle die DKV die eigene Wettbewerbsfähigkeit durch einen Abbau der Verwaltungskosten stärken, sagte Personalvorstand Michael Thiemermann. Hier gebe es noch Hausaufgaben. Anders als der Konkurrent Axa will die DKV hierzu aber keine Arbeiten ins Ausland verlagern. „Hier gibt es keine Pläne“,sagte er. Mit dem Neugeschäft im ersten Quartal ist das Unternehmen laut Lang „unzufrieden“. Allerdings erwartet er im Jahresverlauf eine Verbesserung.
22) Ärzte müssen Rechnungen herausgeben (HB 20.4.)
nach oben
Bundesgerichtshof: Kein Datenschutz in der Insolvenz – Urteil gilt auch für Anwälte und Steuerberater
HANDELSBLATT, 20.4.2005
din KARLSRUHE. Im Insolvenzverfahren müssen Ärzte auf Anfrage die Namen und Adressen ihrer Privatpatienten offen legen und mitteilen, zu welchem Honorar sie diese behandelt haben und welche der Rechnungen noch offen stehen. Zwar fallen solche Daten normalerweise grundsätzlich unter den Datenschutz. Aber im Insolvenzverfahren seien die berechtigten Belange der Gläubiger höher zu bewerten als die Interessen der Patienten, urteilte jetzt der Bundesgerichtshof (BGH). Das Gericht verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass auch Honorarforderungen von anderen Freiberuflern wie Anwälten oder Steuerberatern trotz Verschwiegenheitspflichten grundsätzlich pfändbar sind, zur Insolvenzmasse gehören und daher offen zu legen sind.
Konkret gab der neunte Zivilsenat dem Insolvenzverwalter eines Kölner Internisten recht. Letzterer sollte seine Einkommens-und Vermögensverhältnisse seines Praxisbetriebs offen legen, der trotz Insolvenz weiter lief. Dazu gehörten neben den Kassenbüchern und Abrechnungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung auch Angaben dazu, wann er welche Privatpatienten (mit Adresse) zu welchem Honorar seit dem Tag der Insolvenzeröffnung behandelt hatte. Der Verwalter wollte auch wissen, wie viele der Forderungen noch offen sind. Der Arzt legte alles vor, die Daten der Privatpatienten jedoch nur in anonymisierter Form. Er berief sich auf seine Schweigepflichten. Im übrigen habe er die noch offenen Honorarforderungen an seine Ehefrau abgetreten und brauche sie daher nicht vorzulegen, argumentierte er. Das war zu wenig für den Insolvenzverwalter, der die Unterlagen brauchte, um die Finanzen des Arztes ordnen zu können.
Nach einer erfolglosen zwangsweisen Vorführung ordnete das Amtsgericht Köln Beugehaft an. Rechtsmittel des Arztes in den unteren Instanzen dagegen blieben erfolglos. Der Mediziner legte Rechtsbeschwerde beim BGH ein – und scheiterte auch da. Das Gericht bestätigte die Beugehaft, soweit es um die Offenlegung der genauen Patientendaten samt Honorarabrechnungen ging. Insolvenzverwalter hätten ein berechtigtes Interesse daran, die Finanzverhältnisse der Insolvenzschuldner genau untersuchen zu könne, hieß es. Dazu bräuchten sie im Falle eines Arztes genaue Angaben zu den Privatpatienten.
Der Arzt habe zwar auch eine Schweigepflicht zu erfüllen, um dem Grundrecht des Patienten auf informelle Selbstbestimmung und seinem Persönlichkeitsrecht gerecht zu werden. Und im Gegensatz zu Anwälten und Steuerberatern gehöre dazu auch schon der Umstand, dass der Patient überhaupt bei einem Arzt war. Dieser Anspruch auf Geheimhaltung müsse hinter den Belangen der Gläubiger aber zurück stehen, zumal sich aus dem Namen, Adresse und Honorar nicht ergebe, warum der Patient beim Arzt gewesen sei. Dementsprechend müsse der Mediziner die Daten frei geben.
Die Abtretung der Honorare sahen die Richter nicht als Hindernis an. Auch abgetretene Forderungen gehörten zur Insolvenzmasse. Zudem sei die Abtretung nichtig, weil sie wie bei Anwälten auch die Einwilligung der Klienten erfordere.
23) Mittelstand nimmt sich eine Auszeit (HB 20.4.)
nach oben
Perspektiven der inhabergeführten Unternehmen sind moderat – Angst vor den Billiglohnländern im Osten
RUTH VIERBUCHEN
HANDELSBLATT, 20.4.2005
DÜSSELDORF. Die mittelständische Wirtschaft kann ihrer tragenden Rolle für den wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland gegenwärtig nur unzureichend gerecht werden. So hat sich die Stimmung der Mittelständler nach der Frühjahrsumfrage des Verbands der Vereine Creditreform in Neuss deutlich eingetrübt. Jeder fünfte Betrieb beurteile seine künftige konjunkturelle und finanzielle Lage als mangelhaft und ungenügend, so Creditreform.
Auch der „Mittelstandsmonitor 2005“, ein Bericht zu Konjunktur- und Strukturfragen kleiner und mittlerer Unternehmen, der einmal jährlich veröffentlicht wird, kommt zu dem nüchternen Ergebnis, dass der Mittelstand an der zunächst ausschließlich vom Auslandsgeschäft getragenen Konjunkturerholung weitaus schwächer partizipiere „als die stärker in die globale Arbeitsteilung integrierten Großunternehmen“. Träger des Mittelstandsmonitors sind die KfW-Bankengruppe, der Verband der Vereine Creditreform, das Institut für Mittelstandsforschung (IfM Bonn), das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) sowie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Mit ihrem „Mittelstandsmonitor“ wollen die Institute eine empirisch fundierte Informationsgrundlage über den Mittelstand erstellen.
Die Konsequenz dieser schwachen Mittelstands-Performance für die Konjunktur wird deutlich, führt man sich vor Augen, dass 99 Prozent der Unternehmen mittelständisch sind – also Eigentümer und verantwortlicher Manager identisch sind – und sie knapp die Hälfte der Bruttowertschöpfung des Unternehmenssektors in Deutschland darstellen. „Bereits seit dem Jahr 2000 blieb das mittelständische Geschäftsklima im Gefolge der ausgeprägten Schwäche der Inlandsnachfrage hinter dem der großen Firmen zurück, heißt es im Mittelstandsmonitor weiter, „wobei sich der Abstand in den letzten beiden Jahren rapide ausweitete.“ Geschäftsklima und Auftragslage lägen immer noch unter dem langfristigen Durchschnitt aller Mittelständler. Der Negativtrend lässt sich auch an der „Investitionsbereitschaft“ der inhabergeführten Unternehmen ablesen, die zuletzt bei 35 Prozent lag. Das heißt, dass nur gut ein Drittel der Mittelständler im nächsten Halbjahr in neue Projekte investieren will. „Viel zu wenig für einen kräftigen Aufschwung“, befinden die Forschungsinstitute, wenn man bedenke, dass der langjährige Durchschnitt bei 47 Prozent liege. „Wie in den drei Jahren zuvor gingen von den kleinen und mittleren Unternehmen 2004 per saldo keine positiven Impulse für den Arbeitsmarkt aus“, heißt es im Mittelstandsmonitor.
Eine Trendwende ist auch 2005 nicht zu erwarten: „Denn nur gut jeder zehnte Mittelständler plant Personalaufstockungen im ersten Halbjahr 2005, knapp jeder fünfte strebt hingegen eine Reduzierung an“, so die Forschungsinstitute. Daran wird auch die Tatsache nichts ändern, dass sich die konjunkturelle Erholung in diesem Jahr im moderaten Rahmen fortsetzen und der konjunkturelle Rückstand zu den Großunternehmen durch eine leichte Belebung der Binnenkonjunktur verringern wird. „Mit Investitionen in wesentlich größerem Umfang sowie positiven Beschäftigungsimpulsen ist erst zu rechnen, wenn die Mittelständler von der Tragfähigkeit des binnenwirtschaftlichen Aufschwungs überzeugt sind“, erklären die Institute: „Dies ist gegenwärtig noch nicht der Fall.“
Einzig die eher international ausgerichteten Mittelständler aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Großhandel profitieren überdurchschnittlich vom außenwirtschaftlichen Rückenwind; Einzelhandel, Bau und Dienstleistung dagegen hinken hinterher.
Die große Herausforderung der inhabergeführten Unternehmen ist die EU-Osterweiterung, die laut Mittelstandsmonitor „Chancen und Risiken“ gleichermaßen in sich birgt: „Nie zuvor traten gleichzeitig derart viele Länder der EU bei, und nie zuvor war das wirtschaftliche Gefälle zwischen den neuen und den bisherigen Mitgliedsländern so ausgeprägt.“ Direktionvestitionen und Exporte in den Beitrittsländern eröffneten insbesondere den größeren Mittelständlern attraktive wirtschaftliche Chancen, sind die Forschungsinstitute überzeugt: „Von deren Nutzung hängt nicht zuletzt die Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland ab.“
Vorerst aber überwiegen die „tief greifenden Ängste“. Nach einer Umfrage von Creditreform unter 4 000 Unternehmen sehen 40 Prozent die Erweiterung vornehmlich als Risiko, nur 20 Prozent erkennen darin eine Chance. Ein wesentlicher Grund für die Ängste dürfte das stark ausgeprägte Lohnkostengefälle zwischen den westeuropäischen und den mittel- und osteuropäischen Ländern sein. „Die Bruttomonatsverdienste im verarbeitenden Gewerbe Tschechiens beispielsweise lagen 2001 gerade einmal bei 14 Prozent und in Polen bei rund 17 Prozent der Verdienste in der westdeutschen Industrie“, zeigen die Forschungsinstitute auf. Doch existierten Lohnkostenvorteile nur dann, wenn das Lohngefälle den Produktivitätsrückstand überkompensierten. geben die Forschungsinstitute zu bedenken.
Nach einer Erhebung von Eurostat lag die Arbeitsproduktivität, also die Wertschöpfung je Beschäftigtem, im verarbeitenden Gewerbe der Beitrittsländer 2001 nur bei 28,7 Prozent der alten EU-Länder. Das Bild ändert sich aber dann, wenn ausländische Investoren die Arbeitsproduktivität durch moderne Techniken steigern.
Aus Sicht der Institute verdeutlichen die Ängste der Mittelständler, dass noch erheblicher Aufklärungsbedarf über Konditionen und Konsequenzen der Osterweiterung besteht. Bisher sind etwa 13 Prozent der befragten Mittelständler in den Beitrittsländern aktiv, sei es durch Export, Import oder Direktinvestitionen.
24) Studie verglich europäische Institute (WZ 20.4.)
nach oben
Heimische Banken wenig rentabel
Österreichs Banken weisen in Summe niedrigere Eigenkapitalrentabilitäten auf als der europäische Durchschnitt, ergab die "European Banking Study 2004" eines deutschen Unternehmensberaters.
Die Rentabilitäten sind in den meisten Ländern – insbesondere in Osteuropa – höher als in Österreich. Dagegen können die heimischen Top-Banken durchaus mit dem europäischen Spitzeninstituten mithalten. Analysiert wurden für den Zeitraum 2001 bis 2003 die Daten von rund 4.000 europäischen Groß-, Regional- und Privatbanken in 24 Ländern, darunter 695 Banken aus Österreich.
Die Krisenjahre zu Beginn des neuen Jahrtausends hätten Spuren in den Bilanzen der Banken hinterlassen, so die Berater. Nur 22% der untersuchten Institute hätten 2003 eine Eigenkapitalrentabilität (Return on equity, ROE) von über 15% erzielt. Nur 20% erreichten eine Cost-Income-Ratio von unter 60%. Jedes sechste Institut schaffte nicht einmal einen ROE von 5%.
Österreichs Großbanken heben sich mit einer Eigenkapitalrentabilität von 18,6% deutlich vom europäischen Durchschnitt aller Banken von 14% ab. Besonders gut schneiden auch Großbanken auf den britischen Inseln und in Skandinanvien ab.
25) Kampf gegen sinkende HV-Präsenzen (IVA-Homepage, 20.4.) nach oben
Seit einigen Jahren beunruhigt Politiker wie Wissenschafter, dass die Wahlbeteiligung generell abnimmt. Es werden ernste demokratiepolitische Bedenken geäußert, da von dieser Entwicklung aktive, sehr oft extreme Gruppierungen profitieren könnten.
Auch Kapitalmarktexperten stellen ein Sinken der Präsenzen auf Hauptversammlungen in fast allen europäischen Ländern fest. Dieser Umstand hat wesentliche Auswirkungen u.a. auf das Übernahmerecht, da dadurch mit einer relativ geringen Beteiligungsquote von zum Beispiel 20 Prozent und darunter, das Beherrschen der Gesellschaften möglich ist. In Österreich ist auf Hauptversammlungen der Streubesitz im Schnitt nur mit ca. 15 Prozent vertreten, das heisst, dass demnach bereits ein bestimmenden Kernaktionär mit 20 Prozent einen heterogener Streubesitz dominieren kann.
Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfach: zunehmende Internationalisierung des Aktionariats, Informationslücken, Hürden durch hohe Kosten für Stimmkarten und Zeitaufwand, passive Einstellung der institutionellen Anleger, nicht zeitgemäße Anmeldeprozeduren mit Hinterlegung und Sperre der Aktien. Die bisherigen Bemühungen des IVA Verbesserungen zu erreichen, waren bisher nicht erfolgreich. Das neue Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz bringt diesbezüglich keine Änderungen: die Anzahl von Aufsichtsratsmandaten und Haftungsfragen standen im Vordergrund der Diskussion.
Der IVA ist bemüht trotz Gegenwind im Rahmen der bestehenden Gegebenheiten, dieser Entwicklung entgegenzuwirken:
* Der IVA hat, um ausländischen Aktionären die Vertretung auf den inländischen Hauptversammlungen zu ermöglichen, einen Vertrag mit dem SdK (Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, Kontaktperson Willi Bender, www.sdk.org) abgeschlossen: der SdK vertritt IVA-Mitglieder auf deutschen Hauptversammlungen, der IVA die Mitglieder des SdK in Österreich - unentgeltlich.
* Mit den i.S. Corporate Governance vorbildlichen Unternehmen wie AT&S, OMV, Wienerberger wurde vereinbart, dass der IVA als neutraler Stimmrechtsvertreter die Interessen der Streuaktionäre wahrnehmen wird, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen können, aber den IVA bevollmächtigt haben.Der Vorgang ist relativ einfach: Sie beantragen eine Stimmrechtskarte für diese Gesellschaften und senden diese (im Original) an den IVA. Sie können auch Weisungen über das Stimmverhalten erteilen. Dieser Service ist kostenlos.
Mit diesen Iniativen kann das grundsätzliche Problem zwar nicht gelöst werden, aber zumindestens Akzente und Signale gesetzt werden.
Dr. Wilhelm Rasinger
Datum: 20.04.2005 - Autor: Dr. Wilhelm Rasinger
26)