Michael Aharon Schüller's Private Office
zurück // MAS private office -> Tagesinformationen -> April 2005 -> Donnerstag 28.4.2005
![]()
NB 1: Bitte beachten: die hier angeführten Copyright-geschützten Texte und Graphiken u.a. sind nur für den persönlichen Gebrauch! Dies gilt auch für einen Teil der hier erwähnten LINKS!
NB 2: Die Artikel werden weitgehend ungeordnet präsentiert, sie sind nach Wichtigkeit ( durch !-Markierung) oder nach Rubrik nur ansatzweise geordnet.
1) BA-CA
EinkaufsmanagerIndex im April (Presseinfo der Bank Austria - Creditanstalt
28.4.) mehr...
Industriekonjunktur driftet in den roten Bereich
2) Zahlen fürs erste Quartal sind bestens (HB 28.4.) mehr...
BASF kann sich vor Aufträgen nicht retten
3) Wachstumsaktien sind bei Börsianern unbeliebt (HB 28.4.) mehr...
Grenze zwischen Value- und Growth-Ansatz verschwimmt
Anleger bleiben Substanzwerten treu
4) Andreas Unterberger ab 1. Mai Chefredakteur der "Wiener Zeitung" (Standard
28.4.) mehr...
"Absolut unabhängig und weisungsfrei"
Der ehemalige "Presse"-Chefredakteur will sich schreiberisch "intensiv einbringen"
5) Abschottung gegen Billig-Konkurrenz (HB 28.4.) mehr...
Gebäudereiniger wollen Entsendegesetz nutzen
6) März 2005: Bedingt durch Osterferienverschiebung deutliches Plus bei Nächtigungen
(OeStat 28.4.) mehr...
Bisherige Wintersaison 2004/05: +6,2%
7) Österreich: Industrie - Jahresanalyse 2004 (Oestat 28.4.) mehr...
8) Betreiber sehen vor allem im niedrigen Preissegment noch Wachstumschancen
(HB 28.4.) mehr...
Private Altenheime hängen Konkurrenz ab
9) 14 Prozent mehr Gewinn (HB 28.4.) mehr...
Rhön-Klinikum profitiert von seiner Einkaufstour
10) Stärkerer Frühjahrsaufschwung (HB 28.4.) mehr...
Arbeitslosenzahl sinkt unter fünf Millionen
11) Sozialbericht "Schande für Österreich" (dieStandard 28.4.) mehr...
SPÖ: Regierung verstecke Bericht im Ausschuss
höchste Armut und Armutsgefährdung seit Jahrzehnten
12) Jede/r Fünfte zwischen 30 und 50 arbeitet Teilzeit (dieStandard
28.4.) mehr...
Unverändert signifikant ist der Geschlechterunterschied bei der Teilzeitarbeitsquote: 36 bis 42 Prozent bei Frauen
13) In 40 Prozent der Büros wird gemobbt (Standard
28.4.) mehr...
Studie: Folgen sind Arbeitsausfall bis zum Selbstmord - Vor allem Arbeitnehmer mit geringem Einkommen betroffen
14) Quartalszahlen für Mercedes-Sparte sind katastrophal (HB 28.4.) mehr...
LKW ziehen Daimler-Chrysler aus dem Dreck
15) Reaktion auf Arbeitslosenzahlen (HB 28.4.) mehr...
Clement bügelt Jobpessimisten ab
16) Stellenabbaupläne (HB 28.4.) mehr...
SPD heizt Deutsche-Bank-Debatte an
17) Ärzte gegen Zwangsernährung von Hungerstreikenden (Standard 28.4.) mehr...
Für Traumatisierte den notwendigen Schutz sowie die adäquate therapeutische Betreuung gewährleisten
18) Zulässige Polemik gegen Tancsits (Standard 28.4.) mehr...
Freispruch für Homosexuelle nach "Nazi-Schergen"-Vergleich
19) Mehr Homosexuellen-Rechte (Standard 28.4.) mehr...
Steiermark: VP, SP und Grüne machen Druck
20) Zahl der Scheinunternehmen gestiegen (Standard 28.4.) mehr...
Wirtschaftskammer plädiert für schrittweise Öffnung des Arbeitsmarktes
21) Die zweite Revolution (Rheinischer Merkur 28.4.) mehr...
Lange galt die Flat Tax nur als akademisches Gedankenspiel.
Doch die neuen EU-Staaten machen Ernst.
1) BA-CA
EinkaufsmanagerIndex im April (Presseinfo der Bank Austria - Creditanstalt
28.4.) nach oben
Industriekonjunktur driftet in den roten Bereich
· Erstmals seit drei Jahren meldet die Industrie einen Produktionsrückgang
· Jobabbau beschleunigt sich
· Konjunkturrisken für Österreich deutlich gestiegen
Der BA-CA EinkaufsmanagerIndex fiel im April von 51,0 auf 49,7 und lag damit erstmals seit 2 ½ Jahren wieder unter der Wachstumsmarke von 50. „Die von uns erwartete Konjunkturabkühlung in Österreichs Industrie nimmt immer konkretere Formen an“, fasst Marianne Kager, Chefvolkswirt der Bank Austria Creditanstalt (BA-CA), die aktuelle Entwicklung zusammen. Befragt nach der Produktion im Vergleich zum Vormonat, gaben die Einkaufsmanager seit mehr als drei Jahren erstmals einen Rückgang an: Der entsprechende Wert ging von 51,2 deutlich auf 49,4 zurück. „Österreichs Industrie kann sich nun endgültig nicht mehr gegen die negativen Konjunktureinflüsse in unseren wichtigsten Exportmärkten, allen voran Deutschland, stemmen“, meint Stefan Bruckbauer von der BA-CA. Die Auftragseingänge aus dem Ausland wurden im April mit einem Wert von 47,2 deutlich schwächer als noch im März (49,4) beurteilt.
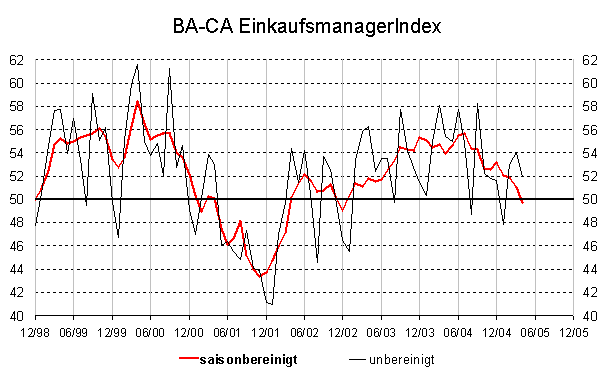
Erstmals kam es auch zu einem Rückgang der Auftragseingänge aus dem Inland. Die Industrieunternehmen haben die Einkaufsmenge, die bereits seit Februar rückläufig ist, im April nochmals reduziert. Der entsprechende Index fiel auf 47,6 - dem niedrigsten Wert seit mehr als drei Jahren. Entsprechend der schwächeren Produktionsdynamik und der Abkühlung der Auftragslage reduzierten die Unternehmen auch ihre Beschäftigung: Hier beschleunigte sich im April der Rückgang, der Wert fiel von 49,1 auf 47,0.
Trotz der schwächeren konjunkturellen Dynamik zeigen die Einkaufspreise aufgrund der Rohstoffpreisentwicklung weiterhin deutlich nach oben. Das Ausmaß der Preissteigerungen hat mit 57,5 gegenüber dem Höhepunkt im Oktober mit 75,9 jedoch deutlich abgenommen. Bei den Verkaufspreisen bewirkte die schwächere Nachfrage bereits einen Rückgang. Erstmals seit 1 ½ Jahren sinken die Verkaufspreise – vom Wert 51,4 auf 47,8.
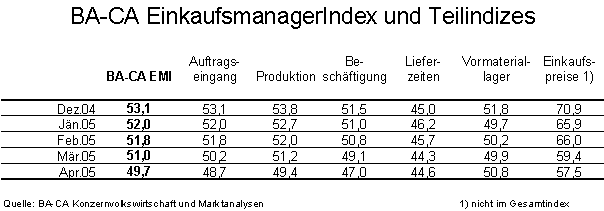
„Rückläufige Beschäftigung,
weniger Einkäufe und sinkende Verkaufspreise sind deutliche Signale der
Stagnation bei Österreichs Industrie“, so Bruckbauer. Das
Produktionsniveau lag auch im April noch deutlich über jenem des Vorjahres, und
dies wird nach Meinung der
BA-CA Ökonomen voraussichtlich über den Sommer so
bleiben. Es wird jedoch nur
mehr wenig über dem Niveau zu Jahresbeginn zu liegen kommen. „Ohne zusätzliche
Impulse gegen Jahresende wird das Produktionsniveau der Industrie Ende 2005 kaum
über jenem Ende 2004 liegen“, so Kager. Zwar gehen die Ökonomen der BA-CA
davon aus, dass sich die Auslandsnachfrage, ausgehend von der deutschen
Konjunktur, gegen Jahresende wieder beleben wird - konkrete Anzeichen fehlen
derzeit aber noch. Nach Meinung der
BA-CA sind damit die Konjunkturrisken für Österreich erneut
gestiegen.
Anmerkung: Werte des EMI über 50,0 weisen auf ein Wachstum gegenüber dem
Vormonat hin, Notierungen unter 50,0 signalisieren einen Rückgang. Je weiter
die Werte von 50,0 entfernt sind, desto größer sind die Wachstums- bzw.
Schrumpfungstendenzen. Diese
Aussendung enthält die Originaldaten aus der Monatsumfrage unter
Einkaufsleitern der Industrie Österreichs, die von der Bank Austria
Creditanstalt gesponsert und unter der Schirmherrschaft des ÖPWZ seit Oktober
1998 von NTC Research durchgeführt wird.
Diesen Text können Sie auch auf unserer Homepage unter www.ba-ca.com/de/presse.html
2) Zahlen fürs erste Quartal sind bestens (HB
28.4.) nach oben
BASF kann sich vor Aufträgen nicht retten
Dank eines florierenden Öl- und Gasgeschäfts sowie
guten Verkäufen bei anderen Chemikalien und Kunststoffen hat BASF operativ deutlich mehr verdient als erwartet.
HB MANNHEIM. Der Betriebsgewinn (Ebit) vor Sondereinflüssen - wie etwa Restrukturierungen - erhöhte sich im ersten Jahresviertel um 33 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro, teilte BASF am Donnerstag vor Beginn der Hauptversammlung in Mannheim mit. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 1,462 Milliarden Euro gerechnet.
Der Konzernumsatz nahm um 11,4 Prozent auf 10,08 Milliarden Euro zu. „Die Nachfrage nach unseren Produkten liegt weiterhin auf hohem Niveau“, erklärte BASF-Chef Jürgen Hambrecht. Den
Quartalsüberschuss gab der Ludwigshafener Traditionskonzern mit
861 Millionen Euro an, ein Plus von 65,6 Prozent.
Für das Gesamtjahr 2005 stellte BASF wie bisher einen Umsatzanstieg in Aussicht. Beim Ebit vor Sondereinflüssen wolle der Konzern an den Vorjahreswert anknüpfen und ihn wenn möglich übertreffen, hieß es. „Den sehr hohen und teilweise weiter steigenden Rohstoffkosten versuchen wir durch Preiserhöhungen zu begegnen“, erklärte Hambrecht. Der Konzern wolle außerdem seine Restrukturierungsmaßnahmen fortsetzen.
BASF profitierte im Quartal nicht nur von starken Geschäften der Chemikalien- und Kunststoff-Bereiche. Auch die Öl- und Gassparte trug mit 484 Millionen Euro wieder deutlich zum Betriebsgewinn vor Sondereinflüssen bei. Hier profitierte BASF vom hohen Ölpreis, der im Vergleich zum Vorjahresquartal kräftig gestiegen war. Die höchsten prozentualen Zuwächse beim Betriebsgewinn vor Sondereinflüssen verzeichneten die Bereiche Kunststoffe mit 74 Prozent sowie Chemikalien mit 70 Prozent.
Für die weltweite Chemieproduktion in diesem Jahr erwartet BASF weiter ein Wachstum von drei Prozent. Zuletzt hatte es Befürchtungen gegeben, eine sich abflauende US-Wirtschaft könnte auch die Nachfrage in der Chemiebranche dämpfen. Der Aufschwung in der Chemiebranche hatte bereits im vierten Quartal 2003 eingesetzt. Angesichts des deutlich gestiegenen Ölpreises hob der Konzern aber seine Erwartungen für den durchschnittlichen Ölpreis in diesem Jahr für die Nordseemarke Brent auf 45 Dollar je Barrel von bislang 35 Dollar an.
Am Freitag wird der Chemie-Konkurrent Bayer seine Hauptversammlung abhalten. Die Leverkusener wollen zwar erst am 10. Mai ihren Quartalsbericht veröffentlichen. Analysten erwarten aber, dass das Bayer-Management bereits erste Aussagen zum Geschäftsverlauf im Auftaktquartal machen wird.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 28. April 2005, 08:45 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1028925
3) Wachstumsaktien sind bei Börsianern unbeliebt (HB
28.4.) nach oben
Grenze zwischen Value- und Growth-Ansatz verschwimmt
Anleger bleiben Substanzwerten treu
Von Christian Schnell, Handelsblatt
Anleger kaufen wieder verstärkt Anteile von Unternehmen mit viel versprechenden Gewinnaussichten und hoher Expansion (Growth). Doch nach Ansicht führender Aktienstrategen und Fondsmanager hält der
Trend zu konservativen Aktien mit günstiger Bewertung und hoher Dividende
(Value) weiter an.
FRANKFURT/M. Die günstige Bewertung von Wachstumsaktien hat Spekulationen angeheizt, dass die Anleger nach fünf Jahren wieder verstärkt Anteile von Unternehmen mit viel versprechenden Gewinnaussichten und hoher Expansion (Growth) kaufen. Doch nach Ansicht führender Aktienstrategen und Fondsmanager hält der Trend zu konservativen Aktien mit günstiger Bewertung und hoher Dividende (Value) weiter an. Das überrascht, weil diese Aktienklasse bereits seit dem Crash der Growth-Titel im Jahr 2000 dominiert und viele Anzeichen für einen Paradigmenwechsel gibt (s. „Substanzwerte setzen sich durch“).
Die Argumentation für einen Wechsel von Substanz- zu Wachstumsaktien lautet: Value-Titel entwickeln sich dann besonders gut, wenn die Wirtschaft boomt und das Gewinnwachstum der Unternehmen in die Höhe
schießt. Damit hat es zumindest für die Euro-Zone in diesem Jahr vorerst ein Ende. Die Analysten erwarten im Schnitt eine
Steigerung der Unternehmensgewinne von 7,7 Prozent und damit weniger als die Hälfte des
Vorjahreswachstums. Auf der anderen Seite erscheinen typische Growth-Branchen wie beispielsweise der
europäische Software-Sektor derzeit im historischen Vergleich
extrem günstig bewertet. Lag dort das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) – es setzt den Aktienkurs in Relation zum Gewinn je Aktie – im Boomjahr 2000 noch bei knapp 70, so sind es
derzeit gerade noch 28.
Dennoch tendiert das Gros der Aktienstrategen weiterhin zu Value-Titeln. „Unsere Analysen zeigen, dass europäische Anleger weiterhin bevorzugt Value-Aktien kaufen“, sagt Karen Olney von Dresdner Kleinwort Wasserstein. Gründe dafür sind weniger die Wachstumsaussichten der jeweiligen Branchen selbst, sondern kommen eher
von konjunktureller und von psychologischer Seite. Gerade erst haben führende Forschungsinstitute ihre Konjunkturprognosen gesenkt. Zudem gelten Wachstumstitel – speziell aus dem Technologiesektor – nach den schlechten Erfahrungen aus Zeiten des Börsenbooms bei vielen Anlegern noch immer als zu riskant.
Selbst Fondsmanager, die einen Growth-Ansatz verfolgen, sehen derzeit tendenziell die größeren Kurschancen bei Value-Aktien. „Bei Growth-Titeln steht aktuell die individuelle Einzeltitelauswahl im Mittelpunkt“, sagt Phil Cliff, der bei der britischen Fondsgesellschaft Threadneedle unter anderem den European Select Growth Fund verwaltet. Der enthält derzeit zwischen 55 und 65 Einzeltitel,
vor allem kleinere Nischenwerte mit dynamischer
Entwicklung. Gesucht sind Unternehmen mit starken wirtschaftlichen Daten, die kleinere Marktthemen besetzen und sich in speziellen Situationen
befinden. Die größten Bestände hält Fondsmanager Cliff von Total, UBS, Eni sowie den beiden französischen Aktien Eiffage und Vinci. Danach kommen Porsche und Hypo Real Estate. Aktien der Allied Irish Bank hat der Threadneedle-Manager hingegen nach einem Kursplus von 50 Prozent seit vergangenem Sommer verkauft.
Überhaupt verwischen in den letzten Jahren die Grenzen zwischen Value- und Growth-Ansatz immer mehr. „Growth at reasonable price“ (Garp) ist eines der neuen Schlagworte. Dahinter verbirgt sich eine
Strategie, die nach den besten Wachstumswerten sucht, die zu einem vernünftigen Preis zu bekommen sind – ein Mix aus Wachstum mit viel Substanz
also. Der Garp-Ansatz kommt immer dann in Mode, wenn wie im Moment moderater Optimismus an den Börsen herrscht, die Anleger aber Übertreibungen unter allen Umständen vermeiden
wollen. Beim Schweizer Bankhaus Vontobel gibt es beispielsweise ein Spezialistenteam, das über Jahre hinweg nach dem GarpAspekt seinen eigenen Value-Stil entwickelt hat: Es
kauft Aktien, die eigentlich als Growth-Aktie gelten, aber zum Preis von Value-Aktien gehandelt
werden.
Dabei sind Umschichtungen allerdings meist öfter als bei konservativen Value-Fonds nötig. Die Experten der WestLB haben in ihrem Fonds Garp-Hedge Portfolio gerade erst sieben Werte ausgetauscht, weil sich deren Wachstumsaussichten verschlechtert haben. Für die Lufthansa, EADS, Fastweb, Holcim, Porsche, Thales und Voestalpine sind nun AP Möller Maersk, Titan Cement, Wienerberger, ST Microelectronics, Atos Origin, O2 und Telia Sonera ins Portfolio aufgerückt.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 28. April 2005, 08:51 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1028902
4) Andreas Unterberger ab 1. Mai Chefredakteur der "Wiener Zeitung"
(Standard 28.4.) nach oben
"Absolut unabhängig und weisungsfrei" - Der ehemalige "Presse"-Chefredakteur will sich schreiberisch "intensiv einbringen"
T
Andreas Unterberger, geboren am 2. Jänner 1949, war von
1973 bis 2004 für "Die Presse" tätig. 1980 wurde er dort Chef vom Dienst, 1982 Ressortleiter der Außenpolitik und schließlich 1995 als Nachfolger von Michael Maier Chefredakteur. Ende vergangenen Jahres musste er in dieser Funktion für Michael Fleischhacker Platz machen.
Andreas Unterberger (56) wird mit 1. Mai Chefredakteur der "Wiener Zeitung". Unterberger wurde in den vergangenen Wochen bereits als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge von Peter Bochskanl (65) gehandelt (etat.at berichtetet). Nun sei sein Engagement fix, bestätigte der frühere "Presse"-Chefredakteur im Gespräch mit der APA.
Neu ist dabei, dass Unterberger als Chefredakteur der im Eigentum der Republik befindlichen Tageszeitung "absolut unabhängig und weisungsfrei" gestellt sei -
eine Lösung ähnlich wie bei ORF oder den Bundestheatern. "Das macht mich sehr optimistisch für die neue Aufgabe." Zu inhaltlichen Plänen wollte Unterberger noch nichts sagen. "Natürlich habe ich Ideen, aber ich will das erst gemeinsam mit der Mannschaft erarbeiten. Vorher in der Öffentlichkeit darüber zu reden wäre ungehörig." Im Gegensatz zu seinem Vorgänger will sich Unterberger jedenfalls
schreiberisch "intensiv einbringen - mit einer Kolumne".
"Schwierige Marktsituation"
Generell sieht der neue Chefredakteur die "Wiener Zeitung" in einer "schwierigen
Marktsituation". Die derzeitige Entwicklung auf dem Medienmarkt eröffne aber ein "Mondfenster", sagte Unterberger.
"Durch die zunehmende Boulevardisierung, den Linksruck mancher Medien und den Umstand, dass alle wie das Kaninchen auf die Schlange Fellner-Zeitung blicken, gibt es Platz für eine seriöse
Tageszeitung." Als solche wolle er die "Wiener Zeitung" strategisch positionieren. Ob er mit "Linksruck" seinen früheren Arbeitgeber "Presse" meint? "Ich habe keinen Namen genannt", so Unterberger, der selbst einen
Ruf als Wertkonservativer und Wirtschaftsliberaler genießt.
Regionale Monopole
Seine Haltung zum Amtsblatt der "Wiener Zeitung" und den darin abgedruckten Pflichtveröffentlichungen hat Unterberger inzwischen etwas adaptiert. Sprach er als "Presse"-Chefredakteur noch von "Anzeigenmonopol" und einer "eklatanten Marktverzerrung", meint er nun, "dass diese Abhängigkeit der 'Wiener Zeitung' sicher nicht der Idealzustand ist, aber angesichts einer monopolistisch beherrschten Medienlandschaft - und hier meine ich nicht nur die Mediaprint, sondern auch regionale Monopole - ist das das kleinere Übel".
Wenn es zu einer Entflechtung dieser Monopole kommt, dann seien die Pflichtveröffentlichungen im Amtsblatt aber durchaus ein Diskussionspunkt. "So aber sichert das Amtsblatt eine kleine, monopolfreie Medienstimme. Außerdem wird mittlerweile in der 'Wiener Zeitung' die Informationsbringschuld des Staates durch ein schon sehr ausgefeiltes Internet-Nutzungssystem erfüllt, das eine Vielfalt von Amtsblatt-Medien so gar nicht anbieten könnte." (APA)
5) Abschottung gegen Billig-Konkurrenz (HB
28.4.) nach oben
Gebäudereiniger wollen Entsendegesetz nutzen
Die Tarifpartner der Gebäudereinigungs-Branche wollen das erweiterte Entsendegesetz für die Festschreibung von Mindest-Arbeitsbedingungen nutzen, sobald es verabschiedet ist.
HB BERLIN. Nach Informationen der "Financial Times Deutschland" vereinbarten der Bundesinnungsverband der Gebäudereiniger und die IG BAU bereits erste Schritte, um das geplante umfassende Entsendegesetz anwendbar zu machen. Es schreibt fest, dass auch ausländische Firmen Beschäftigte nur zu den in Deutschland üblichen Bedingungen hier arbeiten lassen dürfen. Das Bundeskabinett in Berlin hatte am Mittwoch Eckpunkte für eine Ausweitung des bisher vor allem auf den Baubereich beschränkten Entsendegesetzes auf alle Branchen verabschiedet. Die Union hat jedoch bereits angekündigt, das Gesetz in dem von ihr dominierten Bundesrat zu verhindern.
"Wir können sofort loslegen, wenn die gesetzlichen Vorgaben da sind", sagte die stellvertretende Vorsitzende des Innungsverbands der Gebäudereiniger, Christine Sudhop. Die 2600 Mitgliedsfirmern ihres Verbandes und die 720 000 Mitarbeiter fürchteten, dass ohne das Gesetz Unternehmen aus dem Ausland die Branche mit Monatslöhnen von 200 € angreifen. "Diese Firmen wären eine klare Konkurrenz zu unseren tarifgebundenen Firmen, wir hätten keine Chance gegen sie", sagte Sudhop. Ihr Verband würde auch einem gesetzlichen Mindestlohn zustimmen, fügte sie hinzu.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 28. April 2005, 08:32 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1028749
6) März 2005: Bedingt durch Osterferienverschiebung deutliches Plus bei Nächtigungen
(OeStat 28.4.) nach oben
Bisherige Wintersaison 2004/05: +6,2%
Wien, 2005-04-28 - Laut Statistik Austria wurden im März 2005 rund 14,54 Mio. Übernachtungen gemeldet, das entspricht im Vergleich zum Vorjahresmonat einem Zuwachs von 28,0%. Ausschlaggebend für dieses Ergebnis war vor allem die Verschiebung der Osterferien, welche 2004 in den April, heuer aber in den März fielen; dementsprechend ist für April 2005 ein entsprechend hoher Rückgang zu erwarten.
Die Tourismusdaten zur gesamten Wintersaison 2004/05 (November 2004 bis April 2005) werden Ende Mai 2005 vorliegen und veröffentlicht.
7) Österreich: Industrie - Jahresanalyse 2004 (Oestat
28.4.) nach oben
Originalartikel
einschließlich Tabellen und Graphiken siehe hier
Wien, 2005-04-28 - Nach Berechnungen der Statistik Austria erwirtschafteten im Berichtszeitraum
Jänner bis Dezember 2004 im Bereich Industrie (ÖNACE C-E) 6.794 Betriebe (-2,1% im Vergleich zum Vorjahr) mit 560.597 Beschäftigten (+0,6%) einen Umsatz von über 129 Mrd.
Euro.
Dabei zeigte sich für das Jahr 2004 im Bereich Industrie (ÖNACE C-E) eine durchwegs positive Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. Bei den
Produktionswerten (+10,5%), Umsätzen (+10,9%), Auftragseingängen (+16,5%) und Auftragsbeständen (+11%) konnten sogar 2-stellige Zuwächse verzeichnet werden.
Starkes Umsatzplus bei nahezu gleich bleibender Zahl der Beschäftigten in der Industrie
Im Jahresvergleich ergaben sich im Bereich Industrie (ÖNACE C-E) leicht zunehmende Beschäftigtenzahlen (+0,6%) bei stark steigenden Umsätzen (+10,9%). Seit 1996 sank die Beschäftigtenzahl um -4,2% während die Umsätze kräftig um +41,6% zulegten; d.h. 2004 erwirtschafteten 559.798 Beschäftigte (24.800 weniger als 1996) einen Umsatz von 129,1 Mrd. Euro (37,9 Mrd. Euro mehr als 1996).
Produktionswert: Top-Branchenzuwachs von +55,3% für die ÖNACE-Abteilung 34-Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen im Vergleich zum Vorjahr
Außerdem erzielten 2004 die ÖNACE-Abteilung 37-Rückgewinnung (Recycling) (+44,5%) sowie die ÖNACE-Abteilung 27-Metallerzeugung und –bearbeitung (+28,7%) starke Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr.
Starke Rückgänge gab es z.B. in den ÖNACE-Abteilungen 10-Kohlenbergbau, Torfgewinnung (-75,9%), 30-Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und –einrichtungen (-28,3%) sowie 11-Erdöl- und Erdgasbergbau, sowie damit verbundene Dienstleistungen (-22,6%).
Bei der regionalen Betrachtung der Veränderungsraten gegenüber dem Vorjahr zeigte sich einzig und allein in Wien ein Rückgang sowohl beim Produktwert (-1,7%) als auch bei der Zahl der Beschäftigten (-3,1%) sowie den Bruttolöhnen und –gehältern (-5,5%).
Starke Produktionswertsteigerung in der Steiermark
Mit +29,6% Steigerung des Produktionswertes gegenüber dem Vorjahr stellte die Steiermark die Spitze der positiven Entwicklung in Österreich (+10,5%) dar. Nur Wien (-1,7%) wies einen leichten Rückgang des Produktionswertes gegenüber dem Vorjahr auf.
Steigende Auftragseingänge und -bestände in nahezu allen Bundesländern
Für den Bereich Industrie (ÖNACE C-E) ergab sich für Gesamtösterreich ein Plus von +11% bei den Auftragsbeständen. Außer Tirol (-13%) und Oberösterreich (-5%) konnten alle anderen Bundesländer Zuwächse gegenüber dem Vorjahr erzielen. Bei den Auftragseingängen im Bereich Industrie ergaben sich sogar Zuwächse von +16,5% gegenüber dem Vorjahr für Gesamtösterreich. Allein Wien (-2,1%) wies einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr auf, während die Steiermark mit +38,6% die höchste Steigerung erreichte.
Im Jahr 2004 stieg der Produktionswert je Beschäftigtem für den Bereich Industrie (ÖNACE C-E) in Österreich um +9,9%. Diese positive Entwicklung zeigte sich in allen Bundesländern; die höchsten Zuwächse konnte die Steiermark (+27%) aufweisen; am wenigsten konnte der Produktionswert je Beschäftigtem in Wien (+1,4) gesteigert werden.
Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich bei den Bruttolöhnen und –gehältern je Beschäftigtem. Österreichweit kam es zu einer Steigerung von +1,5%, diese Zunahme spiegelte sich mit Ausnahme von Wien (-2,5%) in allen Bundesländern wieder. Die höchsten Zuwachsraten gab es in Kärnten (+6%) und dem Burgenland (+5,1%). Trotz des Rückganges an Bruttolöhnen und –gehältern je Beschäftigtem in Wien erzielte die Bundeshauptstadt mit 41.759 Jahresdurchschnittsgehalt noch immer den mit Abstand höchsten Bundesländerwert und lag damit um 12.209 Euro über dem Jahresdurchschnittsgehalt eines Industriebeschäftigten im Burgenland (29.550 Euro).
Europäischer Vergleich
Die Betrachtung der Produktions- und Beschäftigtenindizes für den Bereich Industrie (NACE C-E) zeigte im europäischen Vergleich eine Entwicklung der steigenden Produktionszahlen bei gleichzeitig sinkenden Beschäftigtenzahlen. Im Durchschnitt der EU 25 ergab dies ein Plus von +2,1% beim Produktionsindex bei einem gleichzeitigen Minus von -1,8% beim Beschäftigtenindex. In Österreich konnte das Beschäftigtenniveau im Vergleich zum Vorjahr gehalten werden und gleichzeitig ein Plus von +6,0% beim Produktionsindex erzielt werden. In Portugal sank sowohl der Produktionsindex (-3,2%) als auch der Beschäftigtenindex (-2,9%) während es in der Tschechischen Republik neben einem steigenden Produktionsindex (+9,2%) auch ein leichtes Plus beim Beschäftigtenindex (+0,1%) gab. Auch die Slowakei konnte sowohl bei der Produktion (+4,1%) als auch bei der Zahl der Beschäftigten (+0,3%) gegenüber dem Vorjahr zulegen.
Fußnote 1 – Methodische Anmerkungen:
* Die Erhebung wird als Stichprobenerhebung, genauer: als Konzentrationsstichprobe geführt. Ausgehend von voll zu erhebenden Schichten (im Sinne der Beschäftigtenklassen: ab 20 Beschäftigten) werden unter Zugrundelegung eines speziellen aktivitätsbezogenen Mindest-Qualitätskriteriums weitere Beschäftigtengrößenklassen (bis max. 10 Beschäftigte) in die Stichprobe mit einbezogen, bis dieses Kriterium erfüllt ist.
* Industrie = ÖNACE C-E, entspricht dem Produzierenden Bereich ohne Bau
* Definition der ÖNACE - Abschnitte:
* Abschnitt C: 10-Kohlenbergbau, Torfgewinnung; 11- Erdöl- und Erdgasbergbau, sowie damit verbundene Dienstleistungen; 13- Erzbergbau; 14- Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau.
* Abschnitt D: 15- Herstellung von Nahrungs- und Genussmittel und Getränken; 16- Tabakverarbeitung; 17- Herstellung von Textilien, Textilwaren (ohne Bekleidung); 18- Herstellung von Bekleidung; 19- Ledererzeugung und -verarbeitung; 20- Be- und Verarbeitung von Holz (ohne Herstellung von Möbeln); 21- Herstellung und Verarbeitung von Papier und Pappe; 22- Verlagswesen, Druckerei, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern; 23- Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen; 24- Herstellung von Chemikalien und chemischen Erzeugnissen; 25- Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren; 26- Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus Steinen und Erden; 27- Metallerzeugung und -bearbeitung; 28- Herstellung von Metallerzeugnissen; 29- Maschinenbau; 30- Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen; 31- Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u.ä.; 32- Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik; 33- Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik; 34- Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen; 35- Sonstiger Fahrzeugbau; 36- Herstellung von Möbel, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen; 37- Rückgewinnung (Recycling).
* Abschnitt E: 40-Energieversorgung; 41-Wasserversorgung.
* Zuordnung erfolgt über den Aktivitätsansatz
* Produktionswert = technische Gesamtproduktion (Eigenproduktion für den Absatz sowie für unternehmensinterne Lieferungen und Leistungen bestimmt + durchgeführte Lohnarbeit)
* Produktionswert und Auftragseingänge: kumulierte Werte zum jeweiligen Stichtag
* Zahl der Beschäftigten insgesamt und Auftragsbestände: Bestandsgrößen zum jeweiligen Stichtag
* Bei den Werten des Jahres 2004 handelt es sich um vorläufige Daten.
Originalartikel
einschließlich Tabellen und Graphiken siehe hier
8) Betreiber sehen vor allem im niedrigen Preissegment noch Wachstumschancen
(HB 28.4.) nach oben
Private Altenheime hängen Konkurrenz ab
Von Anna Sleegers, Handelsblatt
Die kommerziellen Betreiber von Pflegeheimen können ein rasantes Wachstum
verbuchen. Börsennotierte Anbieter wie Curanum, Marseille-Kliniken und Maternus erzielten 2004 mit ihren Altenheimen hohe Zuwächse bei Umsatz und Gewinn und werden dafür von der Börse mit kräftigen Kurssteigerungen honoriert.
FRANKFURT/M. Derzeit sind nach Angaben des statistischen Bundesamts etwa 600 000 Menschen in Deutschland in Pflegeeinrichtungen
untergebracht. Wegen der zunehmenden Zahl von
Single-Haushalten, aber auch wegen der steigenden Lebenserwartung und des damit einhergehenden Demenz-Risikos ist die Tendenz weiter
steigend.
„Anders als die Reha-Kliniken sind Pflegeheime unabhängig von der Konjunktur“, sagte Axel Hölzer, Chef der in beiden Bereichen tätigen Marseille-Kliniken auf dem HPS-Gesundheitstag in Frankfurt. Auch den bei Geschäftszahlen eher verschwiegenen Privatunternehmen wie Kursana oder Casa Reha geht es offenbar gut – zumindest wenn man die Inbetriebnahme neuer Einrichtungen als Indiz des wirtschaftlichen Erfolgs wertet.
Etwa ein Drittel der Altenheime in Deutschland werden nach Angaben des Statistischen Bundesamts von
privaten Trägern geführt. Die überwiegende Zahl der Häuser gehört jedoch kirchlichen Trägern oder Wohlfahrtsverbänden, die wegen ihres juristischen Status als gemeinnützige Einrichtungen nicht gewinnorientiert arbeiten
dürfen.
Ähnlich wie die Krankenhausgruppen Rhön-Klinikum, Helios und Asklepios, interessieren sich auch die größeren Pflegeheimbetreiber weniger für die solventen Selbstzahler als für den
Massenmarkt. Die Selbstzahler stellen eher ein Zusatzgeschäft oder aber eine lukrative Nische für Anbieter aus dem Luxussegment dar.
„Etwa die Hälfte der Pflegebedürftigen sind Sozialhilfeempfänger“, erläutert Frank Steinhoff, Geschäftsführer der Maternus-Altenheime. Angesichts des drohenden Kollapses der Pflegeversicherungen verspricht er sich die größten Wachstumschancen von preiswerten Angeboten. Dem pflichtet auch Marseille-Chef Hölzer bei: „Es fehlt in Deutschland an Pflegeeinrichtungen der
Zwei-Sterne-Kategorie.“
Kommerzielle und gemeinnützige Senioreneinrichtungen rechnen nach den selben Pflegesätzen ab. Da es für die gemeinnützigen Wettbewerber keinen Anreiz gibt, Renditen zu erwirtschaften, gelingt es professionell gemanagten Privatunternehmen relativ leicht, über Kostenvorteile Gewinne zu erwirtschaften.
Besonders ihre Personalkosten haben die privaten Pflegeheimbetreiber meist besser im Griff als die Non-Profit-Wettbewerber. Die
meisten gemeinnützigen Anbieter kommen auf eine Personalkosten-Quote von 60 bis 70 Prozent, wie Helmut Braun vom Kuratorium Wohnen im Alter e.V. (KWA) bestätigt.
Private Anbieter kommen dagegen auf eine Quote von 50
Prozent.
Das liegt vor allem daran, dass sich private Betreiber leichter aus dem Bundesangestelltentarif (BAT) lösen können. Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ist bei den Managern der Branche unbeliebt, weil sich die Höhe der Gehälter nicht am Engagement der Mitarbeiter orientiert, sondern vor allem an ihrem Lebensalter und der Zahl ihrer Kinder.
Thomas Greiner, Geschäftsführer der zur Dienstleistungsgruppe Dussmann zählenden Kursana GmbH, brüstet sich daher damit, dass er die 73 Pflegeeinrichtungen der Gruppe in Deutschland BAT-frei gemacht hat.
„Gute Leute muss man aber auch ohne BAT ordentlich bezahlen“, sagt Maternus-Manager Steinhoff. Trotz steigender Arbeitslosenzahlen fehle es noch immer an Pflegekräften in Deutschland. Allmählich entspanne sich die Lage jedoch etwas. „Immer mehr Krankenhäuser entlassen Personal, das sich dann bei uns bewirbt“, sagt er.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 28. April 2005, 08:59 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1028881
9) 14 Prozent mehr Gewinn (HB 28.4.) nach oben
Rhön-Klinikum profitiert von seiner Einkaufstour
Der Krankenhausbetreiber Rhön-Klinikum hat dank der Übernahme weiterer Kliniken Umsatz und Gewinn im ersten Quartal deutlich
gesteigert.
HB FRANKFURT. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe sich in den ersten drei Monaten auf 34 Millionen Euro von 29,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum erhöht, teilte das Unternehmen in Bad Neustadt an der Saale am Donnerstag mit. Von Reuters befragte Analysten hatten mit 31,2 Millionen Euro Ebit gerechnet. Der
Konzerngewinn lag mit 22,2 (2004: 19,3) Millionen Euro ebenfalls klar über den Analystenschätzungen von 18,8 Millionen Euro. Der
Umsatz kletterte um 37 Prozent auf 340,7 Millionen Euro. Grund für den Zuwachs sei vor allem die
Konsolidierung von neun neuen Klinken gewesen.
Bis Jahresende erwartet Rhön-Klinikum ohne Berücksichtigung möglicher Übernahmen unverändert einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro und einen Gewinn von 84 Millionen Euro. „Den Wachstumskurs werden wir im Geschäftsjahr 2005 beibehalten“, sagte Vorstandschef Eugen Münch. Rhön-Klinikum sehe auch im laufenden Jahr die Möglichkeit, weiter Chancen im Markt nutzen zu können.
Derzeit gehören 39 Kliniken mit 11.811 Betten und Plätzen an 31 Standorten zum
Unternehmen. Zuletzt hatte das Bundeskartellamt Rhön-Klinikum die Übernahme dreier Kliniken untersagt, um eine marktbeherrschende Stellung zu
verhindern. Das Unternehmen, das zuletzt zwei Krankenhäuser in Bayern gekauft hatte, hat
dagegen Beschwerde eingelegt.
Rhön-Klinikum hat angekündigt, er werde seine stimmrechtslosen Vorzugsaktien in Stammaktien umwandeln und die Anteilsscheine damit attraktiver machen. Zudem sollen alle Aktionäre für je eine Aktie eine Gratisaktie erhalten, womit die Papiere optisch billiger werden. Das Grundkapital wird dazu aus den eigenen Gewinnrücklagen verdoppelt. Um die Interessen der bisher allein stimmberechtigten Stammaktionäre um die Familie Münch (24 Prozent der Stammaktien) und die HVB (27 Prozent der Stämme) zu schützen, soll für Satzungsänderungen künftig eine Mehrheit von 90 Prozent des Grundkapitals nötig sein. Von den Stammaktien sind 23 Prozent im Streubesitz, bei den Vorzügen sind es 51 Prozent.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 28. April 2005, 09:50 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1028996
10) Stärkerer Frühjahrsaufschwung (HB 28.4.) nach oben
Arbeitslosenzahl sinkt unter fünf Millionen
Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist erstmals wieder zurückgegangen. Im
April waren 4,968 Millionen Menschen ohne Job, teilte die Bundesagentur für Arbeit jetzt offiziell mit. Eine echte Trendwende lässt jedoch weiter auf sich
warten.
Die Trendwende am Arbeitsmarkt lässt weiter auf sich warten. Foto: dpa
Bild vergrößern Die Trendwende am Arbeitsmarkt lässt weiter auf sich warten. Foto: dpa
HB NÜRNBERG. Der Frühjahrsaufschwung auf dem Arbeitsmarkt ließ die Zahl der Erwerbslosen unter die psychologisch wichtige Marke von fünf Millionen sinken. Das sind im April knapp 208 000 weniger Arbeitslose als im März, aber
rund 524 000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,5 Punkte auf 12,0
Prozent.
In Westdeutschland wurden 3,262 Millionen Arbeitslose gezählt, im Osten 1,705 Millionen. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise sagte, auch die Entwicklung von Erwerbstätigkeit und Beschäftigung gäben wieder etwas Anlass zur Hoffnung.
Der Frühjahrsaufschwung fiel damit deutlich stärker aus als Arbeitsmarktexperten noch in der Vorwoche angenommen hatten. Die Analysten deutscher Großbanken waren im Schnitt nur von einem Rückgang der Arbeitslosenzahl von rund 135 000 auf knapp über fünf Millionen ausgegangen. „Der nun starke Rückgang ist offenbar die Gegenbewegung zur schwachen Frühjahrsbelebung im März“, betonte DZ- Bank-Volkswirt Bernd Weidensteiner.
Trotz „einiger schwacher Erholungszeichen“ sei die binnenwirtschaftliche Lage jedoch noch zu fragil, um eine größere Entlastung am Arbeitsmarkt zu
erlauben, meint Weidensteiner. Umfragen unter Einkaufsmanagern deuteten unverändert auf einen leichten
Personalabbau.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 28. April 2005, 09:39 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1028954
11) Sozialbericht "Schande für Österreich" (dieStandard
28.4.) nach oben
SPÖ: Regierung verstecke Bericht im Ausschuss
höchste Armut und Armutsgefährdung seit Jahrzehnten
Wien - Der Sozialbericht 2003/2004 wird nicht im Plenum des Nationalrates öffentlich diskutiert, sondern - nach dem Willen der Regierungsmehrheit - im Ausschuss enderledigt. Für die SPÖ ist dies Anlass zu scharfer Kritik: Dieser "traurige Tätigkeitsbericht" der Regierung werde "im Ausschuss versteckt", kritisierte Familiensprecherin Andrea Kuntzl am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit Sozialsprecherin Heidrun Silhavy und Gesundheitssprecher Manfred Lackner. Silhavy nannte den Bericht eine "Schande für ein so reiches Land wie Österreich".
Höchste Armutsgefährdung seit Jarzehnten
Nach wenigen Jahren schwarz-blauer Regierung gebe es laut dem Sozialbericht 2003/2004 in Österreich
mehr als eine Million armutsgefährdeter und fast eine halbe Million in akuter Armut lebender
Menschen. Die Regierung steuere dieser Entwicklung nicht entgegen, sondern verstärke sie mit vielen ihrer Maßnahmen. Die sozialpolitische Bilanz von Schwarz-Blau zeige "ein echtes Desaster", kritisierte Silhavy: Die höchste Armut und Armutsgefährdung seit Jahrzehnten, die höchste Arbeitslosigkeit der Zweiten Republik. 38 der 58 schwarz-blauen Belastungsmaßnahmen hätten direkt den Sozialbereich betroffen, die
Pensionen würden seit 2000 real massiv gekürzt. Mit
Kürzungen im Arbeitslosen-Bereich und dem Kindergeld habe die Regierung einen "tatsächlichen Beitrag zur Armutsgefährdung" geliefert.
"Viel zu lange zugeschaut"
Der Bericht bestätige, dass Erwerbsarbeit ein wirksamer Schutz gegen Armut sei, so Silhavy. Die
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit müsse also "höchste Priorität" haben. Die Regierung habe hier "viel zu lange zugeschaut", meinte Silhavy. Aber nicht nur Arbeitslosigkeit, auch Teilzeitarbeit oder prekäre Beschäftigungsverhältnisse erhöhten das Armutsrisiko.
Sozial sei also nicht, wie Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (V) immer sage, "was Arbeit schafft", sondern "was Arbeit schafft, von der man auch leben
kann".
Problematische Situation der Alleinerziehenden
"Dramatisch verschlechtert" habe sich die Situation der Familien, betonte Kuntzl. Gerade die
Menschen, "deren Lebensmodell den Vorstellungen der Regierung entspricht, sind durch ihre Maßnahmen in die Armut
hineingerutscht". Vor allem Alleinerziehende, Familien mit mehreren Kindern und solche mit nur einem Haushalts-Einkommen - wo die Mutter zu Hause bleibt - seien armutsgefährdet.
Das von ÖVP und FPÖ eingeführte Kindergeld erhöhe die Armutsgefährdnung, weil der Wiedereinstieg in den Beruf nach einer längeren Babypause viel schwieriger
werde.
Erwerbstätigkeit der Frauen fördern
Die SPÖ fordert deshalb einen "effizienten Maßnahmenmix": Der wichtigste Schüssel sei die
Erwerbstätigkeit der Frauen. Weiters müsse das Kindergeld flexibilisiert (also höhere Auszahlungen pro Monat bei kürzerer
Babypause), die Zuverdienstgrenze bei reduzierter Arbeitszeit gestrichen werden; das
Recht auf Teilzeitarbeit müsse durch ein Rückkehrrecht in Vollzeitarbeit
verbessert, Kinderbetreuungsplätze geschaffen
werden. Außerdem pochte Kuntzl auf das SPÖ-Modell der "bedarfsorientierten Grundsicherung".
"Art Staatswohltätigkeit"
Als "Offenbarungseid der Regierung" bezeichnete Lackner den Sozialbericht. Er zeige zunehmende Armut und Krankheit bei gleichzeitig zunehmendem Reichtum und Vermögen. Verteilungsgerechtigkeit und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen seien der Regierung "offenbar fremd"; übrig bleibe nur eine "Art Staatswohltätigkeit", die an ausgewählte Bedürftige Almosen verteilt. Mit der
Aushöhlung des Sozialsystems und der Abkehr vom solidarisch finanzierten Gesundheitssystem, Leistungskürzungen und zunehmenden Selbstbehalten bewirke die Regierung die Verarmung und die Verschlechterung des Gesundheitszustandes weiter
Bevölkerungsgruppen. (APA)
vgl dazu den österreichischen
Sozialbericht 2003/2004; ferner
- die entsprechende Website des Bundesministeriums
für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (BMSG)
- den Armuts/Reichtumsbericht
(OGGP,
Juli 2004)
12) Jede/r Fünfte zwischen 30 und 50 arbeitet Teilzeit (dieStandard
28.4.) nach oben
Unverändert signifikant ist der Geschlechterunterschied bei der Teilzeitarbeitsquote: 36 bis 42 Prozent bei Frauen
Wien - Rund 20 Prozent der 30- bis 50-jährigen Erwerbstätigen in Österreich arbeitet
Teilzeit, die meisten davon in Oberösterreich und Salzburg. Der Anteil an Österreichern ist dabei deutlich höher als bei ausländischen Beschäftigten. Besonders von Teilzeit betroffen sind
ArbeitnehmerInnen mit geringer Ausbildung, so die derzeit aktuellsten Zahlen (2003) der Statistik Austria. Die Zahlen zu 2004 sollen in Kürze folgen.
Die meisten Teilzeitbeschäftigten gibt es bei Menschen
im Pensionsalter, bei den über 60-jährigen sind es mehr als jeder Zweite. Signifikant ist der Geschlechterunterschied bei der Teilzeitarbeitsquote. Liegt sie
bei Männern in der Altersgruppe 30 bis 50 bei drei bis vier
Prozent, beträgt sie bei Frauen zwischen 36 und 42
Prozent. (APA)
13) In 40 Prozent der Büros wird gemobbt (Standard
28.4.) nach oben
Studie: Folgen sind Arbeitsausfall bis zum Selbstmord - Vor allem Arbeitnehmer mit geringem Einkommen betroffen
Wien - Tuschelnde Kollegen, Ignorieren von Leistungen oder Unterlagen, die vom Tisch "verschwinden", sind offensichtlich in vielen Büros keine Seltenheit.
Nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Imas, die am Donnerstag in Wien präsentiert wurde, wird an
mehr als 40 Prozent der österreichischen Arbeitsplätzen gemobbt.
Elf Prozent der Befragten gaben sogar an, dass sie
mehrmals pro Monat systematisch schikaniert werden. Betroffen sind überdurchschnittlich viele Wiener.
Die vom Büromöbelhersteller Blaha in Auftrag gegebene Studie, in deren Rahmen mehr als 1.000 Österreicher befragt worden sind, förderte weitere Details zu Tage:
Vor allem Personen, die weniger als 1.400 Euro verdienen, sind vom Mobbing
betroffen.
Ältere Arbeitnehmer häufiger betroffen
Häufiger als ihre jüngeren Kollegen sind offenbar Beschäftigte ab 45 Jahren Opfer der
Schikane. Männer und Frauen sollen in gleichem Maß unter "heimtückischen" Kollegen oder Vorgesetzten leiden.
Gründe für diese Zahlen sehen die Studienautoren unter anderem in den kontinuierlich steigenden Arbeitszeiten, im immer stärker werdenden Druck auf die Beschäftigten, verstärkt durch die Angst, den Arbeitsplatz zu
verlieren.
Bis zum Selbstmord
Folgen sind sinkende Motivation, Krankheiten, Panikattacken und im schlimmsten Fall
Depressionen. Jeder sechste Selbstmord in Österreich soll damit in Zusammenhang stehen, hieß es bei der Pressekonferenz.
Während das Phänomen Mobbing in österreichischen Büros immer mehr um sich greift, scheint das
Problem selbst vielen Unternehmen noch nicht
bewusst zu sein, meinte Doris Eyett, Research Director von Imas International.
Abhilfe könne - so die Studie - zum Beispiel eine
moderne und freundliche Büroausstattung schaffen.
Auch die Errichtung von Kommunikationszentren, in denen sich Kollegen austauschen, könne einem negativen Betriebsklima vorbeugen. 45 Prozent der Befragten gaben an, dass sie einen solchen "Plauderraum" für sehr wichtig halten und jeder Dritte betonte die große Bedeutung der Ausstattung von Büros.
ÖGB bietet Beratung für Betroffene
"Mobbing passiert, wenn die Kommunikation nicht passt und hat meist strukturelle Ursachen", erklärte am Donnerstag auch der ÖGB in einer Aussendung. Eine freundliche Arbeitsumgebung mit moderner Büroausstattung allein reiche nicht aus, um Mobbing zu verhindern.
"Unklare Hierarchien im Betrieb, eine unklare Kompetenzaufteilung und der zunehmende Druck am Arbeitsplatz sind die häufigsten Ursachen für Mobbing", erläuterte ÖGB-Mobbling-Expterin Anni Musger-Krieger.
Für betroffene Gewerkschaftsmitglieder gibt es ein ÖGB-Beratungszentrum, erreichbar unter der Telefonnummer 01/53444-344 und unter der E-Mail-Adresse beratungszentrum@oegb.at. Für die Inanspruchnahme der Mobbing-Beratung ist eine Terminvereinbarung erforderlich. (APA)
14) Quartalszahlen für Mercedes-Sparte sind katastrophal (HB
28.4.) nach oben
LKW ziehen Daimler-Chrysler aus dem Dreck
Der deutsch-amerikanische Daimler-Chrysler-Konzern hat im ersten Quartal schlecht verdient. Schuld war Smart. Die Rettung kam von den Lastwagen.
HB STUTTGART. Die Nutzfahrzeuge waren im ersten Quartal mit einem
Gewinn von 714 Millionen Euro (Vorjahresquartal: 268 Millionen
Euro) der größte Ertragsbringer im Konzern. Ohne dieses Geld wäre Daimler-Chrysler komplett in die Miesen
gefahren. Der LKW-Sparte kam allerdings auch der Schadenersatz zu Gute, den der frühere Eigentümer des japanischen Lastwagen-Bauers
Fuso, Mitsubishi Motors, an Daimler-Chrysler zahlen muss, weil Fuso jahrelang systematisch Schäden an den Nutzfahrzeugen vertuscht hat. Daraus allein sei ein Ertrag von
276 Millionen Euro entstanden, teilte Daimler-Chrysler mit.
Die Mercedes Car Group, der einstige Gewinnbringer, ist hingegen im ersten
Quartal 2005 tief in die roten Zahlen gerutscht. Durch die hohen Belastungen für die Sanierung der Kleinwagenmarke Smart gab es beim operativen Ergebnis einen
Verlust von 954 Millionen Euro. Davon machte die Smart-Sanierung allein 800 Millionen Euro aus, teilte Daimler-Chrysler am Donnerstag in Stuttgart bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen mit.
Von den bis zu 1,2 Milliarden Euro, mit denen Daimler-Chrysler Smart bis 2007 in die Gewinnzone führen will, verbuchte der Autobauer zwei Drittel im ersten Quartal. Der Aufsichtsrat habe das neue Geschäftsmodell für Smart gebilligt, sich künftig auf zwei Modelle zu beschränken. Bei der Nobelmarke Mercedes-Benz schlug die Beseitigung von Qualitätsmängeln negativ zu Buche. Mercedes-Pkw-Chef Eckhard Cordes erwartet für seine Sparte allerdings bereits im laufenden zweiten Quartal die Wende zum Besseren, im dritten Quartal sei ein zweiter Ergebnisschub zu erwarten.
Der operative Gewinn des Gesamtkonzerns fiel mit 628 Millionen Euro deutlich schwächer aus als im
Vorjahresquartal mit 1,546 Milliarden Euro. Dennoch waren die Analysten positiv überrascht. Sie hatten dem Konzern nur 323 Millionen Euro zugetraut. Der Nettogewinn lag bei 288 Millionen Euro. Ohne die Sondereffekte - vor allem den Sanierungsfall Smart - hätte der operative Gewinn 1,428 Milliarden Euro betragen, teilte Daimler-Chrysler mit. Der Quartalsumsatz des Konzerns gab vor allem auf Grund negativer Wechselkurseffekte zum Vorjahr um rund zwei Prozent auf 31,7 Milliarden Euro nach.
Finanzvorstand Bodo Uebber bekräftigte die Anfang April nach unten korrigierte Prognose für das Gesamtjahr. Danach soll der operative Gewinn ohne die Kosten für Smart knapp über den im vergangenen Jahr erwirtschafteten 5,75 Milliarden Euro liegen, einschließlich der Kosten für Smart liegt die Messlatte bei 4,55 Milliarden Euro. „Wir haben einen kräftigen Gegenwind bei den Rohstoffpreisen und einen anhaltend scharfen Wettbewerb“, warnte Uebber.
Der Daimler-Chrysler-Aktie verliehen die Zahlen nur kurz einen Schub nach oben. Am Nachmittag lag sie mit 30,40 Euro 0,3 Prozent unter dem Vortageskurs und knapp über ihrem Jahrestief. „Rechnet man die Sondereffekte heraus, liegt das Ergebnis unter meinen Erwartungen“, sagte Analyst Fabian Kania von Helaba Trust. Sein Kollege Michael Punzet von der Landesbank Rheinland-Pfalz war freundlicher gestimmt: „Die Zahlen sind einen Tick besser als erwartet, insbesondere bei den Nutzfahrzeugen.“
Der erfolgreiche Start des Mautsystems „Toll Collect“ entlastete den Konzern im Dienstleistungs-Geschäft. 2004 hatten Pannen bei Toll Collect den Autobauer im ersten Quartal 279 Millionen Euro gekostet.
Schwächer als von dem Experten erwartet schnitt Chrysler im ersten Quartal ab. Der
operative Gewinn der US-Tochter ging um 17 Prozent auf 252 Millionen Euro zurück, Analysten hatten mit einem Anstieg gerechnet. Chrysler lieferte drei Prozent weniger Fahrzeuge an die Händler aus, verkaufte aber mit 664.500 Autos fünf Prozent mehr an Endkunden. Weltweit setzte Daimler-Chrysler mit 1,1 Millionen Autos ein Prozent mehr ab.
Die Mercedes Car Group lag mit 247.000 verkauften Fahrzeugen sieben Prozent hinter dem Vorjahresquartal zurück, was der Konzern vor allem mit Modellwechseln erklärte. „Die weltweite Automobilnachfrage hat im ersten Quartal 2005 an Schwung verloren“, konstatierte Daimler-Chrysler aber auch.
Die Qualitätsmängel bei Mercedes-Benz will sich Daimler-Chrysler
von den Zulieferern bezahlen lassen. Das Unternehmen gehe davon aus, dass die Aufwendungen von Rückrufaktionen im Rahmen von Regressansprüchen gegenüber den Lieferanten zu einem Großteil geltend gemacht werden können. Die Kosten bezifferte Daimler-Chrysler aber nicht. Sie sind in den Rückstellungsposten enthalten, die sich im Vergleich zum Vorjahr auf 454 Millionen Euro deutlich erhöhten.
Ende März hatte Mercedes-Benz 1,3 Millionen Modelle aus den Baujahren 2001 bis 2005 wegen Fehlern im Bremssystem und in der Stromversorgung zurückgerufen. Wegen fehlerhafter Diesel- Einspritzpumpen des Zulieferers Bosch verzögerte sich zudem die Auslieferung neuer Fahrzeuge.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 28. April 2005, 16:19 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1029237
15) Reaktion auf Arbeitslosenzahlen (HB 28.4.) nach oben
Clement bügelt Jobpessimisten ab
Bundeswirtschaftsminister Clement sieht die Reformpolitik der Regierung bestätigt. Die aktuellen Arbeitslosenzahlen von unter fünf Millionen zeichnen seiner Ansicht nach eine Trendwende ab. Anders Denkenden unterstellte Clement Unwissen – und prognostizierte gleichzeitig eine Stabilisierung des Ölpreises.
HB BERLIN. Wolfgang Clement beklagte anlässlich der Bekanntgabe der Arbeitslosenzahlen für April ein derzeit mangelndes Vertrauen in die Politik. "Das Vertrauen in die Arbeitsmarktpolitik, das ja zurzeit in Deutschland sicher gestört ist, dieses Vertrauen können wir zurückgewinnen, wenn wir deutlich machen, dass wir auf diesem Feld sehr rasch konkrete Fortschritte und Erfolge erzielen", sagte Clement.
„Nach dem „Kaltstart und den Startschwierigkeiten im ersten Quartal beginnen die Reformen am Arbeitsmarkt ihre Wirkung zu
entfalten“, sagte Clement. „Der Arbeitsmarkt ist auf dem Weg der Besserung.“ Die Marke von fünf Millionen werde künftig nicht mehr überschritten, bekräftigte der Wirtschaftsminister.
Notwendig sei jedoch die Bereitschaft aller zur Mitarbeit. Im
April erreichte Verbesserungen bei der Jugendarbeitslosigkeit seien "ein überaus wichtiges Signal für
Deutschland". Er bitte, alles daran zu setzen, dass auf diesem Feld jetzt Erfolge erreicht würden.
Die Zahl der Arbeitslosen sank im April dank der starken Frühjahrsbelebung um 208 000 auf 4,968
Millionen. Vor allem in einigen Regionen Westdeutschlands sei der Wendepunkt wieder zu Beschäftigungsaufbau erreicht.
Scharfe Kritik äußerte Clement erneut an den sechs führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, die am Vortag ein geschlossenes Reformkonzept von der Regierung verlangt hatten. Ein solches Konzept liege bereits vor. Die Stellungnahmen der Wissesschaftler zum Arbeitsmarkt zeigten zudem, "dass sie nicht ausreichend kenntnisreich sind".
Clement negierte energisch die Gefahr einer Rezession für
Deutschland. „Die sehe ich überhaupt nicht“, er. Die deutsche Wirtschaft sei im zweiten Halbjahr 2004 in eine Schwächephase gekommen. Dies und der hohe Ölpreis würden sich natürlich auf die Wirtschaftsprognose niederschlagen, die die Regierung am Freitag veröffentlichen wird.
Allerdings habe der durch Spekulationen weit überhöhte Ölpreis inzwischen wieder die richtige Richtung eingeschlagen, was auch der Konjunktur zu Gute komme, sagte er. „Alle Fakten sprechen dafür, dass er nach unten gehen muss.“ Ein realistischer Ölpreis müsste unter 40 Dollar je Barrel liegen. Am Donnerstagmittag wurde das Fass Brent-Öl mit Terminkontrakt Juni bei gut 52 Dollar gehandelt.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 28. April 2005, 12:46 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1029212
16) Stellenabbaupläne (HB 28.4.) nach oben
SPD heizt Deutsche-Bank-Debatte an
Der saarländische SPD-Chef Heiko Maas und die Parteilinke Andrea Nahles haben
nach dem Gewinnsprung der Deutschen Bank zu Jahresbeginn Konzernchef Josef Ackermann aufgefordert, den angekündigten Stellenabbau zurückzunehmen.
HB BERLIN. Angesichts eines Vorsteuergewinns von 1,8 Mrd. € und einer darauf basierenden Rendite von 30 % gebe es keine Rechtfertigung mehr für die Kündigungen, erklärte Maas am Donnerstag in Saarbrücken. Ein Festhalten daran würde beweisen, dass es Ackermann nur darum gehe, "das
eigene Betriebsergebnis ohne Verantwortungsbewusstsein für den Standort Deutschland und ohne Rücksicht auf die eigenen Mitarbeiter zu
maximieren".
Nahles sagte der Zeitung "Thüringer Allgemeine", die Zahlen der Deutschen Bank seien ein Grund zur Freude. "Allerdings wäre meine Freude größer, wenn eine zweite Botschaft direkt nachgeschoben worden wäre: Dass man angesichts dieser überraschend hohen Renditen jetzt auf Arbeitsplatzabbau verzichtet“.
Deutschlands größte Bank hatte am Donnerstag eine deutliche Gewinnsteigerung im ersten Quartal 2005 bekannt gegeben. Der Gewinn nach Steuern stieg demnach von
Januar bis März auf 1,1 Mrd. € von 941 Mill. € im
Vorjahreszeitraum. Vor Steuern betrug der Gewinn 1,8 (1,56) Mrd.
€. Ohne die Kosten des Konzernumbaus lag die für Investoren wichtige Rendite sogar bei 33 % vor
Steuern.
Bankchef Ackermann hat den Anlegern für das Gesamtjahr 25 %
versprochen. Dieses Versprechen war mit ein Grund für seine Ankündigung Anfang Februar gewesen, trotz eines Milliardengewinns im Vorjahr
6400 Stellen im In- und Ausland zu streichen, um die Bank noch profitabler zu
machen. Diese von Gewerkschaften und Politikern scharf kritisierte Ankündigung war einer der Auslöser für die von SPD-Chef Franz Müntefering initiierte Kapitalismus-Debatte. Noch am Wochenende hatte Müntefering Ackermann persönlich angegriffen und in einem Interview erklärt, bei ihm stimme die Unternehmensethik nicht mehr, "wenn er eine Eigenkapitalrendite von 25 % zum Ziel erklärt und bei gewachsenen Gewinnen am selben Tag ankündigt, 6400 Menschen zu entlassen“.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 28. April 2005, 20:18 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1029433
17) Ärzte gegen Zwangsernährung von Hungerstreikenden
(Standard 28.4.) nach oben
Für Traumatisierte den notwendigen Schutz sowie die adäquate therapeutische Betreuung gewährleisten
Wien - Im neuen Asylgesetz soll neben dem erschwerten Zugang von Traumatisierten zum Verfahren Zwangsernährung für Schubhäftlinge eingeführt werden. Namhafte Ärzte äußerten am Donnerstag Bedenken dagegen an.
"Neben der Sorge um verstärkte Selbstbeschädigungs- und Selbstmordversuche wirft das Mittel der Zwangsernährung Fragen des medizinisch-ethischen Selbstverständnisses
auf", heißt es in einer Aussendung.
Ärzte wie Max Friedrich (Neuropsychiatrie Wien), Herbert Budka (Wissenschafter des Jahres 1998), Karin Gutierrez-Lobos (Universitätsklinik für Psychiatrie) oder Werner Leixnering (Wagner-Jauregg, Linz) appellieren an Innenministerin Liese Prokop (V),
"von Zwangsernährung in der Schubhaft Abstand zu nehmen und für Traumatisierte den notwendigen Schutz sowie die adäquate therapeutische Betreuung zu gewährleisten."
Nach der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sei eine Zwangsernährung nur zulässig, wenn sie medizinisch unbedingt notwendig
ist. Da die Schubhaft eine Maßnahme im Verwaltungsverfahren und keine Strafe sei, erscheine es "schwer vorstellbar, dass eine Zwangsernährung medizinisch notwendig ist, wenn sie durch andere Maßnahmen verhinderbar wäre", heißt es. (APA)
18) Zulässige Polemik gegen Tancsits (Standard
28.4.) nach oben
Freispruch für Homosexuelle nach "Nazi-Schergen"-Vergleich
Irene Brickner
Wien - Die Einbeziehung von Homosexuellen in das Opferfürsorgegesetz könnte die Würde des "historischen Gesetzgebers"
gefährden, fürchtet der ÖVP-Nationalratsabgeordnete Walter Tancsits im Gedankenjahr. Im "Kontext der bestehenden Debatte" drohe dem Gesetz aus dem Jahr 1947 dadurch eine "Desavouierung", sagte er vor Richterin Natalia
Frohner.
Die Debatte wird von HomosexuellenaktivistInnen umso geharnischter geführt, als bald auch die letzten schwulen und lesbischen NS-Opfer ohne rechtliche Anerkennung sterben dürften. Doch gegen den Generalsekretär der Homosexuellen Initiative (Hosi) Wien, Kurt Krickler, bekam Kläger Tancsits am Donnerstag dennoch nicht
Recht.
Krickler hatte das Mitglied des parlamentarischen Sozialausschusses auf der Hosi-Homepage als "geistigen Nachfahren der braunen Nazi-Schergen" bezeichnet; für den ÖVP-Mann üble Nachrede und Beleidigung. Kurz davor hatte Tancsits im Ausschuss die Aufnahme Homosexueller ins Opferfürsorgegesetz zum wiederholten Mal verzögert.
Diese Maßnahme erübrige sich ohnehin, wiederholte Tancsits vor Gericht: Es sei ihm kein Fall nicht gewährter Entschädigung schwuler und lesbischer NS-Verfolgter bekannt. "Und zwar deshalb, weil es gar keine Anträge gibt", antwortete Krickler. Zuletzt habe 1993 ein wegen seiner sexuellen Orientierung ins KZ gesteckter Mann Entschädigung nach dem Opferfürsorgegesetz beantragt. Er sei abgewiesen worden, "knapp vor seinem Tod".
Freispruch
Angesichts der heftigen Kontroverse, in deren "Kontext" die inkriminierte Äußerung gefallen sei, sprach Frohner Krickler und den mitangeklagten Hosi-Obmann Christian Högl frei. Tancsits sei als Politiker, nicht als Person angegriffen worden - mit Äußerungen, die "sehr, sehr deftig" und "gerade noch zulässig" seien. Für den abgeblitzen Kläger nicht akzeptabel: Er meldete volle Berufung an. (DER STANDARD, Print-Ausgabe, 29.4. 2005)
19) Mehr Homosexuellen-Rechte (Standard 28.4.)
Steiermark: VP, SP und Grüne machen Druck
Graz - "Das Land Steiermark ermutigt seine Lesben, Schwulen und Trans Gender-Personen ihr Leben angstfrei und würdevoll, selbstbestimmt und selbstbewusst zu führen und ruft sie auf, sich in Fällen von Diskriminierung vertrauensvoll an die Menschenrechtskoordinatorin oder an eine andere zuständige Einrichtung zu berufen". Das ist einer von acht Punkten der
"Steirischen Deklaration für Menschen mit gleichgeschlechtlicher Orientierung und
Identität", die der Landtag am 24. Mai beschließen
wird.
Vorreiterin
Damit ist die Steiermark österreichweit Vorreiterin in Sachen Gleichstellung von Homosexuellen. Edith Zitz, die Abgeordnete und Menschenrechtssprecherin der steirischen Grünen, konnte VP-Clubobmann Christopher Drexler und Ilse Reinprecht von der SPÖ am Mittwoch überzeugen, für den Antrag zu stimmen.
In der Deklaration fordert die Steiermark auch den Bund auf, eine Gleichstellung in die Wege zu leiten. (cms/DER STANDARD, Print-Ausgabe, 29.4. 2005)
20) Zahl der Scheinunternehmen gestiegen (Standard 28.4.) nach oben
Wirtschaftskammer plädiert für schrittweise Öffnung des Arbeitsmarktes
Wien - Das Scheinunternehmertum erlebt seit der EU-Osterweiterung einen regelrechten Boom. Allein in
Wien gab es seit dem 1. Mai 2004 im Baunebengewerbe über 3.000 Neugründungen. Mit dem verschärften Sozialbetrugsgesetz und vermehrten Kontrollen ist das Problem offenbar nicht in den Grifft zu bekommen.
Die Wirtschaftskammer plädiert nun für eine schrittweise Öffnung des österreichischen Arbeitsmarktes. WKÖ-Generalsekretär Reinhold Mitterlehner (V) erhofft sich dadurch eine Entkriminalisierung des "grauen Arbeitsmarkts".
Schlupfloch
Das neue Phänomen Scheinselbstständige ist auf ein Schlupfloch in der siebenjährigen Übergangsfrist für den Dienstleistungs- und Arbeitsmarkt, die im Zuge der EU-Erweiterung eigentlich zum Schutz des heimischen Arbeitsmarktes vereinbart wurde, zurückzuführen.
Durch die Dienstleistungsfreiheit für Unternehmer sind Selbstständige davon
ausgenommen. So suchen nun viele Arbeitnehmer aus dem Osten in Österreich um eine Gewerbeberechtigung an und treten dann als Subunternehmer auf.
"Arbeitnehmer selbst nicht kriminell"
"Die Arbeitnehmer selbst sind jedoch nicht als kriminell zu sehen. Sie werden im eigenen Land
abgeworben. Organisiert wird das Ganze von Österreich aus", betonte Mitterlehner bei einem Pressegespräch Mittwochabend in Wien.
Ein Beleg dafür, dass diese Missstände von langer Hand organisiert werden, sei die Tatsache, dass der
Markt nach Staatszugehörigkeit aufgeteilt sei. "Im Bereich Verspachtelungsarbeit sind hauptsächlich Polen beschäftigt, im Stahlbau hingegen Arbeiter aus den ehemaligen
Jugoslawien", erklärte Mitterlehner.
Jüngstes Beispiel: Die KIAB (Kontrollstelle für illegale Ausländerbeschäftigung des Finanzministeriums) ist auf eine Wiener Adresse gestoßen an der mehr als 100 Personen als Einzelunternehmer mit Gewerbestandort und Wohnsitz gemeldet waren. Verschärft wird das Problem dadurch, dass viele der Scheinselbstständigen im eigenen Land Arbeitslosengeld
beziehen.
Milliardenschaden für Baubranche
"Daher ist etwa Tschechien an einer bilateralen Zusammenarbeit interessiert", so Mitterlehner.
Die Zahl der Scheinselbstständigen schätzt die WKÖ österreichweit auf 8.000 bis 10.000. Der Schaden für die Baubranche allein liege etwa bei einer Milliarde Euro in
Jahr.
Scheinselbstständigkeit beschränke sich jedoch nicht allein auf das Baugewerbe und auch nicht auf Österreich. Auch
Deutschland hat mit der Umgehung des Ausländerbeschäftigungsrechtes, die sich mittlerweile auf das Transportwesen sowie den Pflege- und Reinigungsbereich
ausweitet, zu kämpfen.
Das Problem im Gastgewerbe bleibe hingegen weiterhin die
Schwarzarbeit, die sich prozentuell nicht wesentlich verändert habe.
2003 wurden bei 20.000 Kontrollen rund 5.500 illegal Beschäftigte aufgegriffen,
2004 waren es bei 22.000 Kontrollen
6.200. Im ersten Quartal 2005 waren von 2.254 kontrollierten EU-Bürgern (insgesamt 13.550 Kontrollen) 1.803 illegal beschäftigt.
"Überprüfung der Übergangsfristen"
Die Wirtschaftskammer tritt weiters für eine "Überprüfung der Übergangsfristen" ein. "Mit einer schrittweise, aber nicht schrankenlosen, Öffnung des Arbeitsmarkes würden Arbeitnehmer regulär beschäftigt und so die Scheinselbstständigkeit sowie die Schwarzarbeit eingedämmt.
Legale Beschäftigung bedeute auch gleichzeitig Einnahmen für den Staat." Gefordert werden auch bilaterale Beschäftigungsabkommen mit den neuen Mitgliedsstaaten. Die Scheinselbstständigkeit dürfte auch beim Reformdialog am 1. Mai zur Sprache kommen.
Der WKÖ-Generalsekretär betonte schließlich, dass die Wirtschaft der EU-Osterweiterung durchaus positiv gegenüber stehe und Österreich davon profitiert habe. "Wir haben unsere Position als größter Investor in fast allen Staaten ausbauen können", so Mitterlehner. (APA)
21) Die zweite Revolution
(Rheinischer Merkur 28.4.) nach oben
Lange galt die Flat Tax nur als akademisches Gedankenspiel. Doch die neuen
EU-Staaten machen Ernst.
Autor: SILKE LINNEWEBER
Hans Eichel hat es plötzlich eilig. Beim Jobgipfel Anfang April hatten
Koalition und Opposition vereinbart, die Körperschaftssteuer, die auf Gewinne von Kapitalgesellschaften fällig wird, von 25 auf 19 Prozent zurückzufahren. Jetzt soll das Kabinett bereits am 4. Mai einem entsprechenden Kabinettsentwurf zustimmen. Wir wollen den Druck nicht aus dem Kessel lassen, begründet das Ministerium die Hektik. Für die Hektik des Ministers gibt es einen guten Grund. Eichel schaut besorgt nach Osteuropa. Denn eine Reihe der neuen EU-Mitglieder lockt Investoren nicht nur mit günstigen Arbeitskosten und gut ausgebildetem Personal, sondern auch mit niedrigen nominalen und effektiven Steuersätzen auf Unternehmensgewinne. Während der Steuerwettbewerb in Westeuropa Larmoyanz auslöst, setzen im Osten junge Politiker in der Steuerpolitik genau das um, was sie als Stipendiaten in den Seminaren der Ökonomen Westeuropas gelernt haben, beobachtet Franz Wagner, Professor für betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Universität Tübingen.Konkret bedeutet das: Die jungen Eliten im Osten machen Ernst mit der
so genannten Flat Tax, auf Deutsch Einstufensteuer. In einem solchen System gibt es nur noch einen, meist niedrigen Steuertarif auf persönliches Einkommen. In manchen Fällen wird dieser Satz auch auf die Gewinne der Unternehmen angewendet. Im Gegenzug streicht der Staat steuerliche Vergünstigungen. Wichtig: Die Wirtschaft schaut nicht nur auf Unternehmenssteuern. Denn in der Regel werden ausgeschüttete Gewinne auf der Ebene der Anteilseigner nochmals der Einkommenssteuer unterworfen. Folglich profitieren auch Unternehmer von niedrigen Tarifen.Simpel und effizient
Finanzwissenschaftliche Lehrbücher loben die Flat Tax seit geraumer
Zeit als einfach, günstig und effizient. Doch lange galt der Ansatz als nicht praktikabel. Denn im Westen gelten progressive, mit dem Einkommenden steigende Steuersätze als gerecht und wünschenswert. Als erster europäischer Staat führte Estland 1994 eine Flat Tax ein. Seitdem werden dort auf persönliches Einkommen und Unternehmensgewinne einheitlich 26 Prozent Abgaben fällig. Reinvestierte Gewinne bleiben sogar steuerfrei. Vor der Reform existierten verschiedene Einkommenssteuertarife plus ein gesonderter Körperschaftssteuersatz. Estlands baltische Nachbarn Litauen und Lettland zogen fix nach. Ebenfalls 1994 entschieden sich die Litauer für eine Einstufensteuer auf persönliches Einkommen in Höhe von 33 Prozent. Ein Jahr später folgten die Letten mit 25 Prozent. Die Belastung der Unternehmensgewinne liegt in beiden Ländern bei 15 Prozent. Vergangenes Jahr sprang dann auch die Slowakei auf den Einfachsteuer-Zug auf. Seitdem praktiziert der ostmitteleuropäische Staat Flat Tax in Reinkultur. Das Land erhebt 19 Prozent Einkommens-, Gesellschafts- und Mehrwertsteuer. Außerdem bleiben Dividenden steuerfrei. Beitrittskandidat Rumänien entschied sich Anfang des Jahres für einen einheitlichen Einkommenssteuersatz von 16 Prozent. Sollte Polens Mitte-links-Regierung die Wahl gewinnen, will sie 2008 mit der Einfachsteuer ernst machen. Auf persönliches Einkommen und Unternehmensgewinne sollen dann pauschal 18 Prozent Abgaben erhoben werden. Der gleiche Satz soll dann übrigens auch für die Mehrwertsteuer gelten. Dass die amtierende Regierung die Mehrheit aller Wahrscheinlichkeit nach verlieren wird, tut dem Vorhaben keinen Abbruch. Die Opposition liebäugelt ebenfalls mit der Flat Tax. Allerdings schwebt ihr ein Steuersatz von 15 Prozent vor.
Schluss nach oben