Michael Aharon Schüller's Private Office
zurück // MAS private office -> Tagesinformationen -> April und Mai 2005 -> Donnerstag 12.5.2005
![]()
NB 1: Bitte beachten: die hier angeführten Copyright-geschützten Texte und Graphiken u.a. sind nur für den persönlichen Gebrauch! Dies gilt auch für einen Teil der hier erwähnten LINKS! Der Stern hinter dem Artikel-Datum signalisiert, der Artikel ist von einem zurückliegenden Tag, also ein Nachtrag oder eine Wiederholung..
NB 2: Die Artikel werden weitgehend ungeordnet präsentiert, sie sind nach
Wichtigkeit ( durch !-Markierung) oder nach Rubrik nur ansatzweise geordnet.
NB 3: Die hier wiedergegebenen Artikel lassen keinen Rückschluss auf meine persönliche
Meinung zu. Sie reflektieren aber m.E. den tagsaktuellen Meinungsfluss - eben
das, was "heute" die Zeitgenossen gerade bewegt. Zum zweiten geben sie
schlichtweg Sachinformation oder m.E. aufschlussreiche Kommentare zu
unterschiedlichsten Themen wieder, möglichst aus qualitativ hochwertigen
Quellen und kompetenter Feder.
Links des Tages hier
1) "Können nicht gegen den Strom schwimmen" (Standard
11.5.*) mehr...
OeNB-Gouverneur Klaus Liebscher rechnet für spätestens 2006 mit einer Entspannung am Arbeitsmarkt
und verordnet der OeNB weitere "Abschlankung"
2) Wolford überrascht mit Gewinnwarnung - 2004/05 Verlust erwartet (Standard
11.5.*) mehr...
Enttäusche Umsatzentwicklung im März und April
Gesamtjahr bescherte Minus von 2,4 Prozent - Flaues Geschäft in Fernost und der Schweiz
3) Österreich AG bremst sich ein (Standard 11./12.5.) mehr...
Erhoffte Konjunkturerholung verlangsamt sich, insbesondere die Inlandsnachfrage kommt nicht vom Fleck - Mit Infografik
4) Wienerwald Restaurants Österreich verkauft (Standard
7.5.*) mehr...
Franz Kainz Ges.m.b.H. neuer Eigentümer - Sanierung "nachhaltig und abgeschlossen"
5) FP-Politiker finanziert Wienerwald-Deal (10./11.5.*) mehr...
Ehemaliger Parlamentarier und "Club Jörg"-Gründer Harald Fischl übernahm Finanzierung
Kooperation mit privater Pflegeheim-Gruppe
6) General Motors ruft erneut 300.000 Autos zurück (Standard
11.5.*) mehr...
Bereits zweite Rückruf-Aktion innerhalb weniger Wochen
7) "Berlusconi-Status überschritten" (Standard 12.5.) mehr...
Geplante Schüssel-Ansprache: Redakteure wenden sich gegen ORF-Führung
Opposition empört - Anstalt: "Ereignis ist einzigartig"
8) Vereinbarungen des "Job-Gipfels" sind fraglich (HB 11.5.*) mehr...
Mehrheit für Steuerpläne wackelt
9) CDU-Finanzminister Stratthaus wirkt auf Union ein mehr...
Front gegen rot-grünes Steuergesetz bröckelt
10) Entsendegesetz, Wegebau-Beschleunigung und Rußfilter-Förderung beschlossen
(HB 11.5.) mehr...
Beschluss-Marathon im Kabinett
11) Rücklagen fallen auf historischen Tiefstand (HB 11.5.*) mehr...
Eichel muss die Rente sichern
12) Dun & Bradstreet: Jedes dritte Unternehmen im Verzug (HB
11.5.*) mehr...
Säumige Zahler gefährden Mittelstand
13) Schlafforscher: Bürolicht lähmt die innere Uhr (HB 11.5.*) mehr...
14) Positive Überraschung (n-tv 12.5.) mehr...
Stärkeres Wachstum
15) Österreich: Grünes Licht für die EU-Verfassung (Standard
11.5.*) mehr...
Mit nur einer Gegenstimme beschloss das Parlament die Ratifizierung
Lediglich Barbara Rosenkranz stimmte dagegen
16) Neuer Wirkstoff hält das Gehirn auf Trab (HB 11.5.*) mehr...
17) Der Renditevorsprung steigt weiter an (HB 12.5.) mehr...
Nachrangige Anleihen werden populärer
18) Gegen starke Bewegung spricht niedrige Inflationsrate (HB 12.5.)
mehr...
Volkswirte erwarten leichten Renditeanstieg
19) Wachstumsprognose stabil (HB 12.5.) mehr...
RWE verdient weniger
20) EuGH prangert Verstoß gegen Menschenrechte an (HB 12.5.) mehr...
Öcalan-Prozess in der Türkei war unfair
21) 50 Jahre Goggomobil (HB 12.5.) mehr...
22) Bruttoinlandsprodukt legte um 1,0 Prozent zu (HB 12.5.) mehr...
Volkswirte wollen Prognose erhöhen
23) Quartalszahlen: ING gewinnt, Beschäftigte verlieren (HB 12.5.) mehr...
24) Hannover Rück fest - Analysten mit Zahlen zufrieden (HB 12.5.) mehr...
25) Handelsblatt Business-Monitor (HB 12.5.) mehr...
Kritik der Manager am Standort nimmt zu
26) Hauptversammlung: (HB 12.5.) mehr...
BMW muss heftig rudern
27) Marshall-Plan-Vermögen weckt neue Begehrlichkeiten (HB 12.5.) mehr...
Eichel erwägt Forderungsverkäufe
28) Hauptversammlung (HB 12.5.) mehr...
Heftige Kritik an HVB-Führung
29) Studie sieht USA unverändert auf Platz eins (HB 12.5.) mehr...
Deutschland verliert an Wettbewerbsfähigkeit
30) Schätzer rechnen mit 66,8 Millarden Euro Mindereinnahmen (HB
12.5.) mehr...
Steuerloch noch größer als erwartet
31) Vorjahr durch Sondergeschäft geschönt (HB 12.5.) mehr...
Gerling-Leben weist weniger Gewinn aus
32) Deutliche Merheit auf dem Weg zur Ratifizierung (HB 12.5.) mehr...
Bundestag stimmt für EU-Verfassung
33) Die EU-Verfassung – Wichtigste Punkte (HB 12.5.) mehr...
34) Bruttoinlandsprodukt legte um 1,0 Prozent zu (HB 12.5.) mehr...
Deutsche Wirtschaft treibt Wachstum in der Euro-Zone an
35) Staat erwartet 66,8 Mrd.-Euro-Minus (HB 12.5.) mehr...
Eichel versteht Pessimismus nicht
36) US-Einzelhandelsumsatz überraschend stark gestiegen (HB 12.5.) mehr...
Der Umsatzanstieg bei den US-Einzelhändlern hat im April die
Erwartungen der Analysten um das Doppelte übertroffen.
37) Fall könnte neu aufgerollt werden (HB 12.5.) mehr...
Türkei beugt sich EU im Öcalan-Urteil
38) Beitrittsdiskussion (HB 12.5.) mehr...
Vranitzky sieht EU der Türkei gegenüber in der Pflicht
39) Treffen mit linkem SPD-Flügel (HB 12.5.) mehr...
Schröder will Debatte über ethische Wirtschaftsordnung
40) Österreich ratifiziert EU-Verfassung (NZZ 11.5*.) mehr...
41) Deutscher Bundestag sagt Ja zu EU-Verfassung (NZZ 12.5.) mehr...
Deutliches Resultat in der Abstimmung
42) Welche Demokratie für Europa? (NZZ 12.5.) mehr...
Ein Blick auf die laufenden Verfassungsabstimmungen
43) Kontroverse um die EU-Verfassung in Wien (HB 11.5) mehr...
Haider fordert Volksabstimmung - und krebst zurück
44) Das EU-Parlament will strikte Arbeitszeitregeln (HB
11.5.*) mehr...
Gegen Ausnahmen und für Bereitschaftszeit als Arbeitszeit
45) 12 Millionen Menschen sind Opfer von Zwangsarbeit (NZZ 12.5.) mehr...
ILO fordert globale Allianz
46) Überraschend starkes Wachstum der deutschen Wirtschaft (NZZ
12.5.) mehr...
Plus 1 Prozent im ersten Quartal 2005
47)
Links des Tages
nach oben
Befundort
Unterleib
Die
Zukunft des ORF (Standard-Ressort); ORF-Reform
(Standard-Ressort)
Medien
(Standard-Ressort)
Die Europäische
Union und Österreich (Standard-Ressort)
1) "Können nicht gegen den Strom schwimmen" (Standard
11.5.*) nach oben
OeNB-Gouverneur Klaus Liebscher rechnet für spätestens 2006 mit einer Entspannung am Arbeitsmarkt
und verordnet der OeNB weitere "Abschlankung"
Nationalbank-Gouverneur Klaus Liebscher sieht mittelfristig keinen Inflationsdruck im Euroraum.
Zur Person
Klaus Liebscher (65) ist im Juli 2003 von der Bundesregierung zum zweiten Mal in Folge zum obersten Chef der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) bestellt worden. Der Vertrag des Juristen, der auch Sitz und Stimme im EZB-Rat in Frankfurt hat, läuft bis
2008. Der stets betont ruhig und souverän auftretende Bankier ist der konservativen Reichshälfte zuzurechnen. Vor seinem OeNB-Engagement war er Chef der Raiffeisen Zentralbank gewesen.
Das Gespräch führte Renate Graber.
STANDARD: Morgen beginnt die volkswirtschaftliche Tagung der OeNB. Wie ist Ihr Befund zu Österreichs Wirtschaft?
Liebscher: Wir bleiben bei unserer Prognose von zwei Prozent
Wachstum. Damit lägen wir deutlich über dem Euro-Schnitt. Vor allem die
guten Exporte stützen die positive Entwicklung. Natürlich gibt es auch
Risikofaktoren: Konsumnachfrage, gestiegene Inflation und
Ölpreis.
STANDARD: Besorgt Sie die steigende Inflation?
Liebscher: Ich betrachte sie mit erhöhter Aufmerksamkeit, weil wir mit 2,5 Prozent über dem Euroraum-Schnitt von 2,1 Prozent liegen. Und das ist für Österreich relativ hoch.
STANDARD: Was tun?
Liebscher: Für Österreich kann das nur heißen, dass Sozialpartner und Wirtschaft weiterhin zu moderater Lohnentwicklung und Preisfestsetzung aufgerufen sind.
STANDARD: Die hohe Arbeitslosenrate stört Sie nicht?
Liebscher: Natürlich ist jeder Arbeitslose einer zu viel. Der Arbeitsmarkt wird erst bei entsprechendem Wirtschaftswachstum entlastet. Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres können wir da mit einer Entspannung
rechnen.
STANDARD: Die Regierung hat eine Forschungsanleihe beschlossen. Wird die nützen?
Liebscher: Wenn diese Milliarde Euro kommt, wenn sie in F&E und Bildung investiert wird,
bringt das Jobs.
STANDARD: Europas Volkswirtschaften driften auseinander: In Deutschland ist die Inlandsnachfrage schlecht, der Export boomt; in Spanien ist es genau umgekehrt. Wie kann die
EZB da eine Geldpolitik für alle machen?
Liebscher: Das ist natürlich eine große Herausforderung. Negativ ist die Delle der Entwicklung
großer Euro-Länder: Sie müssen ihre Strukturreformen fortsetzen. Österreich hat seine Hausaufgaben gemacht, im Gesundheitsbereich und in der Verwaltung sehe ich noch Potenzial. Auf Bundesebene ist viel geschehen, bei Ländern und Gemeinden und im Förderungswesen ist noch viel zu holen. In anderen großen Ländern wird von Reformen mehr geredet als getan.
STANDARD: Sie meinen das derzeit schwache Deutschland. Wie groß ist die Ansteckungsgefahr für Österreich und die Osteuropäer, die ja ihre Absatzmärkte auch dort haben?
Liebscher: Trotz der schwachen Entwicklung dort haben wir unsere Deutschland-Exporte um 14 Prozent gesteigert. Das zeigt, dass Österreichs Wirtschaft sehr wettbewerbsstark
ist. Bei Osteuropa schließe ich eine gewisse Gefahr nicht aus. Der Osten ist stark EU-12-orientiert, das schleppende Wachstum mancher Länder könnte seines beeinträchtigen. Aber der deutliche Abstand der Wachstumsraten bleibt trotzdem.
STANDARD: Ist die EZB-Zinspolitik für den Euroraum klug?
Liebscher: Ja. Unser Mandat heißt Preisstabilität und wir sehen mittelfristig keinen Inflationsdruck im
Euroraum. Zwei Prozent sind nach derzeitigen Bedingungen das richtige Zinsniveau. Der Leitzinssatz ist kein Hindernis für Wachstum. Wir haben einen stabilen Euro – und Konjunktur- oder Arbeitsmarktpolitik ist keine Aufgabe des Eurosystems und der Notenbanken, sondern der Politik.
STANDARD: Die EZB hat 2004 Verluste geschrieben, die Gewinne der OeNB dürften um rund ein Drittel gefallen
sein. Ein Problem für Sie?
Liebscher: Dass der Gewinn gesunken ist, ist keine Neuigkeit mehr. Konkreter werde ich vor der Generalversammlung nicht. Für heuer gehe ich nicht von nennenswerten Änderungen gegenüber 2004 aus.
STANDARD: Gibt sich der Finanzminister mit sinkenden Ausschüttungen zufrieden?
Liebscher: Wir können nicht gegen den Strom schwimmen. Das respektiert das Finanzministerium, zu dem wir ein entspanntes Verhältnis haben.
STANDARD: Die OeNB verkauft ihre Beteiligungen im bargeldlosen Zahlungsverkehr. Hat das mit der Lust des Finanzministeriums auf etwaige Verkaufserträge zu tun?
Liebscher: Das läuft alles erst an. Wir reden da außerdem über Mini-Erträge, die keinem helfen würden.
STANDARD: Planen Sie weitere Einsparungen in der OeNB?
Liebscher: Wir setzen unseren Abschlankungsprozess fort, haben
zu Jahresbeginn einen Aufnahmestopp verhängt. Das ist ein klares Signal dafür, wohin die Reise geht. Meine Linie ist klar:
Personalreduktion in sozialverträglichem Maß und auf verträglichem
Weg.
STANDARD: Die OeNB dotiert die Forschungsstiftung aus ihren Zinserträgen mit 75 Mio. Euro im Jahr. Stimmt es, dass für 2004 rund 30 Mio. fehlen?
Liebscher: Ich weiß nur, dass wir 75 Mio. überweisen werden. Wie wir das darstellen, ist eine andere Frage. Es geht um eine
hohe Summe, und es ist schwierig, sie aufzubringen. Aber ich stehe zu dieser Lösung, die die OeNB auch selbst so
wollte.
STANDARD: Den Euro gibt es nun seit mehr als drei Jahren. Mangelndes Gefühl dafür soll ein Grund für die hohe Privatverschuldung sein. Wie sehen Sie das?
Liebscher: Ich kann mir vorstellen, dass es bei den kleineren Werteinheiten noch Probleme gibt. Drei, vier oder zehn Euro klingt vielleicht wenig, ist inhaltlich aber viel. Das wird beim Geldausgeben vielleicht unterschätzt.
STANDARD: Hatten Sie je Probleme mit dem Euro?
Liebscher: Nein. Der beste Weg ist immer noch der
Vergleich: Ich gehe auch einkaufen, und wenn ich ein Zahnbürstel kaufe, schaue ich mir die Preise an. Wenn das eine 2,79 Euro kostet und das andere 1,99, überlege ich mir, warum es den Preisunterschied gibt. Ich habe das im Schilling auch so gemacht. Ich führe ein praktisches Leben. (DER STANDARD, Print-Ausgabe, 11.5.2005)
2) Wolford überrascht mit Gewinnwarnung - 2004/05 Verlust erwartet
(Standard 11.5.*) nach oben
Enttäusche Umsatzentwicklung im März und April - Gesamtjahr bescherte Minus von 2,4 Prozent - Flaues Geschäft in Fernost und der Schweiz
Wien - Der börsenotierte Strumpf- und Bodyhersteller Wolford hat am Mittwoch
überraschend eine Gewinnwarnung für das mit 30. April beendete Geschäftsjahr 2004/05 abgesetzt. Nach einem schwachen Schlussquartal wird nun unter dem Strich ein Verlust erwartet. An der Börse gab die Wolford-Aktie im heutigen Frühhandel um knapp 3 Prozent auf 16,90 Euro nach.
Noch vor knapp zwei Monaten hatte der Vorstand bei Bekanntgabe der Zahlen zu den ersten drei Quartalen, die ein Periodenergebnis von 1,09 Mio. Euro auswiesen und damit noch einen Gewinn, für das Gesamtjahr eine "Ergebnisverbesserung" in Aussicht gestellt. 2003/04 hatte Wolford ein positives Jahresergebnis von rund 860.000 Euro geschrieben.
Enttäuschende Umsatzentwicklung
Engültige Zahlen für das Jahr 2004/05 legt das Bregenzer Unternehmen am 21. Juli vor. Dass jetzt nach Steuern mit einem Jahresfehlbetrag gerechnet wird, begründete Wolford in einer Ad hoc-Information mit einer enttäuschenden Umsatzentwicklung in den beiden letzten Monaten März und April, höheren Kosten bei der strategischen Neuausrichtung des Konzerns sowie Sondereffekten (etwa durch die Verringerung des latenten Steuerguthabens durch den neuen Körperschaftssteuersatz von 25 Prozent).
Der Gruppenumsatz sank 2004/05 nach vorläufigen Zahlen um 2,4 Prozent von 119,2 auf 116,3 Mio. Euro; damit jedoch weniger stark als noch im Vorjahr mit minus 7,4 Prozent, wie vom Unternehmen dazu angemerkt wurde. Als Hauptgründe für den Umsatzrückgang nannte Wolford neben dem schwachen Dollar, auf den rund ein Drittel des gesamten Umsatzverlusts zurückzuführen sei, deutlich geringere Umsätze im Private Label Geschäft (-24 Prozent).
Markengeschäft mit leichtem Minus
Das Markengeschäft mit 96 Prozent Anteil am Gesamtumsatz habe sich 2004/05 mit einem "unterdurchschnittlichen" Minus von 1,4 Prozent etwas besser entwickelt, teilte Wolford weiter mit.
Bedingt durch eine groß angelegte Neuordnung des Vertriebs und damit einhergehenden Schließungen von Niederlassungen und Verkaufsstellen sei es in den Fernostmärkten (Japan, Hongkong, Korea, Australien) zu einer Halbierung des Umsatzvolumens gekommen. In der Schweiz musste Wolford ein Minus von 18 Prozent hinnehmen.
Weiterhin positiv lief das Geschäft in Skandinavien (+16 Prozent), CEE (+14 Prozent), Großbritannien (+7 Prozent), Österreich (+6 Prozent), Niederlande (+6 Prozent), Italien (+2 Prozent) und Frankreich (+2 Prozent). Per Ende des Geschäftsjahres verfügte die Gruppe über insgesamt 227 (2003/04: 226) Boutiquen.
Deutschland-Umsatz erholt sich
In Deutschland, einem der Hauptmärkte von Wolford, seien die Umsätze 2004/05 - nach mehreren Geschäftsjahren mit zweistelligen Rückgängen - zwar noch marginal gesunken. Im dritten und vierten Quartal habe es aber bereits jeweils ein Umsatzplus (im Vergleich zu den Vorjahresquartalen) gegeben.
Den sechsprozentigen Umsatzrückgang in den USA führt das Unternehmen ausschließlich auf die Dollar-Schwäche (im Verhältnis zur Konzernwährung Euro) zurück. Bereinigt um Währungseffekte errechne sich für den US-Markt ein leichter Umsatzzuwachs.
"2004/05 stand gänzlich im Zeichen der Neuausrichtung des Unternehmens", schreibt Wolford in seiner heutigen Pressemitteilung. "Da dieser Prozess bereits weit gediehen ist, lassen sich positive Effekte für das am 1. Mai begonnene neue Geschäftsjahr erwarten." (APA)
3) Österreich AG bremst sich ein (Standard
11./12.5.) nach oben
Erhoffte Konjunkturerholung verlangsamt sich, insbesondere die Inlandsnachfrage kommt nicht vom Fleck - Mit Infografik
Im internationalen Standortvergleich rutscht Österreich mehrere Plätze ab.
Wien - Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo)
hat am Mittwoch mit einer Art Gewinnwarnung für die Österreich AG aufhorchen
lassen. Die noch im April prognostizierte Konjunkturerholung verlangsame sich. Zwar entwickelten sich die Sachgüterproduktion und die Exporte "noch recht günstig", doch die Inlandsnachfrage kommt sinngemäß nicht vom Fleck.
Die Inflation von 2,9 Prozent - höher als die durchschnittlichen Bruttolohnsteigerungen - drückt spürbar auf die
Kaufkraft. Die derzeitigen Einzelhandelsumsätze seien angesichts der Einkommenseffekte aus der Steuerreform
"enttäuschend". Der Wirtschaftspolitik in der Eurozone gelinge es nicht, einen Konjunkturaufschwung
herbeizuführen, so das Fazit von Wifo-Ökonom Ewald Walterskirchen.
Für IHS-Chef Bernhard Felderer kommen die negativen Konjunkturnachrichten "nicht
überraschend". Es sei klar gewesen, dass die Erholung erst in der zweiten Jahreshälfte einsetzen
werde. "Wir leben in unsicheren Zeiten. Das
Hauptproblem sind die vorsichtigen Konsumenten, die insbesondere bei langfristigen Konsumgütern
sparen", so Felderer.
Marianne Kager, Chefvolkswirtin der Bank Austria-Creditanstalt meinte: "Wir fühlen uns durch die Revision der Konjunktur in unseren Annahmen bestätigt. Wir erwarten schon länger nur ein Wachstum von 1,7 Prozent." Das
Wifo wollte zum jetzigen Zeitpunkt die Prognose nicht zurücknehmen, offiziell erwartet das Institut noch immer 2,2 Prozent Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. Die nächste Prognoserevision machen Wifo und IHS am 1. Juli.
Schlechtere Wettbewerbsfähigkeit
Zeitgleich mit den konjunkturellen Hiobsbotschaften veröffentlichte das renommierte
Lausanner Institut für Management-Entwicklung
(IMD) den "Competitiveness Report 2005". Verglichen werden in dem Ranking insgesamt 60 Länder und Regionen anhand von 314 Kriterien, die allesamt Auskunft über das wirtschaftliche "Umfeld" geben sollen, in denen Unternehmen in einem Land arbeiten
können.
Österreich verliert in diesem Standortvergleich mehrere Plätze und fällt vom hart erkämpften 13. auf den 17. Rang zurück (siehe Grafik links).
Österreich liegt zwar noch knapp vor Bayern (Rang 18), fällt aber wieder hinter die Schweiz zurück, die sich vom 14. auf den 8. Rang deutlich verbessern
konnte. In das Ranking fließen zum Großteil Fakten aus den Oberkategorien Konjunkturentwicklung, wirtschaftliche/politische Effizienz und Infrastruktur ein, aber auch Managermeinungen werden berücksichtigt.
Geschätzt werden die Gesundheitsversorgung sowie die intakte Umwelt
Österreichs. Zudem findet die Entwicklung des Außenhandels, der Wiener Börse sowie die Effizienz der Klein-und Mittelbetriebe positive Erwähnung. Punkten kann Österreich auch mit seinem
Justizsystem und der Sicherheit. Ein schlechtes Zeugnis stellt das IMD Österreich unter anderem bei der
Steuerbelastung, der überdurchschnittlich hohen Sozialbeiträge, der restriktiven Einwanderungsgesetze sowie den vergleichsweise hohen Kosten für Strom und
Internet aus. Schlecht schneidet Österreich auch wegen des relativ schwachen Beschäftigungswachstums ab. (Michael Bachner, DER STANDARD, Print-Ausgabe, 12.5.2005)
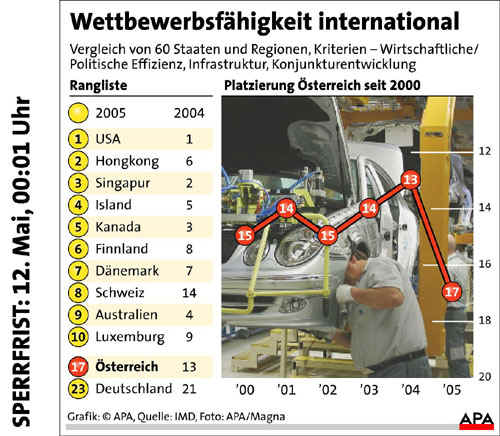
4) Wienerwald Restaurants Österreich verkauft (Standard 7.5.*) nach
oben
Franz Kainz Ges.m.b.H. neuer Eigentümer - Sanierung "nachhaltig und abgeschlossen"
Wien - Die Wienerwald Restaurant GmbH hat einen neuen Eigentümer. Die Franz Kainz Ges.m.b.H habe bereits am Mittwoch
100 Prozent der Anteile von der Ziegler Beteiligungs GmbH erworben, teilte die Ziegler Beteiligungs GmbH in Maria Lanzendorf am Samstag mit. Die
Markenrechte besitze die Ziegler Beteiligungs GmbH, die Wienerwald Restaurant GmbH erhalte einen langfristigen Lizenzvertrag, heißt es in der
Aussendung.
Als ehemaliger Eigentümer und Geschäftsführer betrachte er die Sanierung von Wienerwald Österreich "als nachhaltig und
abgeschlossen", so Christian Ziegler in der Pressemitteilung. Die Ziegler Beteiligungs GmbH werde "in den kommenden Jahren den
Aufbau und die Etablierung der Marke Wienerwald in den Oststaaten der EU und Südtirol als vorrangiges Unternehmensziel
betrachten." Weiters werde "ein Kompetenz- und Controlling Center mit angeschlossener Ideenwerkstatt für moderne Gastronomie mit Sitz in Wien eröffnet."
Die Wienerwald Restaurant GmbH unterhielt nach eigenen Angaben per 31. Dezember 2004 21 "Wienerwald" Restaurants, zwei Hotels sowie "Chilinos Bar &
Restaurant". 2004 seien keine Wienerwald Restaurants eröffnet oder geschlossen worden. Die Umsätze sanken 2004 im Vergleich zum Jahr davor von 19,23 Millionen Euro auf 17,93 Millionen
Euro. (APA)
5) FP-Politiker finanziert Wienerwald-Deal
(10./11.5.*) nach oben
Ehemaliger Parlamentarier und "Club Jörg"-Gründer Harald Fischl übernahm Finanzierung -
Kooperation mit privater Pflegeheim-Gruppe
Wien/Fürstenfeld - Hinter der Übernahme der Wienerwald-Restaurantkette Österreich durch die Franz Kainz GmbH steht ein in der österreichischen Innenpolitik nicht ganz unbekannter Investor: Harald Fischl, ehemaliger FPÖ-Parlamentarier und Gründer des "Club Jörg" übernahm die Finanzierung der Übernahme.
Fischl bestätigte am Dienstag im Gespräch mit dem STANDARD, dass er federführend bei diesem Deal engagiert sei. Hintergrund seines Investments seien die möglichen Synergien zwischen der Wienerwald-Kette und seiner Kräutergarten GmbH. Der Expolitiker betreibt mit Gerhard Moser, Sohn des ehemaligen Bautenministers Moser und Exchef der steirischen Krankenanstalten, private Pflegeheime mit Firmensitz im steirischen Fürstenfeld.
Gegenwärtig sind sechs Kräutergarten-Heime in Betrieb, nach Auskunft Fischls sollen in den nächsten zwei Jahren drei weitere hinzukommen. Mittelfristig rechnet Fischl mit einem Volumen von rund 1000 Betten, 750 Mitarbeitern - zurzeit sind es 400 - sowie 25 bis 30 Millionen Euro Umsatz.
Synergien sollen genutzt werden
Mit dem Einstieg in die Wienerwald-Kette sollen in erster Linie Synergien in den Bereichen Food & Beverages, Logistik bis hin zur Wäscherei genutzt werden. Fischl: "Ich hab vorerst einmal ermöglicht, dass der Kauf überhaupt zustande kommt, das bedeutet aber nicht, dass wir ständig beteiligt bleiben. Wir werden uns, wenn die Wienerwald-Gruppe wieder läuft, zurückziehen und nur noch in den Teilbereichen, die für unsere Gruppe von Interesse sind, in Kooperation bleiben." Auch die Wienerwald-Hotels sollen künftig von der Kräutergarten-Gruppe gemanagt werden. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.
Der Gastronomieberater und ehemalige Gastroverantwortliche der Casinos Austria, Franz Kainz, hat die 21 Gaststätten und zwei Hotels von der Ziegler Beteiligungs GmbH übernommen. 2004 verbuchte Wienerwald ein Umsatzminus von 1,3 Millionen und hält jetzt bei knapp 18 Millionen Euro und 370 Mitarbeitern. (Walter Müller, DER STANDARD, Print-Ausgabe, 11.5.2005)
6) General Motors ruft erneut 300.000 Autos zurück
(Standard 11.5.*) nach oben
Bereits zweite Rückruf-Aktion innerhalb weniger Wochen
Link: General Motors
Washington - Die Pannenserie beim weltgrößten Autobauer General Motors (GM) reißt nicht ab. Wegen
Problemen mit den Blinkern rief der amerikanische Autokonzern mehr als 300.000 Lastwagen und Geländewagen aus amerikanischen Baureihen zurück. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich um 286.478 Fahrzeuge in den USA und 19.195 in Mexiko, Kanada sowie anderen Exportmärkten.
Für GM ist dies bereits die zweite Rückrufaktion innerhalb weniger
Wochen. Erst Ende April hatte der Autobauer
mehr als zwei Mrd. Autos wegen Problemen mit den Sicherheitsgurten in die Werkstätten
zurückgerufen. Von der Rückrufaktion betroffen waren vor allem Gelände- und Kleinlastwagen. Anlass waren Probleme, die GM zufolge in sechs Fällen zu leichten Verletzungen geführt hatten. (APA/AP)
7) "Berlusconi-Status überschritten" (Standard
12.5.) nach oben
Geplante Schüssel-Ansprache: Redakteure wenden sich gegen ORF-Führung - Opposition empört - Anstalt: "Ereignis ist einzigartig"
.............................................
ORF-Redakteursrat im Wortlaut
"Wer immer veranlasst hat, dass der ORF Bundeskanzler Schüssel Sendezeit für eine Rede an die Nation zur Verfügung stellt: das ist eine fatale Fehlentscheidung. Vor allem, weil nichts die Existenzgrundlagen des ORF mehr gefährdet, als der Eindruck staatsnah und parteipolitischen Wünschen gegenüber willfährig zu sein. Und dieser Eindruck entsteht zwangsläufig, wenn sich der ORF Politikern als Bühne für Auftritte bietet, statt nach den üblichen journalistischen Kriterien über Auftritte unabhängig zu berichten."
.............................................
Die für 14. Mai um 19.50 Uhr in beiden Programmen des ORF angesetzte Rede von Bundeskanzler und ÖVP-Parteiobmann Wolfgang Schüssel sorgt weiterhin für Unmut.
"Wir haben den Berlusconi-Status überschritten und befinden uns im
Chavez-Stadium", spielt der grüne Stiftungsrat Pius Strobl
auf die restriktive Medienpolitik in Italien und Venezuela an und spricht von einer "Unglaublichkeit". Strobl will eine Sondersitzung im Stiftungsrat einberufen, er braucht die Zustimmung von zwölf der 35 Stiftungsräte, was einem Drittel entspricht.
"Einzigartig"
Bisher war es nur dem über Parteigrenzen stehenden Bundespräsidenten vorbehalten, sich zu wenigen wichtigen Anlässen direkt an die Bevölkerung zu wenden. "Dieses Ereignis ist
einzigartig", beteuert indes der ORF.
Das ORF-Gesetz sehe dergleichen nicht vor, meint Strobl. Es erlaube "Aufrufe" von Behörden nur "in Krisen-und Katastrophenfällen." Beides sei hier klar nicht der Fall, beanstandet Strobl.
In einem offenen Brief will Strobl nun von ORF-Chefredakteur Werner Mück wissen, welche Schritte die anderen Parlamentsparteien unternehmen müssten, "damit Reden ihrer Parteiobmänner zur 'Lage der Nation' ebenfalls ausgestrahlt werden".
Schüssel-Festspiele
Mück gerät zusehends unter Druck, die SPÖ stößt ins selbe Horn: Mück sei "Intendant für Schüssel-Festspiele auf der
ORF-Bühne", kritisierte Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos. Generaldirektorin Linder stellt sich hinter ihren Chefredakteur: "Er hat mein volles Vertrauen." Die Kanzler-Rede im ORF kommentierte sie vorerst nicht. Das tat der
Redakteursrat: Nichts gefährde "die Existenzgrundlagen des ORF mehr, als der Eindruck staatsnah und parteipolitischen Wünschen gegenüber willfährig zu sein".
Scharfe Worte fand Grünen-Chef Alexander Van der Bellen Mittwoch im Nationalrat, der ORF übertrug live:
ORF-Manager würden sich zunehmend "nicht an journalistischen Qualitätskriterien, sondern an bestimmten parteipolitischen Gesichtspunkten" orientieren.
"Kein Übereinkommen"
Nicht konkret dazu äußern will sich der Bundespräsident. Dabei handele es sich um eine Angelegenheit des ORF, meinte dessen Sprecher Bruno Aigner auf Anfrage. Gerüchten, wonach es Absprachen mit Fischer gegeben habe, tritt Aigner vehement entgegen: "Der Bundespräsident trifft keine Übereinkommen bezüglich ORF-Sendungen - auch nicht mit dem Bundeskanzler." (Doris Priesching/DER STANDARD; Printausgabe, 12.5.2005)
vgl. auch Die
Zukunft des ORF (Standard-Ressort); ORF-Reform
(Standard-Ressort); Medien
(Standard-Ressort)
8) Vereinbarungen des "Job-Gipfels" sind fraglich (HB
11.5.*) nach oben
Mehrheit für Steuerpläne wackelt
Man konnte sich schon verdutzt die Augen reiben, in welchem Tempo die Bundesregierung die Steuervereinbarungen des „Job- Gipfels“ in Gesetzentwürfe goss. Angesichts der festgefahrenen Verhandlungen mit der Union hatte Finanzminister Hans Eichel (SPD) die Initiative ergriffen für die Senkung des Körperschaftsteuersatzes und eine Erbschaftsteuerreform.
HB BERLIN. Schließlich hatten SPD und Grüne vor dem 20-Punkte-Programm des Kanzlers und vor dem „Job-Gipfel“ mit der Union ihre Zustimmung gegeben. Die Mehrheit des Regierungslagers schien sicher, die Union galt als Blockierer. Nun wackelt die Regierungsmehrheit mächtig, das ganze Projekt ist sogar fraglich.
Denn inzwischen bewegt die von der SPD-Spitze ausgelöste Kapitalismus-Kritik das Land, drohen neue Steuerausfälle in Milliardenhöhe und eine rot-grüne Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen am 22. Mai. Genug Gründe also für die Kritiker in den Koalitionsreihen, die zunächst für diesen Freitag geplante Bundestagsdebatte über die Firmensteuern erst einmal zu vertagen und so den internen Streit noch ein paar Tage unter dem Deckel zu halten. Auf Wunsch der Grünen, wie es heißt, aber sicher auch zur Freude etlicher SPD-Abgeordneter.
Schon vor Tagen hatten SPD-Linke moniert, dass die Entlastung mittelständischer Familienbetriebe bei der Erbschaftsteuer zu unausgewogen sei. Denn große Privatvermögen würden nicht stärker belastet, obwohl dies ein SPD-Parteitag 2003 beschlossen habe. Und die Grünen bezweifeln, dass Eichels Konzept zur Finanzierung der Körperschaftsteuersenkung von 25 auf 19 % reicht. Hier müssen Steuerausfälle von 5,2 Mrd. € kompensiert werden. Seit Wochen dringen sie darauf, auch Steuerschlupflöcher bei der Verlagerung von Unternehmen ins Ausland zu stopfen. Zudem seien beide Gesetzentwürfe an den Fraktionen vorbei beschlossen worden.
Die Grünen hatten den Verzicht auf das Einbringen der Steuerpläne in den Bundestag noch in dieser Woche als rein techische Entscheidung bezeichnet. In Koalitionskreisen hieß es, das wahre Motiv der Grünen seien Bedenken gegen die geplanten Nachlässe der Erbschaftsteuer und gegen die Gegenfinanzierung für die Senkung der Körperschaftsteuer.
Womöglich zeigt auch die Lobby-Arbeit der Windkraft-Fondsmanager bei so manchem Grünen-Abgeordneten Wirkung. Das wird jedenfalls im SPD-Lager gemunkelt. Denn Eichel - hier ist er sich auch mit der Union einig - will reine Steuersparfonds trocken legen, die von Anlegern nur wegen der Dauerverluste genutzt werden. Davon sind neben Medien- und Wertpapierfonds auch Neue-Energien-Fonds betroffen. Seit Wochen werden Abgeordnete daher von der Windkraft-Lobby „bearbeitet“.
Reichlich Konfliktpotenzial also und alles andere als günstig für eine Parlamentsdebatte über „Steuergeschenke“ einen Tag nach Bekanntgabe neuer Milliarden-Steuerausfälle. Das Finanzministerium, das von der Entscheidung der Fraktionsspitzen überrascht worden war, ist verärgert über die Verzögerung. SPD und Grüne spielen den Vorgang herunter und versichern: „Wir liegen voll im Zeitplan“, die Gesetze könnten wie geplant bis zur Sommerpause verabschiedet werden.
Ob es wirklich nur bei einer zweiwöchigen Verzögerung bleibt, ist offen. Die Union, bisher selbst uneins und als der Bremser angeprangert, kann nun frohlocken und der Koalition Handlungsunfähigkeit vorwerfen. Vom Tisch ist die Steuerdebatte an diesem Freitag im Bundestag ohnehin nicht. Denn die Union hat entsprechende Anträge auf die Tagesordnung gesetzt. Dazu werden sich auch SPD und Grüne äußern müssen - trotz vertagter eigener Anträge.
Kritische Aussagen einzelner SPD-Abgeordneter zu den Plänen tat der Parlamnentarische Geschäftsführer der SPD, Wilhelm Schmidt, als Versuch ab, sich in der Öffentlichkeit zu profilieren. So hatte der SPD-Abgeordnete Hans-Peter Bartels inder „Berliner Zeitung“ gefordert, die Körperschaftsteuer nicht so weit wie geplant zu senken. An anderer Stelle der Koalition hieß es, angesichts der von der Steuerschätzung am Donnerstag zu erwartenden milliardenschweren Ausfälle sei es nicht opportun, am Freitag über Steuersenkungen für Unternehmen zu debattieren.
HANDELSBLATT, Mittwoch, 11. Mai 2005, 16:10 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1035641
9) CDU-Finanzminister Stratthaus wirkt auf Union ein (HB
11.5.*) nach oben
Front gegen rot-grünes Steuergesetz bröckelt
In der Union bröckelt die Front gegen den Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Hans Eichel (SPD), mit dem die Körperschaftsteuer von 25 auf 19 Prozent gesenkt werden soll.
Der baden-württembergische Finanzminister Gerhard Stratthaus wirkt auf die Union ein.
dri BERLIN. „Wir müssen die Senkung durchziehen“, sagte Baden-Württembergs Finanzminister Gerhard Stratthaus (CDU) dem Handelsblatt. „Wenn sie jetzt scheitert, wäre die Enttäuschung in der Wirtschaft ein weiterer Belastungsfaktor für die Stimmung in Deutschland.“
Bisher lehnen CDU und CSU, die im Bundesrat zustimmen müssen, das vom Bundeskabinett beschlossene Gesetz mit der Begründung ab, dass die Gegenfinanzierung nicht ausreiche. Prinzipiell hatten sich Kanzler Gerhard Schröder und die Unionsspitzen auf ihrem Jobgipfel im März auf die Reform verständigt, die auch eine stärkere Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer von Personenunternehmen vorsieht. Heute wird die Finanzministerkonferenz von Bund und Ländern darüber beraten.
Stratthaus plädierte gestern Abend im Kreis der Länderfinanzminister dafür, dem Gesetz zuzustimmen. Bedingung sei aber, dass Eichel bei seinen Gegenfinanzierungsvorschlägen die geplante Erhöhung der Mindestgewinnbesteuerung von 40 auf 50 Prozent streicht, die 250 Mill. Euro bringen soll. Falls Eichel keine 100-prozentige Gegenfinanzierung erreiche, könnte dies das positive Signal an die Unternehmer verstärken. „Es geht um Jobs, und die bekommen wir nur durch zusätzliches Wachstum“, sagte er.
Die Union hatte bisher als Gegenfinanzierung der 5,3 Mrd. Euro teuren Steuersenkung akzeptiert, dass Eichel Steuersparfonds austrocknen und darüber 2,5 Mrd. Euro einnehmen will. Umstritten ist vor allem die Frage, wie stark sich Unternehmen durch die Steuersenkung überzeugen lassen, ihre Gewinne wieder in Deutschland zu versteuern. Eichel erwartet aus dieser Verhaltensänderung 2,2 Mrd. Euro Einnahmen, die Union lediglich 500 Mill. Euro. „Natürlich kann man sich über die Summen streiten“, meinte Stratthaus. „Ich kann mir aber vorstellen, dass dies einiges an Steuermehreinnahmen bringen kann.“
Auch bei der auf dem Jobgipfel ebenfalls beschlossenen Erbschaftsteuerbefreiung für Mittelständler fordert Stratthaus von den eigenen Leuten, neu nachzudenken. „Der Erlass der Steuerschuld über zehn Jahre macht das Erbschaftsteuerrecht sehr kompliziert“, sagte er. Er plädiere daher für einen Freibetrag von 30 bis 50 Mill. Euro auf Betriebsvermögen, der ebenfalls über zehn Jahre gestaffelt werden könnte.
HANDELSBLATT, Mittwoch, 11. Mai 2005, 19:15 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1035800
10) Entsendegesetz, Wegebau-Beschleunigung und Rußfilter-Förderung beschlossen
(HB 11.5.) nach oben
Beschluss-Marathon im Kabinett
Im Kampf gegen extreme Niedriglöhne hat die Bundesregierung die Ausweitung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes auf alle Branchen beschlossen. Zudem wurde ein Gesetzentwurf von Verkehrsminister Manfred Stolpe zur Planungs-Beschleunigung von 86 wichtigen Verkehrsprojekten und die steuerliche Förderung von Rußfiltern auf den Weg gebracht.
HB BERLIN. Mit dem vom Kabinett gebilligten Gesetzentwurf zur Ausweitung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes wird die Beschränkung der Regelung auf den Baubereich gestrichen. Damit gelten tarifvertraglich vereinbarte Mindestlöhne einer Branche auch für Arbeitnehmer, die von ausländischen Arbeitgebern entsandt werden. Bundestag und Bundesrat müssen dem Gesetz allerdings noch zustimmen. Die Union hat bereits angekündigt, dass sie eine pauschale Ausweitung im Bundesrat stoppen werde.
Die Regelung greift nur, wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften bundesweite Tarifverträge schließen und diese vom Staat für allgemein verbindlich erklärt werden. Nach Einschätzung des gewerkschaftsnahen Forschungsinstituts WSI dürfte das Gesetz daher in seiner Wirkung begrenzt sein. Die führenden Verbände der Wirtschaft lehnen das Vorhaben dennoch ab, weil sie die Einführung von Mindestlöhnen durch die Hintertür fürchten. Wirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD) trat diesen Bedenken entgegen: „Das ist etwas anderes und besser als ein gesetzlicher Mindestlohn.“ Praktische Folgen hat das Gesetz vorerst nur für das Gebäudereinigerhandwerk. Nur dort gibt es einen bundesweiten Lohntarifvertrag, der schon für allgemein gültig erklärt wurde.
Verbesserung der Zuverdienstmöglichkeiten
Das Kabinett billigte auch die geplante Verbesserung der Zuverdienstmöglichkeiten für Bezieher von Arbeitslosengeld II. SPD und Grüne hatten den Entwurf für das so genannte Freibetragsneuregelungsgesetz am Dienstag beschlossen und in den Bundestag eingebracht. Wie mit der Union vereinbart, soll es künftig einen Grundfreibetrag von 100 € geben, bis zu dem ein Zuverdienst etwa durch einen Mini-Job nicht vom Arbeitslosengeld II abgezogen wird. Von dem Bruttoeinkommen zwischen 100 und 800 € bleiben monatlich 20 % anrechnungsfrei. Bislang werden bis 400 € nur 15 % nicht angerechnet.
Die Neuregelung soll zum 1. Oktober in Kraft treten. Für Bund und Kommunen bedeutet sie unter dem Strich Mehrkosten von 160 Mill. €, wie aus dem Gesetzesentwurf hervorgeht. Regierung und Union versprechen sich von der beim Job-Gipfel vereinbarten Neuregelung höhere Anreize zur Arbeitsaufnahme.
Die auf den Weg gebrachte Ausweitung des Entsendegesetzes wird nach Einschätzung des WSI-Instituts der Hans-Böckler-Stiftung in der Wirkung begrenzt sein. „Der Ansatz geht in die richtige Richtung, um Mindestlöhne abzusichern. Doch damit er wirklich greifen kann, müssten große Lücken in der Tariflandschaft geschlossen werden“, erklärte der WSI-Tarifexperte Reinhard Bispinck. Nur in sechs von 40 vom WSI untersuchten Wirtschaftszweigen bestünden praktisch bundesweit geltende Tarifverträge: bei Banken, Versicherungen, Dachdeckern, Malern, im Bauhauptgewerbe sowie im Garten- und Landschaftsbau.
Die Gebäudereinigerbranche will direkt nach In-Kraft-Treten des Gesetzes einen De-facto-Mindestlohn einführen. Das hatte der Innungsverband der Gebäudereiniger bereits vor zwei Wochen angekündigt. Der Verband zählt rund 2600 Mitgliedsfirmen mit etwa 720 000 Mitarbeitern.
Kabinett beschließt steuerliche Förderung von Rußfiltern
Der Einbau von Rußfiltern in neue und gebrauchte Diesel-Pkw soll nach einem Beschluss des Bundeskabinetts steuerlich gefördert werden. Damit will die Regierung den Ausstoß von gesundheitsschädlichen Rußpartikeln durch solche Fahrzeuge deutlich senken.
Der am Mittwoch vom Kabinett verabschiedete Gesetzentwurf sieht vor, dass Halter von Altfahrzeugen ab 2006 befristet in Höhe von 250 € von der Kraftfahrzeugsteuer freigestellt werden, wenn sie ihre Autos mit Rußfiltern nachrüsten. Für neue Diesel-Pkw, die einen Partikelgrenzwert von fünf Milligramm pro Kilometer einhalten, soll die Förderung 350 € betragen. Neue Diesel-Pkw, die ab 2008 auf den Markt kommen und diesen Grenzwert übersteigen, sollen mit einem Zuschlag von 20 % der Jahressteuer belastet werden.
Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne), die Automobilhersteller und der Automobilclub ADAC appellierten an die Länder, deren Zustimmung erforderlich ist, das Konzept des Bundes positiv aufzugreifen und für eine schnelle Umsetzung zu sorgen. „Da darf jetzt nichts auf die lange Bank geschoben werden“, sagte der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, Bernd Gottschalk, in Frankfurt. Der Finanzausschuss des Bundesrates wird sich am Donnerstag mit der Vorlage befassen.
Die Länder müssen der Neuregelung zustimmen, weil ihnen allein die Einnahmen der Kraftfahrzeugsteuer zustehen. Aus den Ländern hatte es Forderungen gegeben, nur Umrüstungen zu fördern. Im Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Hans Eichel (SPD) wird darauf nur allgemein mit dem Satz eingegangen: „Diskutiert werden andere Varianten der Förderung besonders partikelreduzierter Personenwagen wie „Bonus-Malus-Regelungen', Beschränkungen der Förderung auf Nachrüstfälle und Zuschüsse.“
Die Kosten der Steuerbegünstigung für die Länder veranschlagt das Finanzministerium auf jeweils 565 Mill. € in den Jahren 2006 und 2007. 2008 würde dieser Negativeffekt dann mit einem Minus von 30 Mill. € auslaufen, 2009 seien sogar minimale Mehreinnahmen zu erwarten.
Trittin sagte in Berlin, die Länder könnten angesichts des Trends der Autoverkäufe hin zum Diesel im Endeffekt mit Mehreinnahmen rechnen, da für Diesel eine höhere Kfz-Steuer anfalle. Mit der vom Kabinett vorschlagenen Regelung werde eine schnelle Markteinführung von Diesel-Pkw mit Rußfilter erreicht und somit ein schneller Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität. Seit Jahresbeginn gelten schärfere EU-Grenzwerte für Feinstaub, die in zahlreichen deutschen Großstädten schon überschritten wurden.
Beschleunigungsgesetz für Wegebau gebilligt
Die Bundesregierung will außerdem den Ausbau von Verkehrswegen beschleunigen, stößt aber mit ihrem am Mittwoch im Kabinett verabschiedeten Gesetzentwurf dazu auf Widerstand bei den Grünen.
Das Gesetz werde dazu beitragen, dass die Planung von Infrastrukturprojekten transparenter, schneller und effizienter werde, erklärte Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe in Berlin. „Damit ist ein wichtiger Beschluss zur Verbesserung des Wirtschaftsstandorts Deutschland gefasst worden.“ Das Gesetz sieht vor, bei Genehmigungsverfahren künftig nur noch eine Klageinstanz beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zuzulassen. Derzeit gilt das Beschleunigungsgesetz nur für Ostdeutschland. Es läuft zudem am Ende des Jahres aus. Stolpe will es im Kern auf das gesamte Bundesgebiet ausdehnen.
Mit dem neuen Gesetz können nach den Worten des Ministers wichtige Bauvorhaben um rund zwei Jahre beschleunigt werden. „Das ist ein großer Zeitgewinn, der allen zugute kommt. Damit können wir die guten Erfahrungen, die wir in den vergangenen Jahren im Osten gemacht haben, nun in ganz Deutschland nutzen.“
Die Grünen sehen den Entwurf dagegen auch kritisch und fordern eine Korrektur im Parlament. Die Verkehrs- und Rechtsexperten der Grünen-Fraktion, Albert Schmidt und Jerzy Montag, erklärten, die Einschränkung der Klagerechte trage nicht zur Planungsbeschleunigung bei. Diese Kritik werde auch vom Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts, Eckardt Hien, und den Präsidenten der Verwaltungsgerichte in den unteren Instanzen geteilt. Wenn die Regierung hier gegen den Rat der Gerichte handle, könne sie nicht erwarten, dass der Gesetzgeber das mit trage. „Hier ist der Deutsche Bundestag als Korrekturinstanz gefordert“, erklärten Schmidt und Montag.
Das Baugewerbe warf den Grünen dagegen vor, mit ihrer Haltung die Umsetzung notwendiger Maßnahmen zu behindern. Es sei offensichtlich, dass diese Investitionen dringend benötigt würden, sagte der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB), Arndt Frauenrath, in Berlin.
HANDELSBLATT, Mittwoch, 11. Mai 2005, 16:30 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1035676
11) Rücklagen fallen auf historischen Tiefstand (HB
11.5.*)
Eichel muss die Rente sichern
Von Karl Doemens
Die anhaltende Misere am Arbeitsmarkt belastet die Rentenkassen deutlich stärker als bislang von der Bundesregierung erwartet.
HB BERLIN. Nach Angaben des Bundesversicherungsamtes sind die Rücklagen der Alterskassen, die zum Jahresanfang noch fünf Mrd. Euro ausmachten, im April auf 1,5 Mrd. Euro oder neun Prozent der Monatsausgaben geschrumpft. Dies ist ein
historischer Tiefstand. Damit haben die Rentenversicherungen kaum noch Spielraum, um kurzfristige Liquiditätsengpässe auszugleichen. Spätestens im September werde Finanzminister Hans Eichel (SPD) den fälligen Bundeszuschuss vorzeitig überweisen müssen, bestätigte der Parlamentarische Staatssekretär Franz Thönnes (SPD) am Mittwoch.
Erstmals bezifferte Thönnes auch das voraussichtliche Loch in den Rentenkassen.
Nach den aktuellen Zahlen des Schätzerkreises würden in diesem Jahr 1,5 Mrd. Euro und im nächsten Jahr weitere 3,5 Mrd. Euro
fehlen. Rechnerisch müsste daher der Beitragssatz zum Jahreswechsel von derzeit 19,5 auf 20,0 Prozent angehoben werden.
Dies will die Bundesregierung jedoch unter allen Umständen verhindern. Sozialministerin Ulla Schmidt (SPD) greift deshalb zu einem
Buchungstrick: Nach ihren Plänen müssen die Arbeitgeber vom nächsten Jahr an die Sozialbeiträge zwei Wochen früher als bisher überweisen. Faktisch erhalten die
Rentenkassen 2006 wegen der Umstellung einmalig 13
Monatsbeiträge.
Vertreter der Opposition kritisierten diese Notoperation im Bundestag gestern scharf. Es drohe nicht nur ein
bedenklicher Liquiditätsentzug für die Wirtschaft, monierte der CDU-Abgeordnete Andreas Storm. Vielmehr bringe die Umstellung auch eine „erhebliche Belastung“ für Länder und Kommunen, die alleine etwa 2,5 Mrd. Euro aufbringen müssen. Storm warf der Regierung eine „Politik der verbrannten Erde“ vor: Jahrelang seien die Rentenkassen systematisch unterfinanziert worden. Trotz des vorgezogenen Buchungstermins würden schon 2007 erneute Engpässe in den Rentenkassen drohen.
Ministerin Schmidt räumte ein, dass die gesetzliche Rentenversicherung derzeit eine „schwierige Phase“ durchmache. Verantwortlich dafür sei die schleppende
Konjunktur. Nachdem Arbeitnehmer und Rentner jedoch schon Opfer zur Sicherung des Beitrags gebracht hätten, müssten nun auch die Unternehmer „das ihrige“
tun. Eine moderate Belastung der Betriebe mit den Finanzierungskosten von etwa 400 Mill. Euro sei auf jeden Fall besser als eine Beitragserhöhung, sagte auch Grünen-Expertin Biggi Bender.
Das Vorziehen des Zahlungstermins bringt den gesetzlichen Alterskassen laut Thönnes im Jahr 2006 einmalig einen zusätzlichen Betrag von 9,6 Mrd. Euro, weil sowohl der Beitrag für Dezember 2005 als auch für Dezember 2006 verbucht werden könne.
Das Geld haben die Rentenversicherer auch nötig: Nach den jüngsten Prognosen der Rentenschätzer wird die
Schwankungsrücklage zum Jahresende 2005 nur noch 1,8 Mrd. Euro beinhalten. Im Laufe des nächsten Jahres würde die
„eiserne Reserve“ auf etwa 1,1 Mrd. Euro abschmelzen.
Gesetzlich vorgeschrieben ist zum Jahresende jedoch ein Bestand von mindestens 3,2 Mrd.
Euro. Durch den Einmaleffekt will die Bundesregierung die Rücklagen im
Wahljahr 2006 nun kurzfristig auf 7,6 Mrd. Euro
aufblähen.
In ihren früheren Berechnungen hat die Regierung offenbar deutlich zu positive Wirtschaftsdaten
unterstellt. Dies war bereits vom Sozialbeirat und den Vertretern der Rentenkassen moniert worden. So unterstellte Schmidt noch im vergangenen November ein Beitragswachstum von 1,2 Prozent (2005) und 2,6 Prozent (2006). Inzwischen kalkulieren ihre Fachleute nach Informationen des Handelsblatts nur noch mit einem Plus von 0,2 und 0,9 Prozent. Der Grund: Im ersten Quartal waren die Beitragseinnahmen um insgesamt 1,4 Prozent hinter dem Vorjahr zurückgeblieben. Im April legte der Wert zwar erstmals um ein Prozent zu. Für den bisherigen Jahresverlauf errechnet sich kumuliert aber weiter ein Minus von 0,4 Prozent.
Ullas Trickkiste
Das Loch: Den Rentenkassen fehlen nach den Schätzungen der Regierung 2005 und 2006 rund fünf Mrd. Euro.
Das Problem: Eigentlich müsste in dieser Situation der Rentenbeitrag von 19,5 auf 20,0 Prozent angehoben werden. Dies will Rot-Grün unbedingt verhindern.
Der Trick: Sozialministerin Ulla Schmidt (SPD) dreht an mehreren Schrauben. Mehr finanziellen Spielraum in den einnahmeschwachen Monaten Oktober und November will sie den Rentenkassen durch ein Vorziehen der Bundeszuschüsse und spätere Überweisungen an die Krankenkassen verschaffen. Den Engpass 2006 will sie durch einen Einmaleffekt lösen: Die Arbeitgeber müssen künftig die Beiträge zwei Wochen früher zahlen.
HANDELSBLATT, Mittwoch, 11. Mai 2005, 19:30 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1035793
12) Dun & Bradstreet: Jedes dritte Unternehmen im Verzug
(HB 11.5.*) nach oben
Säumige Zahler gefährden Mittelstand
Deutschlands Mittelstand kämpft seit einigen Jahren mit der schlechten Zahlungsmoral seiner
Kunden. Auftraggeber, die für bereits erbrachte Leistungen nicht oder deutlich verspätet zahlen, bringen viele Unternehmen in akute Existenznot.
So schätzt der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, dass jede vierte Insolvenz auf schlechte Zahlungsmoral zurückzuführen
ist.
lü HB DÜSSELDORF. Dass vorerst keine Besserung in Sicht ist, zeigt eine aktuelle Untersuchung der Wirtschaftsauskunftei Dun & Bradstreet Deutschland (D&B) für das 1. Quartal 2005. Danach
begleicht jedes dritte Unternehmen seine Rechnungen mit
Verzug. Die Studie basiert auf einer jährlichen Auswertung von 330 Millionen Rechnungen. Mit Ausnahme der Telekommunikationsbranche sei in allen Wirtschaftszweigen der Anteil der pünktlichen Zahler deutlich zurückgegangen, berichtet D&B-Sprecherin Susanne Hagemann.
Besonders belastet sei der Sektor Transport und Verkehr. Gründe hierfür könnten die zu Jahresbeginn eingeführte LKW-Maut sowie der unvermindert hohe Ölpreis sein. Der Anteil der fristgerechten Zahler verringerte sich auf 59,8 (60,7) Prozent der untersuchten Rechnungen. Dagegen stieg in der Branche die Anzahl der
Zahlungssünder, die ihre Rechnungen erst mit einer Verspätung von 105 Tagen oder mehr
zahlen: Im März waren das immerhin 4,6 Prozent der untersuchten Rechnungen. Nur das
Handwerk (7,2 Prozent), das Baugewerbe (6,9 Prozent) und die Textilindustrie (5 Prozent) zahlen noch schlechter.
Die Folge der sinkenden Zahlungsmoral: Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geraten in Schwierigkeiten, weil sie immer häufiger teure Lieferantenkredite in Anspruch nehmen müssen. Das zeigt eine Studie der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG.
Für 60 Prozent der Unternehmen in Deutschland seien Forderungsausfälle ein bedrohliches
Risiko. Kommt noch die verschlechterte Zahlungsmoral hinzu, dann geraten auch bisher gesunde Unternehmen immer öfter in Liquiditätsengpässe.
Bei gut einem Viertel der Befragten beträgt der Forderungsausfall zwischen einem und zehn Prozent des
Jahresumsatzes. Fast jedes fünfte Kleinunternehmen gibt an, dass seine Liquidität durch Forderungsausfälle erheblich bis sehr stark beeinträchtigt wurde.
Das birgt ein hohes Risiko: Denn die Eigenkapitaldecke ist bei den meisten Klein- und Mittelbetrieben zu
dünn. Die Konsequenz: Die Wahrscheinlichkeit in die Insolvenzen zu rutschen steigt.
Auch der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) bezeichnet die Liquiditätssituation vieler Unternehmen als prekär. In seiner Frühjahrsumfrage beklagte die Mehrzahl der Inkasso-Unternehmen die unvermindert
schlechte Zahlungsmoral der Schuldner. Verantwortlich sei vor allem die hohe Arbeitslosigkeit und die Überschuldung vieler
Verbraucher. Mehr als drei Millionen Deutsche seien
überschuldet, berichtet der Verband. Über 1,1 Millionen Privatleute dürften in diesem Jahr mit einer eidesstattlichen Versicherung ihre Zahlungsunfähigkeit amtlich bekunden. „Eine dauerhafte Überschuldung der Verbraucher ist eine langfristige Gefahr für unsere Volkswirtschaft“, warnt BDIU-Präsident Stephan Jender. Um dem gegenzusteuern, müsse die Arbeitslosigkeit konsequenter bekämpft werden.
Zudem plädiert der Verband dafür, bereits in der Schule mit der Schuldenprävention zu
beginnen. Anlass für seine Forderung ist die Tatsache, dass immer mehr Jugendliche bedingt durch ihre hohen Handy-Rechnungen verschuldet sind. Viele junge Menschen wüssten zu wenig über Finanzfragen. „Der Umgang mit Geld in unserer Konsum- und Kreditgesellschaft und das Vermeiden von Schulden müssen fester Bestandteil der Lehrpläne werden“, fordert der Verband.
HANDELSBLATT, Mittwoch, 11. Mai 2005, 11:21 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1031512
13) Schlafforscher: Bürolicht lähmt die innere Uhr (HB
11.5.*)
dpa BERLIN. Menschen mit Bürojobs müssen sich über Schläfrigkeit nicht wundern - ihre innere Uhr erhält nach Einschätzung von Schlafforschern viel zu wenig Licht.
„Tageslicht ist der wichtigste Zeitgeber für die innere Uhr. Während uns ein sonniger Tag etwa 100 000 Lux beschert, sind es aber selbst in gut ausgeleuchten Büros nur 400 Lux“, sagte Schlafforscher Prof. Till Roenneberg (Ludwig-Maximilians-Universität-München) auf einem Experten-Kolloquium der Daimler-Benz-Stiftung am Mittwoch in Berlin.
Sogar wer bei Regen auf den Bus warte, bekomme damit noch 10 000 Lux und die innere Uhr damit Gelegenheit, sich der äußeren Zeit anzupassen, erklärte Roenneberg. Andernfalls hinke der in den Genen verankerte Zeitgeber hinterher, der auch Leistungs- und Ruhephasen steuert. Folgen einer dauerhaft „falsch“ tickenden Uhr können Schlafstörungen, Energielosigkeit oder sogar Depressionen sein.
Noch mehr als Büromenschen seien Schicht- und Nachtarbeiter von dem Lichtmangel betroffen. „Bei einem Versuch im VW Werk Wolfsburg leuchteten wir einen Teil der Halle mit immerhin 2000 Lux aus. Die Folge: Die Arbeiter waren von dem Licht so angezogen, dass sie sogar ihre Pausen nicht im gemütlichen Pausenraum, sondern unter den Lampen verbrachten“, sagt Roenneberg. Die Suche nach geeigneten Programmen, die innere Uhr umzustellen, stehe jedoch noch am Anfang.
HANDELSBLATT, Mittwoch, 11. Mai 2005, 13:20 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1035553
14) Positive Überraschung (n-tv 12.5.) nach oben
Stärkeres Wachstum
Die deutsche Wirtschaft ist allein dank eines kräftigen Schubs vom Export zu Anfang des Jahres so stark gewachsen wie seit vier Jahren nicht
mehr. Im ersten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) saison- und kalenderbereinigt um 1,0 Prozent zum Vorquartal
zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.
"Die wirtschaftliche Belebung im ersten Quartal 2005 im Vergleich zum vierten Quartal 2004 wurde ausschließlich vom Außenbeitrag getragen", erklärten die Statistiker.
Während die Exporte kräftig zulegten, seien die Importe
gesunken. Die gesamte Binnennachfrage war dagegen
rückläufig. Allerdings legten die Ausrüstungsinvestitionen sowie die Investitionen in sonstige Anlagen zu.
Von Reuters befragte Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent im Quartalsvergleich gerechnet, wobei selbst die optimistischste Prognose nur von einem Anstieg um 0,7 Prozent ausgegangen war.
Im Vergleich zum Vorjahr blieb die deutsche Wirtschaftsleistung dem Amt zufolge unverändert. Allerdings hatte
das erste Vierteljahr des laufenden Jahres zwei Arbeitstage weniger als im ersten Quartal
2004. Ohne diesen Kalendereffekt legte das BIP den Statistikern zufolge um gut ein Prozent zu.
Im vierten Quartal 2004 war die Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent geschrumpft. Allerdings hatten Experten darauf hingewiesen, dass die Saison- und Kalenderbereinigung die tatsächliche Konjunkturdynamik wegen der ungewöhnlich hohen Zahl an Arbeitstagen nicht richtig erfasst und das Wachstum unterzeichnet hatte.
Ein Teil des Zuwachses im ersten Vierteljahr gilt daher als Gegenbewegung zu diesem Statistikeffekt.
Details zur Wirtschaftsentwicklung will das Statistikamt
am 24. Mai veröffentlichen.
Nachdem die schlechte Stimmung bei Firmen und Verbrauchern die Furcht vor einem Abknicken der Konjunktur geschürt hatte,
sorgten gute Industrieaufträge und Exportdaten zuletzt für etwas
Erleichterung. So rechnet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) für das zweite Quartal mit einem Wachstum von 0,4 Prozent. Die meisten Ökonomen hielten bislang aber für das Gesamtjahr nur ein Wachstum von etwa einem dreiviertel Prozent für erreichbar.
15) Österreich: Grünes Licht für die EU-Verfassung (Standard
11.5.*) nach oben
Mit nur einer Gegenstimme beschloss das Parlament die Ratifizierung - Lediglich Barbara Rosenkranz stimmte dagegen
Von Samo Kobenter
Wien – Selten waren sich fast alle Abgeordneten des Nationalrates so einig wie in der europäischen Verfassungsfrage. Selten aber wurde eine einheitliche Haltung mit einem dermaßen offen eingestandenen Minimum an Begeisterung eingenommen: Die historische Stunde wurde im Parlament nicht zelebriert, sondern abgewickelt.
Also konnten die Redner aller Parteien das große Friedensprojekt EU loben und taten das auch ausgiebig und nach Maßgabe individueller oder im Parlamentsklub beschlossener Empathie. Der auf der Hand liegende Konnex zum Kriegsende und zum österreichischen Staatsvertrag wurde besonders von den Vertretern der ÖVP weidlich besprochen, jene der Oppositionsparteien konzentrierten sich vor allem auf die verpasste Chance, das große Vertragswerk einer gesamteuropäischen Volksabstimmung unterzogen zu haben. Bundeskanzler Wolfgang Schüssel erinnerte daran, sich stets für ein europäisches Referendum eingesetzt zu haben. Allerdings sei er mit dieser Forderung im EU-Rat allein geblieben, bedauerte der Kanzler. Insgesamt ebne die Verfassung jedoch den Weg für ein friedliches, soziales und demokratisches Europa: "Wir sind noch nicht am Ende dieses Prozesses angelangt, haben aber einen vorläufigen Höhepunkt erreicht."
SP-Chef Alfred Gusenbauer zeigte sich "froh, dass wir die Einigung erreicht haben". Er verwies aber auch auf die Skepsis, die viele Menschen gegen die EU entwickelt hätten und sah einen der Gründe dafür in der Tatsache, dass in den EU-Gremien der politische Wechsel nicht in der Form möglich wäre wie in den nationalen Parlamenten. Es gelte daher, einen Mechanismus zu finden, in dem "die Menschen ihre Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit der jeweiligen Politik zum Ausdruck bringen können".
Grünen-Chef Alexander Van der Bellen sah sich nach Abwägung der Vor- und Nachteile zu einem "klaren Ja" für die Verfassung bereit. Eine von vielen bekrittelte neoliberale Schlagseite könne er an der Verfassung nicht erkennen, meinte Van der Bellen und lobte insbesondere die Verankerung sozialer Grundrechte im Entwurf.
Ein Kompromiss
Der Regierung warf Van der Bellen eine völlig misslungene Informationspolitik vor. Für Vizekanzler Hubert Gorbach bringt die Verfassung mehr Demokratie und soziale Rechte: "Dass das auch ein Kompromiss ist, das ist klar."
In diesem Chor der Harmonie blieb es der FP-Abgeordneten Barbara Rosenkranz vorbehalten, einen Kontrapunkt zu setzen. Sie forderte die Durchführung einer Volksabstimmung, blitzte mit ihrem Antrag bei ihrem Parteikollegen und Nationalratspräsidenten Thomas Prinzhorn jedoch ab: Er wies den Antrag mit der Begründung zurück, dass eine Volksabstimmung über einen Staatsvertrag nicht zulässig sei. Darauf stimmte Rosenkranz als Einzige gegen die Ratifizierung.
Die Verfassung ersetzt die bisherigen EU-Verträge und bringt unter anderem eine Erweiterung der Kompetenzen der Union, mehr Rechte für das EU-Parlament, eine verstärkte Zusammenarbeit in allen Bereichen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie ab 2014 eine Verkleinerung der Kommission. Zudem wird das Amt eines ständigen Präsidenten des EU- Rates geschaffen. Mehrheitsentscheidungen im Rat werden (gegenüber einstimmigen Entscheidungen) ausgeweitet. (DER STANDARD, Printausgabe, 12.05.2005)
siehe auch Links - > Europa
(Verfassung im Wortlaut, Zusammenfassungen und Präsentationen der Verfassung)
ferner vgl. auch Kernpunkte
der EU-Verfassung (Standard); Kernpunkte
der EU-Verfassung (n-tv) ;
Die Europäische
Union und Österreich (Standard-Ressort)
16) Neuer Wirkstoff hält das Gehirn auf Trab (HB
11.5.*) nach oben
dpa LONDON. Ein neuer Wirkstoff kann die Hirnleistung steigern und auch Probanden unter Schlafentzug geistig hellwach halten. Das hat zumindest eine kleine Studie mit 16 Teilnehmern an der Universität von Surrey im britischen Guildford ergeben.
Das berichtet der „New Scientist“ in seiner Ausgabe vom nächsten Samstag. Julia Boyle und Kollegen verabreichten den 18 bis 45 Jahre alten männlichen Probanden unterschiedliche Mengen des Ampakins Cx717. Dabei zeigte sich, dass schon geringe Dosen wacher, leistungsfähiger und konzentrierter machten. Das Medikament könnte einmal Patienten mit Alzheimer, Narkolepsie (Schlafzwang) oder Aufmerksamkeitsstörungen (Adhs) helfen.
Die Testteilnehmer durften nicht schlafen und mussten in bestimmten Abständen wiederholt Aufgaben lösen. Dabei kontrollierten die Forscher unter anderem die Gehirnströme der Probanden. Testteilnehmer, die das Ampakin bekommen hatten, schnitten regelmäßig besser ab als solche, die ein wirkungsloses Scheinmedikament (Placebo) erhalten hatten. Nebenwirkungen, wie Nervosität oder Überspannung, die beispielsweise Coffein oder Amphetamine verursachten, seien nicht beobachtet worden, schreibt das Magazin.
Das Ampakin erhöhe die Aktivität des körpereigenen Nervenbotenstoffs Glutamat, lautet die Erklärung für die gehirnleistungssteigernde Wirkung. „Wir haben alle denselben Computer, laufen aber mit unterschiedlicher Spannung“, sagte Ampakin-Erfinder Gary Lynch von der Universität von Kalifornien in Irvine dem „New Scientist“. Ampakine erhöhten diese „Spannung“.
HANDELSBLATT, Mittwoch, 11. Mai 2005, 22:40 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1035850
17) Der Renditevorsprung steigt weiter an (HB
12.5.) nach oben
Nachrangige Anleihen werden populärer
Von Finanzinstitutionen begebene nachrangige Anleihen, so genannte Preferred oder Capital Securities, stehen bei Investoren hoch im Kurs. Aus gutem Grund, denn die ohnehin schon ansehnlichen Renditevorsprünge dieser nachrangigen Anleihen haben sich im Vergleich zu klassischen Staatsanleihen in jüngster Zeit noch vergrößert.
Ängste vor größeren Zinsschritten der US-Notenbank und Probleme bei General Motors, einem der größten Emittenten von Firmenanleihen, sind Auslöser dafür. Diese Entwicklung findet parallel zu der schon allgemeinen Ausweitung von Renditeaufschlägen – Spreads – von Unternehmensanleihen statt.
In diesem Umfeld steigen die Spreads von Preferred Securities mit, ohne dass aber ihre Sicherheit leidet. Denn die emittierenden Finanzinstitute oder Versicherungsunternehmen verfügen noch immer über eine hervorragende Kreditwürdigkeit. Eine nachrangige Bankanleihe mit einem einfachen „A“-Rating kann derzeit 90 bis 120 Basispunkte über dem Libor – dem Zinssatz aus dem Londoner Interbankenhandel – rentieren.
Preferred Securities wurden entwickelt, um die zur Einlagensicherung nötige Kapitalaufnahme für Banken und Versicherer zu erleichtern. Eigentlich sollten diese Institutionen Kapital am ehesten in Form von Aktien aufnehmen, weil diese keine Fälligkeit kennen, nicht zurückgekauft werden müssen und Dividenden gewinnabhängig sind. Die Finanzbranche nutzte aber Aktien zur Kapitalaufnahme deutlich seltener als Anleihen, da die Aktienausgabe einerseits teuer ist, andererseits die bestehenden Anteile bei der Ausgabe neuer Titel verwässert werden.
Normale Anleihen haben wiederum den Nachteil, dass ein Ausfall bei Zinskupons oder Tilgung dazu führt, dass ein Bond sofort als Not leidend eingestuft wird. Anleihen als Kapitalform können daher bei Liquiditätsproblemen die Schwierigkeiten des Emittenten noch vergrößern. Daher wurde es Finanzinstitutionen gestattet, Preferred Securities als hybride Instrumente zu begeben, die Eigenschaften von Aktien und Anleihen in sich vereinen.
Die Kombination aus hoher Ausfallsicherheit und stabilen Überrenditen macht Preferred Securities zu einer gefragten Anlageklasse bei Versicherungen, Asset-Managern und auch Privatanlegern. Das Marktvolumen der für institutionelle Adressen aufgelegten Papiere, wie sie im Lehman Capital Securities Index definiert sind, summiert sich derzeit auf 390 Mrd. Euro. Davon sind 30 Prozent in US-Dollar denominiert, weitere 44 Prozent in Euro. Der Rest des Marktes entfällt auf in britische Pfund ausgestellte Papiere. Im globalen Preferred-Securities-Index von Lehman Brothers sind deutsche Emittenten nur sehr schwach vertreten, die meisten Papiere stammen aus den USA, Großbritannien, Frankreich oder aus den Ländern Skandinaviens.
Während Investoren für das mit der Nachrangigkeit verbundene Risiko üblicherweise mit Renditevorsprüngen zwischen 80 und 200 Basispunkten belohnt werden, liegt das Rating von Preferred Securities in der Regel nur um ein oder zwei Stufen unter dem einer klassischen Anleihe desselben Emittenten. Trotz einer in den vergangenen Jahren sehr starken Wertentwicklung gehören Preferred Securities heute noch immer zu den günstigsten Papieren im Investment-Grade-Bereich.
Weil vor allem US-Banken inzwischen regulatorische Grenzen erreicht haben und ihre Kapitalisierung schon sehr ansehnlich ist, wird die Emissionstätigkeit im Bankensektor sich künftig etwas abschwächen. Dafür ist zu erwarten, dass zunehmend Versicherer, die ihre Kapitalbasis stärken wollen, Preferred Securities auflegen. In diesem Jahr könnte das Volumen der Neuemissionen rund 30 Mrd. Euro erreichen, wodurch Liquidität und Bedeutung des Marktes für Preferred Securities künftig noch weiter zunehmen werden.
Owen Murfin ist Vice President und Fund Manager bei Merrill Lynch Investment Managers in London.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 08:25 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1032522
18) Gegen starke Bewegung spricht niedrige Inflationsrate (HB
12.5.) nach oben
Volkswirte erwarten leichten Renditeanstieg
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, die seit einigen Wochen ein Tief nach dem anderen markiert und gestern bei 3,34 Prozent lag, wird in den nächsten sechs Monaten unter der markanten Marke von vier Prozent bleiben. Das ist zumindest die Prognose von vier der fünf vom Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB) regelmäßig befragten Experten.
cü FRANKFURT/M. Damit rudern die Volkswirte kräftig zurück. Im vergangenen Frühjahr und Herbst – die Zinsprognose wird seit 1995 zweimal jährlich abgegeben – hatten die Zinsauguren noch auf kräftig steigende Renditen gesetzt und damit deutlich daneben gelegen.
Die Experten gehen zwar immer noch davon aus, dass die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf Sicht von einem halben Jahr steigen wird, aber der Anstieg soll moderat ausfallen. Kurzfristig, so meinte zumindest Ulrich Kater von der Dekabank, seien sogar nochmals Renditerückgänge möglich. In einem halben Jahr erwartet Kater, dass die zehnjährige Bundesanleihe mit 3,60 Prozent rentieren wird. Feri Research Helaba und VÖB erwarten einen Anstieg auf 3,70 Prozent. Die Bankgesellschaft Berlin ist mit einer Prognose von einem Renditeanstieg ebenfalls zurückhaltender als in der Vergangenheit.
„Wir bleiben in der Euro-Zone in einem niedrigen Inflations- und Leitzinsumfeld“, sagte Ulrich Kater von der Dekabank. Dazu kämen Sonderfaktoren wie aktuell die Gerüchte um eine Schieflage bei Hedge-Fonds, die eine Flucht in die Sicherheit – also in Staatsanleihen – auslösten. Außerdem fehle in der Euro-Zone die Investitionsdynamik, die die Wirtschaft ankurbeln könne. Angesichts der schon lange anhaltenden niedrigen Inflation nähmen die Risikoprämien für einen Inflationsanstieg ab, meinte auch Tobias Schmidt von Feri Trust. Auf mittlere Sicht würden fundamentale Wachstumsdaten zwar wieder die Oberhand gewinnen, aber noch sei der Zeitpunkt dafür nicht abzusehen. Zu beobachten sei außerdem, dass sich der hohe Ölpreis schon dämpfend auf das globale Wirtschaftswachstum ausgewirkt habe.
Gertrud Traud von der Helaba betonte, dass die Rentenmärkte extrem pessimistisch mit Blick auf das Wirtschaftswachstum – gerade in den USA– seien. Diese „negative Illusion“ könne durchaus noch anhalten und müsse deshalb in die Renditeprognose einfließen. Außerdem sei in Deutschland die niedrige Rendite angesichts der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung sogar fundamental angemessen.
Lediglich Thomas Meißner von der DZ Bank, hält an seinem negativen Szenario für die Anleihemärkte fest. „Am Rentenmarkt hat sich ganz klar eine Blase gebildet, die sogar vergleichbar mit der Aktien-Bubble im Jahr 2001/2002 ist.“ Fundamental – also von der wirtschaftlichen Entwicklung her – sei das niedrige Renditeniveau schlicht nicht haltbar, sagt Meißner. Die Wirtschaft im Euro-Raum wachse zwar langsam, aber sie wachse. Der DZ-Volkswirt geht davon aus, dass die zehnjährige Bund-Rendite bis Mitte Oktober auf 4,20 Prozent und damit recht deutlich steigen wird.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 07:56 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036017
19) Wachstumsprognose stabil (HB 12.5.) nach oben
RWE verdient weniger
Der Energiekonzern RWE hat im ersten Quartal einen leichten Ergebnisrückgang verzeichnet. Mit den jüngsten Zahlen übertraf Deutschlands zweitgrößter Versorger trotzdem die Erwartungen der Analysten. Für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen seine Wachstumsprognose.
Die Zentrale des Energiekonzerns RWE AG in Essen. Der Versorger RWE hat im ersten Quartal einen leichten Ergebnisrückgang verzeichnet. Foto: dpa
Bild vergrößern Die Zentrale des Energiekonzerns RWE AG in Essen. Der Versorger RWE hat im ersten Quartal einen leichten Ergebnisrückgang verzeichnet. Foto: dpa
HB DÜSSELDORF. Der operative Gewinn und der Nettogewinn dürften gegenüber dem Vorjahr im einstelligen Prozentbereich wachsen, teilte RWE in einem Zwischenbericht mit. Bei dieser Vorhersage blieben Effekte wie Unternehmensverkäufe oder Währungseinflüsse aber unberücksichtigt.
Für das erste Quartal berichtete RWE von einem leichten Rückgang des Betriebsgewinns auf 1,95 Mrd. Euro nach 1,97 Mrd. im Vorjahr. Damit lag der Konzern in Einklang mit Analysten, die im Schnitt ein operatives Ergebnis von 1,945 Mrd. Euro geschätzt hatten.
Bereinigt um Sondereffekte wie den Verkauf der Beteiligung an Heidelberger Druck im vergangenen Jahr sei der Betriebsgewinn um sieben Prozent gestiegen. Die Effekte macht RWE auch für den Rückgang des Konzernumsatzes auf 11,0 (2004: 12,2) Mrd. Euro verantwortlich. Bereinigt um Sondereffekte und Währungsschwankungen sei der Umsatz um acht Prozent gestiegen.
Unter dem Strich blieb Deutschlands zweitgrößtem Versorger nach E.ON ein um fünf Prozent auf 975 Mill. Euro gestiegener Nettogewinn. Zur Begründung verwies RWE auf das durch den Schuldenabbau verbesserte Finanzergebnis. Die Nettoverschuldung ging den Angaben zufolge bis Ende März gegenüber dem Jahresende 2004 um 810 Mill. Euro auf netto 11,6 Mrd. Euro zurück.
An der Börse stieg die RWE-Aktie zum Handelsauftakt im Deutschen Aktienindex um 0,3 Prozent auf 46,80 Euro.
Ergebnisrisiken sieht RWE in womöglich steigenden Brennstoffkosten und der bevorstehenden Regulierung der Strom- und Gasnetze in Deutschland. Dem stünden positive Entwicklungen im Energiegeschäft auf dem europäischen Kontinent und im britischen Wassergeschäft gegenüber.
RWE kündigte eine Aufstockung der Sachinvestitionen auf eine Größenordnung von vier Mrd. Euro an. 2004 hatte RWE 3,4 Mrd. Euro in Sachanlagen investiert. Eingesetzt werden soll das Geld vor allem für die Modernisierung von Kraftwerken und Netzen in Deutschland und im Wassergeschäft in Großbritannien.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 09:38 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036095
20) EuGH prangert Verstoß gegen Menschenrechte an (HB
12.5.) nach oben
Öcalan-Prozess in der Türkei war unfair
Die Türkei hat laut Europäischem Gerichtshof im Prozess gegen den kurdischen Rebellenführer Abdullah Öcalan gegen die Menschenrechte verstoßen. Damit wächst der Druck auf Ankara, das Verfahren neu aufzurollen. Gegner eines EU-Beitritts der Türkei wittern ihre Chance.
HB STRASSBURG. Der seit sechs Jahren inhaftierte frührere Chef der kurdischen Arbeiterpartei PKK habe in der Türkei keinen gerechten Prozess gehabt, entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte am Donnerstag in Straßburg. Die türkischen Richter in dem Prozess von 1999 seien nicht unparteiisch und nicht unabhängig gewesen.
Die Inhaftierung Öcalans in Isolationshaft auf der Gefängnisinsel Imrali sowie seine Festnahme 1999 in Kenia hätten hingegen nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Öcalan war noch im selben Jahr von einem türkischen Gericht zum Tode verurteilt worden. Das Strafmaß wurde 2002 in lebenslang umgewandelt.
Auch wenn das Urteil nicht bindend ist, wächst damit der Druck auf die Türkei, das Verfahren neu aufzurollen. Das Urteil deutet an, dass dieser Weg nach Meinung des Gerichts der beste wäre“, interpretierte Öcalans Anwalt Marc Müller den Richterspruch. Von Seiten der türkischen Regierung war niemand in Straßburg erschienen.
Die deutsch-kurdische PDS-Europaabgeordnete Feleknas Uca sagte: „Im Hinblick auf die EU-Beitrittsverhandlungen der Türkei wäre ein neues Öcalan-Verfahren sehr wichtig.“ Die türkische Regierung macht Öcalan für einen 15-jährigen Guerilla-Krieg im Südosten des Landes mit mehr als 30 000 Toten verantwortlich.
Das Urteil des Gerichtshofs könnte der Türkei politische Probleme bereiten und sie in ihren Bestrebungen um einen Beitritt zur Europäischen Union zurückwerfen. Die Einhaltung der Menschenrechte in der Türkei ist ein wesentliches Kriterium für eine Aufnahme.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 10:10 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036113
21) 50 Jahre Goggomobil (HB 12.5.) nach oben
dpa DINGOLFING. Das Goggomobil wurde vor einem halben Jahrhundert nicht nur zu einem der beliebtesten Autos Deutschlands, sogar die englische Prinzessin Margaret, die Schwester der Queen, ließ sich in dem Gefährt chauffieren.
An Pfingsten (13. bis 16. Mai) wollen Oldtimer-Fans aus aller Welt in Dingolfing, dem „Geburtsort“ des Goggos, den 50. Geburtstag des legendären Automobils feiern. Ein 34 Kilometer langer Korso mit rund 400 historischen Fahrzeugen soll am Sonntag (13.00 Uhr) Höhepunkt des Goggo-Spektakels werden.
Mit dem Kleinwagen wollten die Dingolfinger Glas-Werke angesichts des Wirtschaftsbooms in der jungen Bundesrepublik insbesondere Motorradfahrer zum Umsteigen auf vier Räder motivieren. Dies machten auch die Reklamebotschaften klar: „Freiluftfahren ist schon alt: Sommer Regen, Winter kalt - Familie das nun nicht mehr will! Lösung klar: Goggomobil“, reimten die Werbestrategen auf ihren Plakaten. Im Angebot waren eine Limousine, ein Coupé, ein Pick-up und sogar ein Mini-Transporter.
Offenbar traf dieses Konzept voll ins Schwarze. Von 1955 bis 1969 rollten rund 280 000 Exemplare der Zweitakter aus der niederbayerischen Fabrik. „Das war zeitweise das weltweit meistverkaufte Auto in dieser Klasse“, erklärt Jürgen Kraxenberger von der Goggo- und Glasfahrer Gemeinschaft Dingolfing. „Das Goggomobil war einfach das richtige Auto zur richtigen Zeit.“
Der Erfolg des Goggos ist nach Ansicht von Kraxenberger auch auf die relativ einfache Technik zurückzuführen. Selbst nicht ganz so versierte Bastler könnten sich bei einem Defekt leicht behelfen, erklärt er. „Aber es ist auch ein tolles Fahrgefühl“, schwärmt der Vorsitzende des 1984 gegründeten Goggo-Klubs, der das Pfingsttreffen organisiert.
Die technischen Daten des 2,9 Meter kurzen und nur 1,26 Meter breiten Viersitzers sind aus heutiger Sicht eher bescheiden. Die Basisversion hatte 250 Kubikzentimeter Hubraum und kam mit 13,6 PS in der sportlichen Coupé-Variante auf eine Spitzengeschwindigkeit von 84 Stundenkilometern. Mindestens 3 327 Mark mussten die Käufer für ihren Goggo hinblättern, gegen Aufpreise von 30 bis 100 Mark waren Motoren mit 300 und 400 Kubik erhältlich.
Der Erfolg des Goggos war für die Hans Glas Gmbh alles andere als vorhersehbar. Vielmehr war das Fahrzeugkonzept bei dem Familienunternehmen eher eine Notlösung. Eigentlich bauten die Glas- Werke Landmaschinen, fanden dafür aber nach dem Kriegsende immer weniger Abnehmer. Inspiriert vom Siegeszug der Vespa in Italien brachte das Unternehmen einen Roller auf den Markt, das Goggomobil wurde dann zunächst als eine Art vollverkleideter Roller mit vier Rädern entwickelt.
Später konzipierten die Glas-Ingenieure, durch die Goggo- Verkaufszahlen beflügelt, auch das größere Modell Isar und den Luxuswagen V8. Doch schon Ende der 60er Jahre ging die kurze Geschichte der Glas-Automobile zu Ende. BMW übernahm die Dingolfinger Fabrik und baute sie zum zweiten Standort des Münchner Unternehmens aus. Inzwischen haben die Niederbayern den BMW-Stammsitz sogar überholt: Dingolfing ist heute das weltweit größte Werk des weiß- blauen Autokonzerns. Die rund 22 000 Mitarbeiter fertigen täglich bis zu 1 300 Wagen der Baureihen 5er, 6er und 7er sowie Karosserien der britischen Nobelmarke Rolls-Royce.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 10:31 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036148

22) Bruttoinlandsprodukt legte um 1,0 Prozent zu (HB
12.5.) nach oben
Volkswirte wollen Prognose erhöhen
Getragen vom Export ist die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal so stark gewachsen wie seit vier Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte saison- und kalenderbereinigt real um 1,0 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu, berichtete das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden.
HB WIESBADEN. Solch einen starken Anstieg hat es seit Anfang 2001 nicht mehr gegeben. „Es ist ein überraschend gutes Ergebnis“, sagte ein Statistiker. Die meisten Institute und Großbanken hatten nur ein halb so großes Wachstum von 0,5 Prozent vorausgesagt. Im vierten Quartal 2004 war die Wirtschaft noch um 0,1 Prozent geschrumpft.
Einige Volkswirte kündigten an, ihre Prognosen für das Gesamtjahr nun wieder nach oben revidieren zu wollen. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute hatten erst kürzlich ihre Prognose für 2005 von 1,5 auf 0,7 Prozent halbiert, die Bundesregierung hatte ihre Schätzung von 1,6 auf 1,0 Prozent gesenkt.
Von einem Aufschwung oder einem Anspringen der Konjunktur wollten die Experten aber nicht sprechen. „Die deutsche Wirtschaft hat einen guten Start ins Jahr hingelegt“, sagte Andreas Rees von der Hypo-Vereinsbank, der seine Prognose für das Gesamtjahr auf 1,1 von 0,8 Prozent erhöhte. Doch Aussagen der Statistiker zu den Details trübten das Bild: Während die Exporte kräftig zulegten, seien die Importe gesunken. Im Inland wuchsen allein die Investitionen. „Die Wachstumsaussichten sind immer noch sehr labil“, sagte Niklasch. „Mir wäre es lieber gewesen, wenn nicht der Export, sondern der Konsum für das Wachstum verantwortlich gewesen wäre.“ Details zur Wirtschaftsentwicklung will das Statistikamt am 24. Mai veröffentlichen.
Das Bundeswirtschaftsministerium erkannte dennoch erste Zeichen für eine Belebung der Binnennachfrage. „Die Ergebnisse des ersten Quartals sind eine Ermutigung auf dem Weg der wirtschaftlichen Erholung, die langsam, aber sicher an Breite und Tiefe gewinnt“, erklärte Clement. Das Wachstum stehe nach den industriellen Restrukturierungen der letzten Jahre auf dem soliden Fundament einer hohen Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. „Deshalb bin ich zuversichtlich, dass sich das Wachstum bald auch in mehr Beschäftigung abbilden wird“, fügte Clement hinzu.
Auch Rees sah Deutschland nicht mehr nur am Tropf der Weltwirtschaft hängen: „Es gibt Lebenszeichen aus der Binnenwirtschaft, zumindest bei den Investitionen.“ Einig waren sich die Experten, dass sich das starke Wachstum im zweiten Quartal nicht wiederholen dürfte. „Insgesamt dürften wir uns im zweiten Quartal nahe Stagnation bewegen“, sagte Jürgen Michels von der Citigroup. Rees erwartet sogar als Gegenbewegung ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent.
Die Analysten der Commerzbank äußerten dagegen mehr Zuversicht: „Um die Wirtschaft steht es insgesamt nicht so schlecht, wie viele nach dem vierten Quartal gedacht hatten“, sagte Matthias Rubisch. „Wir glauben trotz der schlechten Stimmung nicht, dass es im zweiten Quartal zu einem Einbruch kommt und erwarten 0,3 Prozent Wachstum.“ Vor allem das verschlechterte Ifo-Geschäftsklima und die schlechte Stimmung der Verbraucher hatten zuletzt die Sorge geschürt, die Konjunktur könnte nach dem starken Start ins Jahr abknicken.
In den ersten drei Monaten wurde das Wachstum nach Angaben der Statistiker ausschließlich vom Export getragen. In den ersten drei Monaten lagen die Ausfuhren knapp fünf Prozent über dem Vorjahr. Der Exportüberschuss habe ein deutliches Plus aufgewiesen, meldeten die Statistiker. Dagegen blieb die Binnenkonjunktur weiter schwach. „Der private Konsum ist nach unten gegangen und hat nicht zum Wachstum beigetragen“, sagte ein Statistiker. Auch die staatlichen Konsumausgaben und Bau-Investitionen stagnierten. Lediglich die Unternehmen investierten mehr in Ausrüstungen und sonstige Anlagen. Im Vergleich zum Vorjahr blieb die Wirtschaftsleistung im ersten Vierteljahr dagegen unverändert. Rechnet man den Kalendereffekt heraus, hätte das Wachstum laut Bundesamt aber gut ein Prozent betragen. Im ersten Quartal 2005 standen zwei Arbeitstage weniger zur Verfügung als im ersten Quartal 2004.
Die Wirtschaftsleistung wurde im ersten Quartal 2005 von 38,6 Millionen Erwerbstätigen erbracht, das waren 0,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Detaillierte Ergebnisse gibt das Statistische Bundesamt am 24. Mai bekannt.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 10:58 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036029
23) Quartalszahlen: ING gewinnt, Beschäftigte verlieren (HB
12.5.) nach oben
Der niederländische Finanzkonzern ING hat den Gewinn im ersten Quartal kräftig gesteigert und dabei im Bank- wie im Versicherungsgeschäft zugelegt.
HB AMSTERDAM. Europas größter Versicherungsanbieter teilte am Donnerstag mit, der Netto-Gewinn sei einschließlich der Erlöse aus dem Verkauf von Beteiligungen um mehr als 70 5 auf 1,94 Mrd. Euro gestiegen. Analysten hatten auf Basis der neuen IFRS-Bilanzierungsregeln im Schnitt rund 1,6 Mrd. Euro erwartet.
Die Bank-Sparte verbuchte einen Vorsteuergewinn ohne Berücksichtigung von Anteilsverkäufen in Höhe von 1,19 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Zuwachs um rund 20 %. Ein wichtiger Wachstumsmotor war die Online-Direktbank ING Direct, zu der auch die deutsche Direktbank ING DiBa gehört. Im Versicherungsgeschäft stieg der Vorsteuergewinn auf 993 Mill. Euro von 687 Mill. Euro im Vorjahr. Auch hier sind Beteiligungsverkäufe nicht berücksichtigt.
ING räumte ein, das Marktumfeld habe sich zuletzt etwas verschlechtert. Insgesamt bleibe das Unternehmen mit Blick auf die Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf aber optimistisch. Der Konzern kündigt zudem an, bei seiner niederländischen Versicherungstochter Nationale-Nederlanden bis Ende 2007 rund 1000 der 6200 Stellen zu streichen. Die Abfindungszahlungen würden zwar voraussichtlich 75 Mill. Euro umfassen, die Kosten würden dadurch aber um 235 Mill. Euro gesenkt.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 10:34 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036122
24) Hannover Rück fest - Analysten mit Zahlen zufrieden (HB
12.5.)
dpa-afx FRANKFURT. Aktien der Hannover Rück haben am Donnerstag nach Vorlage von Zahlen und Ausblick zugelegt. Der Kurs stieg gegen 10.50 Uhr um 1,40 Prozent auf 28,95 Euro, während der MDax um 0,28 Prozent auf 5 706,92 Punkte vorrückte.
Analysten zeigten sich mit der Bilanz für das erste Quartal zufrieden. So sprachen die Experten von Merrill Lynch von "soliden und erwartungsgemäß" ausgefallen Daten. Sie bestätigten den Titel auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro. Bei der Deutschen Bank hieß, die "soliden Zahlen" hätten die Erwartungen erfüllt.
Die Landesbank Rheinland-Pfalz (LRP) hob den Titel nach den Zahlen aus Bewertungsgründen von "Marketperformer" auf "Outperformer". Analyst Jochen Schmitt bezifferte das Kursziel auf 34 Euro. "Das Quartalsergebnis traf die Markterwartungen und lag aufgrund eines höheren Ebit sowie einer niedrigeren Steuerquote über unseren Erwartungen", berichtete Schmitt. Auch die Prämien seien höher als erwartet ausgefallen.
Die HVB bestätigte das "Outperform"-Anlagevotum. Das Kursziel liege weiter bei 35 Euro, hieß es in einer Studie. Der operative Gewinn (Ebit) und der Überschuss für das erste Quartal hätten leicht unter den HVB-Erwartungen, aber im Rahmen der Marktprognosen gelegen.
Ein Händler verwies auch auf den Ausblick. Hannover Rück hält an den Wachstumszielen für das kommende Jahr fest. "Auch für 2006 können wir uns weiterhin einen prozentual zweistelliges Ergebniszuwachs vorstellen", sagte die Finanzchefin des Unternehmens, Elke König, der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX nach Vorlage von Quartalszahlen.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 11:10 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036178
25) Handelsblatt Business-Monitor (HB 12.5.) nach oben
Kritik der Manager am Standort nimmt zu
Von Elga Lehari
Der Standort Deutschland verliert bei den hier zu Lande aktiven Top-Manager wieder deutlich an Ansehen. Sowohl die aktuellen Standortbedingungen als auch ihre Entwicklung in den nächsten zwölf Monaten beurteilen die Führungskräfte im Mai so kritisch wie seit dem vergangenen Sommer nicht mehr. Das geht aus dem jüngsten Handelsblatt Business-Monitor hervor, für den das Hamburger Psephos-Institut im Auftrag von Handelsblatt und der Unternehmensberatung Droege & Comp. 857 Manager befragt hat. Insbesondere bei den Beschäftigungsplänen hinterlässt das verschlechterte Standortklima bereits Spuren: Mehr Unternehmen als in den vergangenen vier Monaten wollen Stellen abbauen.
DÜSSELDORF. Die Ergebnisse des Handelsblatt Business-Monitors passen zu einer ganzen Reihe schlechter Stimmungsindikatoren der jüngsten Zeit. So ist der Ifo-Geschäftsklimaindex im April zum dritten Mal in Folge gesunken. Zuvor hatten bereits institutionelle Anleger, die das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung zu den Konjunkturaussichten befragt, den Daumen gesenkt. Außerdem signalisierte die jüngste Umfrage unter Einkaufsmanagern, dass sich die Konjunktur in den nächsten Monaten abschwächt.
In diese Indikatoren fließen vorwiegend die Beurteilung des konkreten Wirtschaftsgeschehens wie Nachfrage, Exportchancen, Produktion, aber auch Einschätzungen zu Ölpreis und Eurokurs ein. Für die Benotung der Standortbedingungen im Rahmen des Handelsblatt Business-Monitors sind weitere Faktoren von Bedeutung: die wirtschaftspolitische Diskussion, Stand der Reformen, tarifpolitische Entwicklungen und Behinderungen beispielsweise durch die Bürokratie. Deshalb dürften sich in den im Mai verschlechterten Standort-Urteilen auch Unzufriedenheit mit der Umsetzung der zwischen Regierung und Opposition vereinbarten Job-Gipfel-Beschlüsse von März sowie Unbehagen über die von SPD-Parteichef Franz Müntefering ausgelöste Kapitalismuskritik niederschlagen.
Besonders deutlich wird der Abwärtstrend bei der Einschätzung, wie sich die Standortbedingungen in den nächsten zwölf Monaten verändern werden. Während im April noch fast ein Viertel der Führungskräfte eine Verbesserung erwartete, sind es im Mai nur noch 16 Prozent. Das ist das schlechteste Ergebnis seit März 2003. Einschließlich derjenigen, die mit gleich guten Bedingungen rechnen, hat sich das Lager der Optimisten innerhalb eines Monats von gut zwei Fünftel (42 Prozent) auf ein Drittel (34 Prozent) verkleinert. Die Anteile der pessimistischen Kategorien „gleich schlecht“ und „verschlechtern“ nahmen entsprechend um je vier Prozentpunkte auf 52 bzw. 14 Prozent zu. Überdurchschnittlich skeptisch sind kleine Unternehmen sowie die Industrie – abgesehen vom ohnehin krisengeschüttelten Bau.
Ebenfalls ungünstiger als noch in den Vormonaten – wenn auch in der Veränderung weniger dramatisch – fällt die Beurteilung der aktuellen Standortbedingungen aus. Nur noch 27 nach 30 Prozent der Führungskräfte bezeichnen sie als „gut“ oder „eher gut“, 73 nach 69 Prozent nun als „eher schlecht“ oder „schlecht“. Der Saldo der beiden Lager sank von minus 39 auf minus 46 Prozentpunkte – noch tiefer war er zuletzt im Juni/Juli 2004.
Die ungünstigeren Aussichten belasten das Beschäftigungsklima. Der Anteil der Unternehmen, die in den nächsten zwölf Monaten Stellen streichen wollen, erhöhte sich innerhalb eines Monats um drei Punkte auf 31 Prozent. Und nur noch 20 nach 21 Prozent der Unternehmen haben vor, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. Der Saldo des Beschäftigungsklimas verringerte sich damit von minus sieben auf minus elf Prozentpunkte – das schlechteste Ergebnis in diesem Jahr. 49 nach 52 Prozent der Unternehmen planen keine Veränderungen bei der Mitarbeiterzahl.
Auch bei den Investitionen ist der Anteil der Unternehmen, die keine Änderungen beabsichtigen, mit 58 Prozent unverändert groß. Eine Erhöhung ihres Investitionsbudgets planen 27 nach 26 Prozent, Kürzungen 15 nach 16 Prozent. Die Investitionsbereitschaft nimmt mit der Größe der Unternehmen zu. Seit Anfang dieses Jahres schwankt der Saldo des Investitionsklimas von zuletzt zwölf Prozentpunkten in einer recht engen Bandbreite.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 11:21 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036187
26) Hauptversammlung: (HB 12.5.)
nach oben
BMW muss heftig rudern
BMW will sein Vorsteuer-Ergebnis des Vorjahres auch 2005 trotz außergewöhnlicher externer Belastungen wieder erreichen.
HB MÜNCHEN. Vorstandschef Helmut Panke sagte auf der Hauptversammlung des Autobauers, der Konzern sei in diesem Jahr mit Belastungsfaktoren wie der lahmenden Konjunktur, dem schwachen Dollar, einem harten Wettbewerb und einer überdurchschnittlichen Verteuerung wichtiger Rohstoffe konfrontiert. "Damit ist unser Ziel für das Jahr 2005 durchaus eine große Herausforderung für uns alle", sagte Panke.
2004 hatte BMW ein Ergebnis vor Steuern von 3,55 Mrd. Euro erzielt. Ins neue Jahr war der Konzern allerdings trotz gestiegener Verkaufszahlen mit einem Gewinnrückgang gestartet. Der schwache Dollar und Anlaufkosten für die neue Generation der wichtigen 3er-Reihe hatten im ersten Quartal das Ergebnis belastet.
Beim Absatz, der von der kompakten 1er- und der seit kurzem erhältlichen neuen 3er Reihe getrieben wird, hat sich BMW auch für 2005 nach 1,21 Mill. ausgelieferter Fahrzeuge 2004 einen neuen Rekordwert vorgenommen. "Wir gehen von einem Absatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich aus“, sagte Panke. Von Januar bis April war der Absatz um 8,6 % gestiegen. Auf die Frage nach der Lage im Mai sagte Panke: "Es läuft gut weiter.“
Auf der Hauptversammlung sollen die Aktionäre erstmals ein Rückkaufprogramm von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals genehmigen. "Wir schlagen Ihnen diese Kapitalreduzierung durch Rückkauf am Markt vor, weil Ihr Unternehmen inzwischen in einer so starken Verfassung ist, dass wir uns diesen Schritt erlauben können, ohne dabei Abstriche an anderer Stelle machen zu müssen", sagte Panke. BMW will die zurückgekauften Aktien einziehen und danach das Kapital herabsetzen. Durch die sinkende Aktienzahl verbessert sich das Ergebnis je Aktie.
BMW will seine Aktionäre in diesem Jahr stärker am Erfolg teilhaben lassen. Die Hauptversammlung soll einer Erhöhung der Dividende um vier Cent auf 62 Cent je Stammaktie und 64 Cent je Vorzugsaktie zustimmen.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 11:53 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036197
27) Marshall-Plan-Vermögen weckt neue Begehrlichkeiten (HB
12.5.) nach oben
Eichel erwägt Forderungsverkäufe
Auf der Suche nach zusätzlichen Einnahmemöglichkeiten für den Bundeshaushalt haben die Haushälter im Bundesfinanzministerium die Außenstände in den Blick genommen: Alle Forderungen des Bundes an seine Schuldner werden nach Angaben aus Ministeriumskreisen daraufhin untersucht, ob sie an den Finanzmärkten verkauft werden könnten. Besonderes Interesse, auch der Haushaltspolitiker der Koalition, weckt dabei das Marshall-Plan-Vermögen, das heute unter dem Namen „European Recovery Programm“ (ERP) außerhalb des offiziellen Haushalts existiert. Über die Auflösung dieses Schattenhaushalts will das Kabinett am kommenden Mittwoch beraten.
dri BERLIN. Aus dem Topf der einstigen US-Wiederaufbauhilfe für das weltkriegszerstörte Deutschland werden heute Mittelstandsprogramme finanziert. Das ERP umfasst 30 Mrd. Euro, von denen zehn Mrd. Euro für neue Programme bereitstehen und zwei Mrd. Euro über die staatseigene KfW-Bankengruppe verwaltet werden. Die restlichen 18 Mrd. Euro sind Forderungen an Unternehmen, die einen günstigen Kredit aus dem Programm erhalten haben. Diese Forderungen ließen sich an den Finanzmärkten gegen einen Abschlag verkaufen.
Das Ausmaß der neuen Haushaltslöcher wird Bundesfinanzminister Hans Eichel (SPD) am heutigen Donnerstag mit dem Ergebnis der Steuerschätzung bekannt geben. Wegen des geringeren Wachstums fehlen dem Bund für 2005 voraussichtlich mehr als drei Mrd. Euro Steuereinnahmen. Gleichzeitig steigen die Kosten der Arbeitslosigkeit um schätzungsweise sechs Mrd. Euro. Für 2006 erwarten die Haushälter der Grünen und der Union eine Lücke gegenüber der bisherigen Planung von 15 Mrd. Euro.
„Einen Plan, Forderungen zu verkaufen, gibt es auf Ministerebene nicht“, heißt im Finanzministerium. Allerdings sehe man grundsätzlich Forderungsverkäufe als gute Möglichkeit, kurzfristig und ohne Bundesratszustimmung Mehreinnahmen zu generieren. Der Bundeshaushalt 2005 sieht bereits Forderungsverkäufe der Pensionskasse für die ehemaligen Postbeamten vor. 2004 verbriefte Eichel einen Teil der Russlandschulden.
Eichels Gesetzentwurf für das ERP-Vermögen sieht bisher vor, dass von den zehn bereit stehenden Milliarden acht das Eigenkapital der KfW stärken sollen, die dann alle Mittelstandsprogramme des Bundes bündeln würde. Zwei Milliarden hat Eichel für seinen Etat 2005 vorgesehen. Dagegen allerdings gibt es Widerstand im Wirtschaftsausschuss des Bundestages und seinem ERP-Unterausschuss. Die SPD-Abgeordnete Sigrid Skarpelis-Sperk versucht, die Auflösung des ERP-Vermögens zu verhindern: Der Bundestag müsse die politische Kontrolle über die Förderprogramme behalten, fordert sie. Eichel will dies über den Aufsichtsrat der KfW-Bankengruppe sicherstellen.
Bei Haushaltspolitikern der Koalition wiederum weckt der ERP-Topf noch weiter gehende Begehrlichkeiten: Nicht zwei, sondern die gesamten zehn Mrd. Euro solle Eichel in den Bundeshaushalt transferieren. Allerdings gilt die völlige Auflösung des ERP-Vermögens, gegen die Union und FDP Sturm laufen würden, auch in den eigenen Reihen als nicht durchsetzbar.
Quelle: Handelsblatt
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 11:53 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036212
28) Hauptversammlung (HB 12.5.) nach oben
Heftige Kritik an HVB-Führung
Nach dem erneuten Milliardenverlust Münchner HypoVereinsbank (HVB) im Jahr 2004 sehen Aktionärsvertreter die Glaubwürdigkeit des Managements erschüttert.
HB MÜNCHEN. Insbesondere die sonst zurückhaltenden Fondsgesellschaften, die als institutionelle Investoren höhere Anteile an Firmen halten als Kleinaktionäre, übten angesichts der von der HVB verbuchten Verluste von fast sechs Milliarden Euro in den vergangenen drei Jahren heftige Kritik.
Thomas Nahmer von SEB Invest sprach von "Enttäuschungen, falschen Versprechungen, Verlusten und ausgefallenen Dividendenzahlungen". SEB Invest halte derzeit 850 000 HVB-Aktien - 0,1 % des HVB-Kapitals. "Lieber wäre es mir, ich verträte heute nur eine Aktie", sagte Nahmer. Der Bank könnten nur noch grundlegende Maßnahmen ohne Tabus helfen.
Die Kritik der Aktionäre entzündete sich primär daran, dass die HVB vor gut einem Jahr über eine Kapitalerhöhung rund drei Mrd. Euro einsammelte, sich die Erträge anschließend verschlechterten und Wertberichtigungen auf Immobilienkredite von 2,5 Mrd. Euro am Jahresende die Kapitalerhöhung im Grunde wieder verbrannte. "Es ist schwer zu glauben, dass der HVB zum Zeitpunkt der Kapitalerhöhung kein zusätzlicher Wertberichtigungsbedarf im Kreditbereich bewusst war", sagte Olgerd Eichler von der Fondsgesellschaft Union Investment, die rund 0,4 % des HVB-Kapitals verwaltet. Das Vertrauen in Aussagen der HVB-Führung sei erschüttert.
Vertreter von Kleinaktionärs-Vereinigungen sagten zwar, die operativen Fortschritte der HVB mit steigenden Betriebsgewinnen seien nicht zu bestreiten. "Was für uns Aktionäre aber zählt, ist das, was letzten Endes übrig bleibt. Und das ist wieder mal nix", sagte Harald Petersen von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK).
Bank-Chef Dieter Rampl bedauerte, dass die Aktionäre für 2004 zum dritten Mal in Folge erneut keine Dividende erhielten, und stellte für 2005 nochmals einen Nettogewinn von einer Mrd. Euro in Aussicht. Nach menschlichem Ermessen sei nun für alle Risiken aus Immobilienfinanzierungen vorgesorgt. Gleichzeitig sprach sich Rampl für grenzüberschreitende Fusionen von Banken aus, ein Zusammenschluss von deutschen Privatbanken mache dagegen kein Sinn.
Zuletzt waren Übernahmespekulationen um die HVB neu aufgeflammt. Rampl selbst hatte dazu mit einem Interview beigetragen, in dem er die Bank-Gruppe Unicredito als eine der italienischen Banken bezeichnet hatte, die interessante Partner sein könnten.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 15:15 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036368
29) Studie sieht USA unverändert auf Platz eins (HB
12.5.) nach oben
Deutschland verliert an Wettbewerbsfähigkeit
Deutschland rutscht im Vergleich der Wettbewerbsfähigkeit führender Volkswirtschaften stetig nach unten. Im jährlich veröffentlichten Ranking der Managerschule IMD im Schweizer Lausanne belegt die Bundesrepublik 2005 nur noch den 23. Platz. Im vergangenen Jahr landete Deutschland auf Rang 21, 2001 auf Platz 13.
jdh GENF. Das IMD sieht in Deutschland vor allem bei der Reform und Vereinfachung des Steuersystems Handlungsbedarf. Zudem müssten die öffentlichen Finanzen konsolidiert, der Arbeitsmarkt flexibilisiert und der Umbau der sozialen Sicherungssysteme in Angriff genommen werden. Weitere Mängel sieht das IMD im Bildungssystem.
Positiv in der IMD-Bewertung wirkt sich Deutschlands Exportstärke aus: Bei Gütern liegt die Bundesrepublik international auf dem ersten Platz, bei Dienstleistungen ist sie nur Dritter. Weitere Pluspunkte Deutschlands sind, dass die Wirtschaft viele Patente im Ausland hält und Unternehmen hohe Summen in Forschung und Entwicklung investieren. Außerdem gilt die Justiz als unabhängig, und die persönliche Sicherheit wird in Deutschland als hoch eingestuft.
Die Vereinigten Staaten erhalten 2005 wie im Vorjahr von den IMD-Experten in punkto Wettbewerbsfähigkeit die besten Noten. Auf den Plätzen zwei bis fünf folgen Hongkong, Singapur, Island und Kanada.
Bayern wird von den IMD-Experten als beste der untersuchten europäischen Regionen aufgeführt. Das flächenmäßig größte Bundesland nimmt in der Tabelle Platz 18 ein. Laut IMD gelten für die Regionen die gleichen Maßstäbe wie für Nationalstaaten.
Das IMD bewertet insgesamt 314 Kriterien – von der Exportleistung über die Wettbewerbsgesetzgebung bis hin zur Infrastruktur. Die Daten werden zu zwei Dritteln aus bereits veröffentlichten Studien internationaler Institutionen wie dem Internationalen Währungsfonds bezogen. Das restliche Drittel Information erhalten die IMD-Experten durch eine Befragung von 4 000 Managern weltweit.
Auf internationaler Ebene untersuchte das IMD den Zusammenhang zwischen niedrigen Steuern und der Wettbewerbsfähigkeit. Die Experten betonen, dass relativ hohe Abgaben an den Fiskus nicht unbedingt wettbewerbsfeindlich sein müssen. Die Wettbewerbsfähigkeit von Ländern wie Luxemburg, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und Belgien sei 2004 gut gewesen – trotz Steuern von mehr als 40 Prozent der Wirtschaftsleistung.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 12:34 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036246
30) Schätzer rechnen mit 66,8 Millarden Euro Mindereinnahmen
(HB 12.5.) nach oben
Steuerloch noch größer als erwartet
Der Steuerschwund für die öffentlichen Haushalte wird noch höher ausfallen als bislang angenommen. Laut Steuerschätzer muss sich der Staat bis zum Jahr 2008 auf Ausfälle von insgesamt 66,8 Mrd. Euro einstellen. Daneben drohen Milliarden-Mehrkosten durch die Arbeitsmarktreform.
Den Staat erwarten nach der jüngsten Steuerschätzung Mindereinnahmen von 66, 8 Mrd. Euro. Foto: dpa
Bild vergrößern Den Staat erwarten nach der jüngsten Steuerschätzung Mindereinnahmen von 66, 8 Mrd. Euro. Foto: dpa
HB BERLIN. Das Ergebnis fiel deutlich schlechter aus als von Finanzminister Hans Eichel (SPD) erwartet. Er hatte für den gesamten Zeitraum von 2005 bis 2008 mit einem Minus von 53 Mrd. Euro gerechnet. Eichel will am Donnerstagnachmittag zu den Haushaltslöchern Stellung nehmen.
Am stärksten vom Steuerschwund betroffen ist der Bund, aber auch die Länder müssen sich auf drastische Mindereinnahmen einstellen, hieß es aus Kreisen der Schätzer. Der Staat habe in diesem Jahr Mindereinnahmen gegenüber der letzten Prognose von 5,1 Mrd. zu Euro verkraften.
Für das nächste Jahr werden Steuerausfälle von 17,1 Mrd. veranschlagt, für 2007 Einbußen von 21,3 Mrd. Euro. Für das Jahr 2008 erwarten die Steuerexperten von Bund, Ländern, Kommunen, Forschungsinstituten und Bundesbank weniger Einnahmen in Höhe von 23,3 Mrd. Euro.
Eichel hat angesichts von Steuermindereinnahmen in Milliardenhöhe für das laufende Jahr erhebliche Probleme eingeräumt, nicht zum vierten Mal in Folge gegen den europäischen Stabilitätspakt zu verstoßen.
Eichel kündigt Einmalmaßnahmen an
Es werde immer schwieriger, die europäisch vereinbarte Defizitobergrenze von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts noch einzuhalten, sagte Eichel am Donnerstag in Berlin. Er kündigte jedoch Einmalmaßnahmen an, die die konjunkturelle Entwicklung nicht belasteten.
Neben fehlenden Steuereinnahmen drohen auch Milliarden-Mehrkosten durch die Arbeitsmarktreformen und die Beschäftigungslage. Dabei geht es schätzungsweise allein in diesem Jahr um bis zu 6 Mrd. Euro Mehrausgaben. Hinzu kommt eine angespannte Finanzlage der Rentenkassen.
Unmittelbar vor der Prognose der Steuerschätzer hatte der Bund der Steuerzahler die Bundesregierung noch aufgefordert, künftig vorsichtiger zu kalkulieren. Präsident Karl Heinz Däke sagte im ZDF: „Es wird nicht weniger eingenommen, es wird nur weniger eingenommen als erwartet.“ Die Regierung vertraue zu sehr in die Vorhersagen der Forschungsinstitute. Kurzfristig bleibe Eichel nun nichts anders übrig, als einen Nachtragshaushalt aufzustellen, so Däke.
Auch FDP und Union fordern von Eichel angesichts der Milliardenlöcher einen Kassensturz sowie Kürzungen der Ausgaben. Dabei dürften auch Einschnitte bei Sozialleistungen kein Tabu sein. Die SPD lehnt dies entschieden ab und fordert die Union auf, die Blockadepolitik beim Subventionsabbau endlich aufzugeben. Hier geht es um ein ausstehendes Volumen von rund 17 Mrd. Euro.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 14:04 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036203
31) Vorjahr durch Sondergeschäft geschönt (HB
12.5.) nach oben
Gerling-Leben weist weniger Gewinn aus
Die Lebensversicherungstochter des Kölner Gerling-Konzerns ist im vergangenen Jahr gewachsen. „Das Neugeschäft hat unsere Erwartungen übertroffen“, sagte Norbert Heinen, Chef der Gerling-Konzern Lebensversicherungs-AG (GKL) bei Vorlage der Geschäftszahlen. Auch mit dem Ergebnis sind die Kölner zufrieden, obwohl es von 45 auf 15,7 (nach IFRS-Bilanzierung von 79 auf 30) Mill. Euro zurückgegangen ist. Das hängt allerdings mit dem auf Hochglanz getrimmten Ergebnis des Jahres 2003 zusammen.
rl KÖNIGSTEIN. Damals hatte Heinen den Rohüberschuss – also den an Kunden und Aktionäre zu verteilenden Gewinn – verdoppelt, indem er sich von seinem eigens dafür gegründeten Rückversicherer Gewinne vorfinanzieren ließ. Der Effekt machte 313 Mill. Euro aus. Im Gegenzug fallen die Rohgewinne in den zehn folgenden Jahren um jeweils rund 30 Mill. Euro geringer aus als ohne diesen Deal. Zudem hat im vergangenen Jahr die längere Lebenserwartung den Ertrag gedrückt. Die branchenweite Umstellung auf die neue Sterbetafel hat die Kölner 80 Mill. Euro gekostet. Insgesamt nahm der Rohüberschuss daher 2004 von 600 auf 157 Mill. Euro ab.
Die GKL konnte ihre Position als neuntgrößter Lebensversicherer und zweitgrößter Anbieter in der betrieblichen Altersversorgung halten. Die laufenden Beiträge des Neugeschäfts stiegen sogar um 67,5 Prozent (Branche: plus 39 Prozent) auf 418 Mill. Euro. Davon geht etwa ein Viertel auf betriebliche Versorgungswerke zurück. Das Gruppengeschäft macht ansonsten rund 40 Prozent der Beiträge aus, aber für den Boom am Jahresende 2004 sorgten hauptsächlich Privatkunden. Die GKL vertreibt mittlerweile nur noch zu einem Drittel über eigene Vertreter. Der Großteil kommt von freien Maklern und Finanzvertrieben wie AWD und MLP. „Im vergangenen Jahr konnten wir 1 500 Maklerverbindungen zurückgewinnen“, freute sich Heinen.
Besonders gut liefen 2004 fondsgebundene Lebensversicherungen. Dabei werden die Sparbeiträge in Fonds angelegt, und der Kunde trägt das Verlustrisiko. Etwa zwei Drittel des Geschäfts entfiel 2004 auf solche Policen. Gerling ist in diesem Segment jetzt drittgrößter Anbieter im Neugeschäft. Einschließlich der Pensionskasse hat die GKL im Vorjahr 1,89 Mill. Euro an Beiträgen eingenommen, was etwa auf Vorjahresniveau liegt. Das Gros des Beitragswachstums wirkt sich erst in diesem Jahr aus. Die Kapitalanlagen verzinsten sich mit knapp 4,2 Prozent. Die Kunden erhalten davon zwischen 3,5 und 4,2 Prozent auf ihre Sparguthaben. Im November hat Heinen die Anleihen durch einen Vertrag mit einer Bank gegen einen Zinsrutsch abgesichert. Noch musste er jedoch nicht darauf zurückgreifen.
Die 15,7 Mill. Euro Jahresüberschuss gehen komplett an die Mutter. Im Gegenzug ist geplant, die Hälfte davon entweder als Hybridkapital zur Tochter zurückfließen zu lassen oder in entsprechendem Volumen Pensionsverpflichtungen von der Holding an die GKL zu übertragen. Das entspricht der Konzernpolitik. Die Schwestergesellschaft GKA hat bereits einen Teil ihrer Pensionslasten zurückgebucht.
Der traditionsreiche Familienkonzern steht zum Verkauf – möglicherweise an einen Finanzinvestor. Zu den Verhandlungen wollte Heinen sich nicht äußern.
Quelle: Handelsblatt
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 12:45 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036251
32) Deutliche Merheit auf dem Weg zur Ratifizierung
(HB 12.5.) nach oben
Bundestag stimmt für EU-Verfassung
Der Bundestag hat mit großer Mehrheit die Verfassung der Europäischen Union gebilligt. Damit ist die erste Hürde für die Ratifizierung des Vertragswerks in Deutschland genommen. Insgesamt gab es 23 Gegenstimmen - die meisten davon aus den Reihen der Union.
Der Bundestag hat der EU-Verfassung mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Foto: dpa
Bild vergrößern Der Bundestag hat der EU-Verfassung mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Foto: dpa
HB BERLIN. Für die Verfassung stimmten am Donnerstag in Berlin 569 Abgeordnete. Damit wurde die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit von 401 Stimmen deutlich übertroffen. Dagegen stimmten 23 Abgeordnete, zwei enthielten sich.
Die Zustimmung des Bundestags ist der erste Schritt im Ratifizierungsprozess in Deutschland. Erforderlich ist noch die Billigung durch den Bundesrat. Auch bei dessen Abstimmung am 27. Mai gilt die Zwei-Drittel-Mehrheit als sicher.
Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hatte zuvor in einer Rede vor den Abgeordneten für eine klares Bekenntnis zur EU-Verfassung geworben. Er bezeichnete das Vertragswerk als „sehr guten und fairen Kompromiss“. „Wer mehr Demokratie will in Europa, muss für diese Verfassung stimmen“, sagte Schröder. Durch die Verfassung werde die Europäische Union entscheidungsfähiger und zugleich politisch führbar bleiben. „Die Verfassung ist das vorläufig krönende Werk der politische Arbeit von zwei oder drei Generationen.“
CDU-Chefin Angela Merkel verteidigte trotz der Kritik aus den eigenen Reihen die EU-Verfassung als „historischen Schritt“ gewürdigt. „Europa als Friedens- und Wertegemeinschaft zu stärken - dazu gibt es für uns keine Alternative.“
Merkel machte zugleich ihre Skepsis gegenüber einem Beitritt der Türkei zur Europäischen Union deutlich und warnte vor einer Überforderung der Aufnahmefähigkeit der Gemeinschaft. Es bleibe bei den unterschiedlichen Meinungen darüber, ob die Aufnahmefähigkeit der Türkei gegeben sei „ohne das europäische Einigungswerk zu gefährden“.
Am Mittwoch hatten Österreich und die Slowakei die EU-Verfassung ratifiziert. Mit nur einer Gegenstimme segnete der österreichische Nationalrat das Regelwerk ab. Auch das slowakische Parlament sprach sich mit großer Mehrheit für den Verfassungsentwurf aus.
Damit die Verfassung in Kraft treten kann, müssen alle 25 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zustimmen. In einigen Ländern entscheidet dabei das Volk. So stimmen die Franzosen am 29. Mai in einem Referendum über die Verfassung ab. Ein „Ja“ gilt dabei nicht als gesichert.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 13:17 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036106
33) Die EU-Verfassung – Wichtigste Punkte (HB
12.5.) nach oben
Die erste Verfassung des geeinten Kontinents soll garantieren, dass die EU auch nach Aufnahme der zehn neuen Länder und weiteren Kandidaten handlungsfähig bleibt. Die wichtigsten Punkte:
Gottesbezug: In der Präambel verweisen die Staatsoberhäupter der 25 Mitgliedstaaten auf die „Inspiration des kulturellen, religiösen und humanistischen Erbes Europas (...), aus dem sich die universalen Werte der unverletzbaren und unveräußerlichen Rechte des Menschen, der Demokratie, der Gleichheit, der Freiheit und des Rechtsstaats entwickelt haben (...)“.
Mehrheitsentscheidung: Eine Mehrheitsentscheidung ist dann getroffen, wenn 55 Prozent der Mitgliedstaaten zustimmen, die zugleich mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung vertreten. Die 55 Prozent müssen gleichzeitig 15 Mitgliedstaaten umfassen. Die Mehrheitsentscheidung ist aber auch dann getroffen, wenn weniger als vier Mitgliedstaaten mit Nein stimmen. Für die Politikfelder Justiz und Inneres, Äußeres, Wirtschaft und Finanzen gilt: Wenn der Rat nicht auf Vorschlag der EU-Kommission oder des EU-Außenministers entscheidet, ist eine Mehrheitsentscheidung dann getroffen, wenn 72 Prozent der Mitgliedstaaten zustimmen, die mindestens 65 Prozent der Bevölkerung vertreten.
Ratspräsident: Der Präsident des Europäischen Rats soll von den Staats- und Regierungschefs für die Dauer von zweieinhalb Jahren bestimmt werden. Er soll die EU neben dem Außenminister nach außen vertreten und den Gipfeltreffen vorsitzen. Die Präsidentschaft der Ratsformationen, mit Ausnahme des Rats für Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen, dem der EU-Außenminister vorsitzt, wird von einer Gruppe von drei Mitgliedstaaten für 18 Monate gehalten.
Außenminister: Der Europäische Außenminister wird vom Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit, in Übereinstimmung mit dem Präsidenten der Kommission ernannt. Er soll die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Union gestalten. Er oder sie soll mit eigenen Vorschlägen zur Weiterentwicklung dieser Politik beitragen. Dasselbe gilt für die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Der EU-Außenminister sitzt dem Rat der Außenminister vor und ist gleichzeitig) einer der Vizepräsidenten der Kommission. Er oder sie soll die Konsistenz des außenpolitischen Handelns der Union sichern.
Kommission: Die erste nach der Verfassung nominierte Kommission soll aus Staatsangehörigen jedes Mitgliedstaats bestehen. Nach Ablauf ihrer Amtszeit (nach fünf Jahren) soll die Zahl der neuen Kommissare zwei Drittel der Zahl der Mitgliedstaaten entsprechen. Die Zweidrittel-Regel soll nur einstimmig von den EU-Staats- und Regierungschefs verändert werden können.
Subsidiaritätsprinzip: Auf Drängen Deutschlands wurde das Prinzip der Subsidiarität festgeschrieben. Danach soll die EU nur regeln, was sie besser als die Mitglieder regeln kann. Nationale Parlamente sollen ein Klagerecht vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) erhalten, um eine Verletzung des Subsidiaritätsprinzips zu verhindern. HB/lud
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 13:32 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=899264
34) Bruttoinlandsprodukt legte um 1,0 Prozent zu (HB
12.5.) nach oben
Deutsche Wirtschaft treibt Wachstum in der Euro-Zone an
Allein wegen des starken deutschen Exports hat sich das Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone im ersten Quartal dieses Jahres verdoppelt. Das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone legte zum Jahresbeginn ein halbes Prozent zum Vorquartal zu. Während die deutsche Wirtschaft mit plus 1,0 Prozent so stark wuchs wie seit vier Jahren nicht mehr, schlitterte Italien in eine Rezession.
HB BRÜSSEL. WIESBADEN. Das erklärte das EU-Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Brüssel. Zum Jahresende hatte das Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone nur 0,2 Prozent betragen. Analysten hegten allerdings Zweifel, ob Deutschland auch im zweiten Quartal das Schwungrad in der Euro-Zone sein kann. Die Europäische Kommission senkte sogar ihre Wachstumprognose leicht.
Deutschland hängte den Rest der Euro-Zone im ersten Quartal beim Wachstum klar ab. Dabei profitierte die hiesige Wirtschaft aber nur vom starken Export, während die Binnennachfrage sank. Da Deutschland die meisten Exporte aber in die anderen - schwächelnden - Länder der Euro-Zone ausführt, zweifeln Experten an der Nachhaltigkeit der Erholung. Postbank-Volkswirt Heinrich Bayer sagte mit Blick auf die ungewohnte Rolle des häufigen Schlusslichtes als Konjunkturlokomotive: „Dieses Gefühl sollte man auskosten - denn es dürfte sich so schnell nicht nochmals einstellen.“ Die deutsche Schwäche sei noch nicht überwunden.
Unter den EU-Ländern, die bisher BIP-Daten für das erste Quartal veröffentlicht haben, überraschte neben Deutschland vor allem Italien. Dort sank das BIP um 0,5 Prozent zum Vorquartal, nachdem es im vierten Quartal 2004 bereits um 0,4 Prozent geschrumpft war. Damit steckt das Land nach gängiger Lesart in einer Rezession. In Belgien stagnierte die Wirtschaft nach einem Plus von 0,3 Prozent im Vorquartal, in Finnland schrumpfte das BIP um 0,2 Prozent nach einem Plus von 0,4 Prozent. Die niederländische Wirtschaft schrumpfte um 0,1 Prozent nach einem vierten Quartal ohne Wachstum. Frankreichs BIP wird am 20. Mai bekannt gegeben. Dort rechnen Experten ebenfalls mit einer Wachstumsabkühlung.
„Die Erholung der europäischen Wirtschaft steckt noch ziemlich im Schlamm fest“, sagte Volkswirt David Brown vom Brokerhaus Bear Stearns in London. Dabei sind sich die Experten nicht ganz einig, ob es sich lediglich um eine Wachstumsdelle handelt oder um Anzeichen eines globalen Rückschlags, ausgelöst durch die anhaltend hohen Ölpreise über 50 Dollar je Barrel.
Wichtige Frühindikatoren hatten zuletzt auch in Deutschland nach unten gezeigt. So fiel der Indikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im März in allen sieben großen Industrieländern. Bundesbank-Präsident Axel Weber warnte, wenn sich die globale Konjunktur abschwäche, werde damit auch der wichtigste Impulsgeber für Deutschland schwächer.
Trotz des guten ersten Quartals rechnet auch die EU-Kommission mit einer nachlassenden Dynamik. Für das zweite Quartal senkte sie ihre Wachstumsprognose für die Euro-Zone leicht auf 0,2 bis 0,6 Prozent nach zuvor erwarteten 0,3 bis 0,7 Prozent zum Vorquartal. Für das dritte Quartal rechnet sie ebenfalls mit einem Zuwachs von 0,2 bis 0,6 Prozent. Elga Bartsch von Morgan Stanley sagte, möglicherweise sei die Prognose der EU noch zu optimistisch. So erwarte sie im zweiten Quartal eine Stagnation. Es gebe Anzeichen, dass das Verarbeitende Gewerbe in eine Rezession gleite, der Welthandel gehe zurück und die Lagebestände an Fertigwaren seien zu hoch.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 14:51 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036029
35) Staat erwartet 66,8 Mrd.-Euro-Minus (HB 12.5.) nach oben
Eichel versteht Pessimismus nicht
Hans Eichel übt sich in Schadensbegrenzung: Trotz der massiven Korrekturen an der Steuerschätzung sieht der Bundesfinanzminister keinen Anlass zu Pessimismus. Schwierigkeiten räumt er nur bei einem Punkt ein - und wettert gegen die Angriffe der Union.
Bundesfinanzminister Hans Eichel sieht sich nach der Verkündung der Steuerschätzung neuen Angriffen ausgesetzt. Foto: dpa
Bild vergrößern Bundesfinanzminister Hans Eichel sieht sich nach der Verkündung der Steuerschätzung neuen Angriffen ausgesetzt. Foto: dpa
HB BERLIN. Es gebe ein „zögerliches“ Erstarken des wirtschaftlichen Wachstums, sagte Eichel nach Abschluss der Steuerschätzung, die ein Minus von knapp 66,8 Mrd. Euro bis 2008 ergab. Das Wirtschaftswachstum sei im ersten Quartal mit 1,0 Prozent so stark gewachsen wie seit vier Jahren nicht mehr. Dies unterstreiche, dass die Bundesregierung mit 1,0 Prozent eine realistische Prognose für das laufende Jahr gegeben habe, so Eichel weiter.
Der Finanzminister kündigte an, er sehe daher keine Notwendigkeit, einen Nachtragshaushalt vorzulegen. Die reflexhaften Rufe der Opposition nach einem solchen Schritt machten aktuell keinen Sinn. Die genaue Entwicklung im Haushalt lasse sich erst im weiteren Jahresverlauf abschätzen, sagte Eichel. Die schwache Konjunktur und die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt bedeuteten für den Bund 2005 Mehrbelastungen im „mittleren einstelligen Milliarden-Bereich“.
Eichel erklärte, die bisherigen allgemeinen Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt fortsetzen zu wollen. Jedoch könnten Kürzungen auf der Ausgabenseite allein nicht die Probleme der öffentlichen Haushalte lösen. Deshalb müsse das mittelfristige Wachstumspotenzial der Volkswirtschaft verbessert werden. Dies geschehe durch die Reformagenda der Regierung und durch beschlossenen Steuersenkungen für Unternehmen. Schließlich müsse der Subventionsabbau konsequent fortgesetzt werden.
Die prekäre Finanzlage sei zudem kein Problem des Bundes allein, sagte Eichel. Bereits auf Basis der alten Steuerschätzung gebe es fünf Bundesländer, deren Haushalte - anders als beim Bund - bereits bei der Vorlage verfassungswidrig seien. Und diese Situation dürfte sich angesichts der neuen Schätzung noch verschlechtern, so der Minister.
Probleme räumte Eichel für die Einhaltung des EU-Stabilitätspaktes ein. Es werde immer schwieriger, die europäisch vereinbarte Defizitobergrenze von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts noch einzuhalten. Deutschland droht damit zum vierten Mal in Folge gegen die Auflagen aus Brüssel zu verstoßen.
Die Steuerschätzer hatten am Donnerstag nach ihrern dreitägigen Bewratungen erklärt, die öffentliche Hand müsse bis zum Jahr 2008 mit rund 66,8 Mrd. Euro weniger Steuern rechnen. Im laufenden Jahr prognostizierten sie rund 5,1 Milliarden Euro Mindereinnahmen. Das Ergebnis der Schätzung fiel damit deutlich schlechter aus als von Eichel erwartet.
Auf der Suche nach zusätzlichen Einnahmequellen für den Bund peilt das Finanzministerium nun den Verkauf weiterer Kreditforderungen an Schuldner an. Erwogen wird dem Vernehmen nach auch, Forderungen aus Krediten, die Mittelständler aus dem ERP-Fördergeschäft erhalten haben, zu Geld zu machen. In den Reihen der Grünen gibt es zudem bereits Stimmen, die eine Anhebung der Mehrwertsteuer fordern, falls dies auch mit einer Senkung der Lohnnebenkosten verbunden werde.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 15:50 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036345
36) US-Einzelhandelsumsatz überraschend stark gestiegen (HB
12.5.) nach oben
Der Umsatzanstieg bei den US-Einzelhändlern hat im April die Erwartungen der Analysten um das Doppelte übertroffen.
HB WASHINGTON. Nach Angaben des Handelsministeriums vom Donnerstag stieg der Einzelhandelsumsatz um 1,4 % nach revidiert 0,4 % im Vormonat. Es war der stärkte Anstieg seit sieben Monaten. Analysten hatten im Schnitt lediglich ein Wachstum von 0,7 % erwartet. Ohne Berücksichtigung der schwankungsanfälligen Umsätze der Automobilbranche kletterten die Erlöse um 1,1 % nach 0,2 % im März. Experten hatten hier mit einem Anstieg von 0,6 % gerechnet. Nach Bekanntgabe der Daten fiel im Devisenhandel der Euro auf ein Siebenmonatstief um 1,2707 Dollar. Die Futures der New Yorker Börse konnten zunächst verzeichnete Verluste wieder wettmachen.
Die Umsätze des US-Einzelhandels gelten als wichtiger Indikator für die US-Wirtschaft. Sie machen rund ein Drittel der gesamten Verbraucherausgaben aus, die wiederum rund zwei Drittel des Wirtschaftswachstums repräsentieren.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 15:46 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036398
37) Fall könnte neu aufgerollt werden (HB 12.5.) nach oben
Türkei beugt sich EU im Öcalan-Urteil
Die Türkei hat angekündigt, die Öcalan-Entscheidung des Europäischen Menschengerichtshofes zu prüfen. Ankara folgt damit dem Druck aus Brüssel. Gleichzeitig warnte die Regierung-Erdogan vor Tumulten in der Bevölkerung.
Will den Öcalan-Fall auf Druck der EU überprüfen lassen: Der türkische Mintserpräsident Recep Tayyip Erdogan. Foto: dpa
Bild vergrößern Will den Öcalan-Fall auf Druck der EU überprüfen lassen: Der türkische Mintserpräsident Recep Tayyip Erdogan. Foto: dpa
HB ISTANBUL. „Die Türkei ist ein Rechtsstaat“, sagte der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan Erdogan als Reaktion auf das Urteil aus Straßburg. Die Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hatten am Donnerstag entschieden, dass der Kurdenführer Öcalan 1999 keinen fairen Prozess in der Türkei erhielt.
Bei der Überprüfung des Falls sollten nach Aussage von Außenminister Abdullah Gül „die Verfassung und die (von der Türkei) eingegangenen internationalen Abkommen berücksichtigt werden“. Es dürfe aber nicht vergessen werden, „dass Abdullah Öcalan der Anführer einer aller Welt sehr gut bekannten Terrororganisation ist“, sagte Gül. Tausende unschuldiger Menschen hätten durch diese terroristischen Aktivitäten ihr Leben verloren.
Der türkische Justizminister Cemil Cicek rief die türkischen Bürgern auf, sich ruhig zu vehalten. Sie sollen sich keinem Zweifel hinzugeben, sondern „dem Staat, seinen Institutionen und allen voran der Justiz zu vertrauen“. Bereits in der Vergangenheit habe die Türkei „derartige Ereignisse, Hindernisse und Schwierigkeiten mit Besonnenheit und gesundem Menschenverstand bewältigt“ und werde dies auch in Zukunft tun.
Die EU-Kommission erwartet von der Türkei eine Umsetzung des Urteils des Europäischen Gerichtshofes. „Wir nehmen auch die Erklärung des türkischen Regierungssprechers zur Kenntnis, der gesagt hat, die Türkei werde nun das Nötige tun, um das Urteil aufzuarbeiten. Wir begrüßen diese sehr rasche Erklärung.“
Die Achtung der Menschenrechte gehöre zu den Voraussetzungen für einen EU-Beitritt der Türkei, über den ab 3. Oktober verhandelt werden soll, sagte der Kommissionssprecher. Beim EU-Gipfel 2002 in Kopenhagen war unter anderem festgelegt worden, dass die Achtung der Menschenrechte und die Umsetzung von Urteilen des Gerichtshofes für Menschenrechte Teil der Beitrittsbedingungen sei.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 16:24 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036411
38) Beitrittsdiskussion (HB 12.5.) nach oben
Vranitzky sieht EU der Türkei gegenüber in der Pflicht
Angesichts der Öcalan-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ist die Debatte über den EU-Beitritt der Türkei neu entflammt. Österreichs ehemaliger Bundeskanzler Franz Vranitzky verlangt, die Zusagen für die Aufnahme des Landes einzuhalten.
HB BERLIN. In der Debatte um EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sieht Österreichs ehemaliger Bundeskanzler Franz Vranitzky die Europäische Union der Türkei gegenüber in der Pflicht: "Sie sollte nicht wortbrüchig werden", sagte Vranitzky dem Handelsblatt (Freitagausgabe). Allerdings müsse klargestellt werden, dass die Aufnahme von Verhandlungen nicht automatisch in einen Beitritt münde.
"Es wird sehr, sehr ausführlich und mit ausreichender Zeit verhandelt werden müssen, ob sich beide Seiten einander so annähern können, dass ein Beitritt im Interesse beider Seiten ist." Die österreichische Regierung hatte sich stets kritisch zu den bevorstehenden EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei geäußert.
SPÖ-Politiker Vranitzky, in dessen Amtszeit die Aufnahme Österreichs in die EU vor zehn Jahren fiel, sprach sich generell für ein langsameres Vorgehen bei der EU-Erweiterung aus. "Wir sollten darauf achten, dass es nicht in erster Linie ums Tempo geht, sondern um die Qualität." Er rate zur Zurückhaltung.
Es sei wichtiger, die Integration zu vertiefen und erst dann an neue Kandidaten zu denken. Es sei wie beim Bergsteigen: "Wenn man zuviel in den Rucksack packt, dann schafft man den Gipfel nicht." Vranitzky zufolge ist die EU-Verfassung ein geeignetes Instrument, "die politische Handlungsfähigkeit der Gemeinschaft der 25 zu verbessern".
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 16:52 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036436
39) Treffen mit linkem SPD-Flügel (HB 12.5.) nach oben
Schröder will Debatte über ethische Wirtschaftsordnung
Bei einem Treffen mit dem linken SPD-Flügel hat Bundeskanzler Gerhard Schröder die Kapitalismuskritik der Partei unterstützt. Teilnehmer des Treffens sagten am Doonerstag in Berlin: „Er hat sich von der Kapitalismuskritik nicht distanziert, sondern im Gegenteil klar gemacht, dass die Debatte über eine ethische Wirtschaftsordnung konkretisiert werden muss.“
HB BERLIN. Diese Debatte solle ein Kernthema auch für die Bundestagswahl 2006 sein. Die SPD-Linken hätten gedrängt, dass es keinen Widerspruch zwischen der Kapitalismuskritik von Parteichef Franz Müntefering und dem Regierungshandeln geben dürfe. Unterdessen ging in der Bundestagsfraktion der Streit über die geplante steuerliche Entlastung der Unternehmen weiter.
Den Angaben zufolge gab es bei dem Treffen keinen Streit um den Reformkurs der Partei mit Blick auf die drohende Niederlage bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl am 22. Mai. „Wir wollen uns gemeinsam bemühen, den Laden zusammen zu halten“, sagte der Teilnehmer, der von einem konstruktiven Treffen sprach. „Niemand stellt die Agenda 2010 in Frage“, sagte er. Schröder sei aber klar, dass der Reformkurs besser begründet werden müsse, um die Partei in dieser Frage zusammen zu halten.
Die Linke hält sich nach Angaben führender Vertreter seit Monaten mit Kritik am Kurs zurück, um die Chancen in Nordrhein-Westfalen nicht zu gefährden. Dort liegt Rot-Grün letzten Umfragen zufolge elf Prozentpunkte hinter CDU und FDP.
Für den Fall einer Niederlage wird in der Partei den Angaben zufolge mit einer Neuauflage des Richtungskampfs und der Grundsatz-Kritik am Kurs gerechnet. Als Vorzeichen dafür wurde die interne Kritik an den Regierungsplänen zur Unternehmensbesteuerung genannt.
Schröder sprach bei dem Treffen nach Angaben eines weiteren Teilnehmers von einer Debatte zwischen einem wirtschaftlich geprägten und dem europäischen Sozialstaatsmodell. Es gehe es um die Grundsatzfrage nach den Aufgaben der Wirtschaft, um die Arbeitnehmer-Rechte und die Unterscheidung zwischen den Regeln für den Güter- und den Dienstleistungsmarkt. Der SPD-Landeschef von Nordrhein-Westfalen, Harald Schartau, warnte vor einer Umsetzung der Kapitalismuskritik in Gesetze: „Wer glaubt, Münteferings Kritik müsste in Gesetz gegen den Kapitalismus umgewandelt werden, liegt falsch“, sagte er der Zeitung „Die Welt“.
Im SPD-internen Streit über die Unternehmensbesteuerung, der den Teilnehmern zufolge bei dem Treffen mit Schröder keine konkrete Rolle spielte, ist die Unterstützung der Fraktion für die Pläne der Regierung weiter unklar. Der SPD-Linke Rüdiger Veit sagte der „Financial Times Deutschland“: „Wenn die geplanten Unternehmens- und Erbschaftsteuerreformen nicht aufkommensneutral sind oder zu staatlichen Mehreinnahmen führen, prognostiziere ich, dass das Paket in der SPD-Fraktion nicht mehrheitsfähig ist“.
Der Chef des Wirtschaftsausschusses, Rainer Wend (SPD), warnte die eigene Fraktion dagegen in der „Berliner Zeitung“ den Plan zur Senkung des Körperschaftsteuersatzes auf 19 von 25 Prozent aufzugeben. „Die deutschen Sätze bei der Körperschaftsteuer sind nun einmal international nicht konkurrenzfähig“, sagte er. Die ursprünglich für Freitag geplante Abstimmung dazu im Bundestag verschob die Koalition.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 12. Mai 2005, 17:25 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036455
40) Österreich ratifiziert EU-Verfassung (NZZ
11.5.) nach oben
Das österreichische Parlament hat die neue EU-Verfassung am Mittwoch mit überwältigender Mehrheit ratifiziert. Es gab nur eine Gegenstimme, einer der 183 Abgeordneten fehlte bei der Abstimmung. Am Mittwoch hat auch das Parlament in Bratislava der Verfassung zugestimmt.
(ap) Der österreichische Bundeskanzler Schüssel nannte das Vertragswerk in der Debatte eine ausgewogene Lösung für die erweiterte Europäische Union. Die Verfassung schaffe ein stärkeres Europa.
Damit die Verfassung in Kraft treten kann, müssen ihr alle 25 Mitgliedstaaten der Europäischen Union zustimmen. In der Slowakei sollte das Parlament ebenfalls am Mittwoch abstimmen, in Deutschland am Donnerstag. In einigen Ländern ist ein Referendum vorgesehen, unter anderem in Frankreich am 29. Mai.
Keine Euphorie
Gegen die EU-Verfassung stimmte in Wien nur die Abgeordnete Barbara Rosenkranz von der Freiheitlichen Partei (FPÖ). Ansonsten billigten alle Fraktionen das Dokument, wenn auch ohne Euphorie, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete.
In der Debatte vor der Abstimmung kritisierte der Fraktionsvorsitzende der regierenden Österreichischen Volkspartei, Wilhelm Molterer, laut APA die «Kleingeistigkeit», mit der das Thema Europa diskutiert werde. Die EU sei die Antwort auf den Zweiten Weltkrieg und auf die Teilung Europas im Kalten Krieg gewesen und biete nun eine Antwort auf die Ängste der Menschen in der Globalisierung. «Österreich und Europa brauchen diese Perspektive der Einigung. Wir brauchen ein starkes Europa», sagte Molterer. Und: «Ein starkes Europa braucht eine Verfassung.»
Für den Vorsitzenden der Sozialdemokraten, Alfred Gusenbauer, ist die EU-Verfassung zwar nicht perfekt, aber eine «Chance». «Diese europäische Verfassung ist allemal besser als das bisherige Vertragseuropa», sagte Gusenbauer. Dass es keine europaweite Volksabstimmung über die Verfassung gegeben hat, sieht Gusenbauer als «schweren Fehler». Eine nationale Volksabstimmung lehnte er aber neuerlich ab.
«Schwarzer Tag für Demokratie»
Die Frage darüber, ob es auch in Österreich eine Volksabstimmung über Verfassung hätte geben sollen, beherrschte die Debatten der vergangenen Tage. Der Vorsitzende der FPÖ, Heinz-Christian Strache, kündigte dabei eine Klage vor dem Verfassungsgericht an, weil seiner Meinung nach mit der Annahme der EU-Verfassung die österreichische Verfassung ausser Kraft gesetzt wurde. Er sprach von von einem «schwarzen Tag für die direkte Demokratie».
Klare Mehrheit auch in Bratislava
Auch das slowakische Parlament billigte die Verfassung am Mittwoch mit 116 gegen 27 Stimmen bei 4 Enthaltungen. Die Dreifünftel-Hürde von 90 Stimmen wurde damit deutlich genommen. Nur Kommunisten und Christdemokraten hatten sich gegen die Vorlage ausgesprochen.
Als erstes Land hatte Litauen am 11. November 2004 die Verfassung ratifiziert. Es folgten die Parlamente von Ungarn, Slowenien, Italien und Griechenland. Auch das spanische Parlament hat bereits nach einem positiven Referendum für die Verfassung gestimmt. Die Zustimmung des Senats in Madrid gilt als Formsache.
Weitere Volksabstimmungen sind in Frankreich, den Niederlanden, Tschechien, Luxemburg, Polen, Dänemark, Portugal, Irland und Grossbritannien geplant. In den anderen Ländern sind die Parlamente zur Ratifizierung aufgerufen. Die EU-Verfassung soll am 1. November 2006 in Kraft treten.
41) Deutscher Bundestag sagt Ja zu EU-Verfassung (NZZ
12.5.) nach oben
Deutliches Resultat in der Abstimmung
Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstag der EU-Verfassung mit der nötigen Zweidrittels-Mehrheit zugestimmt. Für die Verfassung votierten 569 Abgeordnete, dagegen 23. Zwei enthielten sich der Stimme. Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte dem Dokument zum Auftakt der Debatte in Berlin eine historische Bedeutung zugesprochen.
(sda/dpa/Reuters/afp/bbu/rel) Mit einer klaren Mehrheit von 569 Stimmen für und 23 Stimmen dagegen bei zwei Enthaltungen hat der deutsche Bundestag am Donnerstag der EU-Verfassung zugestimmt. Bundeskanzler Schröder hatte in einer Regierungserklärung vorgängig erklärt, die Verfassung sei «ein sehr guter und fairer Kompromiss». Sie erfülle «naturgemäss nicht alle Hoffnungen» und banne nicht alle Ängste. Durch die Verfassung werde aber die Europäische Union entscheidungsfähiger und zugleich politisch führbar bleiben. Die EU werde «demokratischer und bürgernäher». CDU-Chefin Angela Merkel, in deren Fraktion die Kritik an der Verfassung am stärksten war, hatte ein «eindrucksvolles Ja» der Abgeordneten von CDU/CSU zugesichert.
Länderkammer entscheidet am 27. Mai
Nach dem Ja des Bundestags wird nun der Bundesrat über die Verfassung befinden müssen. Auch in der Länderkammer gilt die Zustimmung als sicher. Die Abstimmung wird am 27. Mai erfolgen.
Abweichler in der CDU/CSU-Fraktion
Die Fraktionsführung der CDU/CSU hatte vor Beginn der Bundestagsdebatte alle Abgeordneten auf, der Verfassung zuzustimmen. Bei einer Probeabstimmung der Unionsfraktion am Dienstagabend hatten jedoch 13 Abgeordnete mit Nein votiert. Die Kritiker monieren unter anderem, das Werk führe zu einer Entmachtung der Nationalparlamente.
Signal für Frankreich
Deutschland wollte mit seinem Votum ein Zeichen vor allem auch gegenüber Frankreich setzen. Dort wird am 29. Mai in einem Referendum über die EU-Verfassung entschieden. SPD-Fraktionschef Franz Müntefering äusserte in der Debatte denn auch die Hoffnung auf Zustimmung der französischen Stimmbürger: «Ich wünsche uns allen von Herzen, dass wir in diesem Mai 2005 von Deutschland und Frankreich, Europa ein gutes Signal geben.»
Alle 25 EU-Mitgliedsstaaten müssen zustimmen
Die EU-Verfassung kann erst in Kraft treten, wenn alle 25 EU-Staaten sie ratifiziert haben. In Deutschland dürfte vor der endgültigen Ratifizierung allerdings noch das Verfassungsgericht mit dem Dokument befasst werden. Ein CSU-Bundestagsabgeordneter hat bereits angekündigt, dass er nach der Zustimmung des Bundestages den Verfassungs-Vertrag dem höchsten Gericht in Karlsruhe zur Prüfung vorlegen werde.
42) Welche Demokratie für Europa? (NZZ 12.5.) nach oben
Ein Blick auf die laufenden Verfassungsabstimmungen
Der neue EU-Verfassungsvertrag muss in den meisten Mitgliedstaaten noch ratifiziert werden. In 15 Staaten tun dies die nationalen Parlamente, 10 Staaten führen zu verschiedensten Terminen eine Volksabstimmung durch. Nach Ansicht des Autors dieses Beitrags gibt es mehrere Gründe, die für die Durchführung einer Volksabstimmung sprechen. So führten Plebiszite zu einer grösseren Legitimität und zu besserer Kenntnis der Verfassung. Ausserdem zwängen sie die politische Elite, sich an die Bürger zu wenden, und brächten die Bürger dazu, sich mit «Europa» zu befassen.
Von Georg Kreis*
Die Unterzeichnung des EU-Verfassungsvertrags im Oktober 2004 auf dem Kapitol in Rom war nach der Osterweiterung vom Mai das zweite Hauptereignis des Jahres. Seine Bestätigung durch die nationalen Parlamente und nationalen Volksabstimmungen steht aber noch weitgehend aus. Vielleicht wird das Doppeljahr 2005/06 als das Jahr in die Geschichte der EU eingehen, das die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger einen wichtigen Schritt vorangebracht hat. Das erhoffen sich wenigstens die engagierten Befürworter von «mehr Demokratie» in der EU.
Volksabstimmungen mit Schubwirkung?
Alle 25 EU-Mitglieder müssen den Verfassungsvertrag gutheissen, aber nicht alle tun es auf die gleiche Weise. Teils bestimmen nationale Verfassungsvorschriften, ob die Zustimmung durch die Parlamente oder durch Volksabstimmungen eingeholt werden muss. Teils hängt der Weg der Approbation vom freien Ermessen der Regierungen ab. So ratifizieren 15 Mitglieder den Vertrag «nur» über ihre nationalen Parlamente, 10 führen zu verschiedensten Terminen Volksabstimmungen durch. Es herrscht typische europäische Vielfalt. Bisher hat man nicht feststellen können, dass sich Bürger aus Ländern, in denen keine Volksabstimmung stattfindet, wesentlich benachteiligt fühlen. Ob das zu begrüssen oder zu bemängeln ist: Politische Gepflogenheiten ruhen in hohem Masse in sich selber, im Landesüblichen. Sie werden an sich diskutiert, aber nicht im Vergleich mit anderen Ländern.
Die derzeit laufende Abstimmungswelle mit dem Aufgebot von rund einer Viertelmilliarde Bürgerinnen und Bürgern ist imposant, obwohl es auch schon früher Abstimmungen über EU-Fragen gegeben hat. Zwischen 1972 und 2003 gab es 17 Beitrittsabstimmungen. Zudem gab es, verteilt ebenfalls auf drei Jahrzehnte, immerhin 14 Sachabstimmungen. Die jetzt aber gleichsam als geballte Ladung in den nächsten Monaten freigesetzten 10 Volksabstimmungen könnten zusammen mit ihren Abstimmungsdebatten und diversen Abstimmungen in den Parteien eine demokratisierende Dynamik zur Folge haben. Befürworter von mehr Volksrechten erklären, dass die EU danach nicht mehr die EU von vorher sein werde und dass man inskünftig allgemein mehr Volksabstimmungen werde durchführen müssen.
Dem könnte allerdings zuwiderlaufen, dass diese Verfassungsabstimmungen doch ziemlich einmaligen Charakter haben. Grundgesetze gibt es nicht alle Jahre einzuführen, und allzu viele Grundsatzfragen stehen auch nicht zur Verfügung. In Ländern wie Grossbritannien, Dänemark und Schweden kann es noch um die Einführung des Euro gehen. Dann könnte es um Volksabstimmungen zur eventuellen Aufnahme der Türkei in zehn Jahren gehen. Bisher haben nur die eintretenden Neumitglieder wegen ihrer partiellen Souveränitätsabtretung Volksabstimmungen durchgeführt, nicht aber - mit Ausnahme von Frankreich 1972 - die aufnehmenden Mitglieder.
Klare Bedingungen vorausgesetzt
Wie sieht die Verteilung nach Ländern aus? Irland und Dänemark stehen bei diesen Plebisziten mit je 5 Abstimmungen an der Spitze; in diesen beiden Ländern schreiben die Verfassungen Volksabstimmungen für jede Vertragsänderung vor. Frankreich folgt mit 2 Abstimmungen, und Italien und Schweden hatten je 1 Abstimmung. Frankreich nimmt insofern eine besondere Position ein, als hier unter Pompidou die allererste EG-Abstimmung überhaupt durchgeführt wurde. Wenn es nach General de Gaulles Willen gegangen wäre, hätte man bereits zu Beginn der sechziger Jahre in allen damaligen Mitgliedsländern Volksabstimmungen über die von ihm vorgeschlagene politische Union durchführen sollen. Das von ihm gewählte Wort der «feierlichen Plebiszite» verrät jedoch, dass er da nicht an umkämpfte Entscheide dachte.
Direkte Demokratie ist aber mehr als nur die Zustimmung der Massen zu einem solitären Entscheid eines Staatschefs. Sie hat nur dann die Qualität, die man von ihr erwarten kann, wenn sie unter bestimmten Bedingungen Abstimmungen zwingend vorschreibt. In der Schweiz, dem Lande der direkten Demokratie, gibt es die strikte Meinung, dass man nicht nach Belieben Volksabstimmungen durchführen darf. Fehlt die entsprechende Vorschrift, muss auf eine Volksabstimmung verzichtet werden, selbst wenn man sie gerne hätte. In anderen Ländern gibt es da offenbar einen breiteren Spielraum. Dass am 29. Mai in Frankreich abgestimmt wird, hing allein vom Staatspräsidenten ab.
Während der Beratungen im März 2003 wurde ein von 97 Konventmitgliedern (von insgesamt 210) unterstützter Vorschlag eingebracht, europaweit ein obligatorisches Verfassungsreferendum vorzusehen. Das Projekt war allein schon aus zeitlichen Gründen nicht realisierbar. Das einheitliche Verfahren hätte den Vorzug gehabt, dass man die Referenden überall etwa gleichzeitig hätte durchführen können. Die Idealform von Plebisziten würde dies erfordern, damit nicht die Abstimmung eines Landes die Abstimmung eines anderen Landes beeinflussen kann. Bei den jetzigen Verhältnissen gibt es verschiedenste Spekulationen darüber, welche Wirkung vom Abstimmungskalender ausgeht.
Entscheide ohne Alternative
Bei Verfassungsabstimmungen, wie im Falle des Vertrags von Maastricht (1992) und des Vertrags von Nizza (2000), besteht ein hoher Erwartungsdruck, der davon ausgeht, dass bei dieser Übung ein zustimmendes Resultat herauskommt. Man weiss: Wenn auch nur eine Abstimmung negativ ausgeht, werden die anderen 24 Zustimmungen - vorläufig - nicht umgesetzt werden können. Die Regierungen haben in ihren Ländern deshalb «gefälligst» für ein positives Votum zu sorgen. Ein Entscheid ohne echte Wahl also. Es ist aber daran zu erinnern, dass von den total 31 Volksabstimmungen in der EU immerhin 6 negativ ausgingen.
Obwohl tatsächlich ein höherer Zustimmungsdruck herrscht, kann man derartige Abstimmungen deswegen nicht als reine Farcen bezeichnen. Drei Arten von Wirkungen sind in jedem Fall gegeben: Erstens gibt es eine präventive Wirkung in der Phase der Ausarbeitung, während deren man gewissen Widerständen nur darum Rechnung trägt, weil später noch über das Projekt abgestimmt werden muss. Zweitens findet wegen der Abstimmung im Volk zwangsläufig eine minimale Auseinandersetzung mit dem Reformprojekt statt. Aus schweizerischer Wahrnehmung kann man die These wagen, dass Abstimmungskämpfe eine wichtige Form des kollektiven Lernens sind. Gerade bei Prozessen der Verfassungsgebung kann man immer wieder hören, dass die Herstellung von Bürgernähe, das Bekanntmachen mit den öffentlichen Problemen, kurz die Vitalisierung der Demokratie ein wesentliches Ziel und nicht nur ein Nebeneffekt solcher Projekte sei.
Stärken und Schwächen
Es gibt zahlreiche Gründe, die über die grundsätzliche demokratietheoretische Argumentation hinaus in utilitaristischer Weise für die Durchführung von Volksabstimmungen sprechen. Es gibt jedoch auch einige Vorbehalte; diese sind aber nicht so gewichtig, dass sie die positiven Argumente überwiegen: 1. Volksabstimmungen führen zu einer besseren Legitimität der Verfassung. 2. Sie zwingen die politische Elite, sich an die Bürger zu wenden. 3. Sie drängen die Bürger, sich mit «Europa» zu befassen. 4. Sie fördern die Kenntnisse. 5. Sie fördern die Integration.
Von den negativen Argumenten lasse ich diejenigen nicht gelten, die aus schweizerischer Erfahrung keine sind: 1. Dass die Materie zu komplex sei. 2. Dass leichter demagogische Propaganda betrieben werden könne. 3. Dass unter Umständen die Gelegenheit bloss für eine allgemeine Unmutskundgebung gegen Brüssel genutzt werde. 4. Dass das Volk wie jeder Souverän keine Verantwortung tragen müsse, zumal es auch sich selber nicht zur Verantwortung ziehen könne. Man weiss trotz Exit-Poll-Befragungen wenig Genaues über die Motive von Ja- und Nein-Stimmenden. Dies sind tatsächliche Schwachstellen, doch gibt es sie bei allen Volksabstimmungen. Zur Komplexität der Abstimmungsvorlage: Demokratie beginnt mit dem Vorlegen demokratiefreundlicher Vorlagen, heisst allgemein verständlicher Vorlagen. Diesbezüglich sündigt die EU, wenn sie einen Verfassungsvertrag von über 300 Seiten mit 448 Artikeln vorlegt.
Was geschieht im Falle einer Ablehnung?
Was geschieht, wenn die im Übrigen nicht geringe Wahrscheinlichkeit eintreten und eine Verfassungsabstimmung negativ ausgehen sollte? Offiziell gibt es keinen «Plan B», und öffentlich werden keine Alternativen diskutiert. Juristisch ist die Sache eigentlich klar. Der Prozess würde temporär blockiert. 2002 wurden unter dem Namen «Penelope» unter anderem aber auch Alternativszenarien skizziert, die in Richtung «variabler Geometrie» und «Kerneuropa» gingen, wobei man nicht in Betracht zog, dass Kernländer wie Frankreich nicht zustimmen könnten. Theoretisch gibt es drei Möglichkeiten: 1. Die einfache Wiederholung. 2. Das bilaterale Aushandeln einer speziellen Lösung, was bei einer Verfassung allerdings schwer denkbar ist. 3. Der Austritt.
Vor den kommenden Abstimmungen sind Stimmen zu hören, die sagen, dass eine relativ kleine Zahl von Dickköpfen nicht ein existenzielles Projekt der EU, das rund 450 Millionen Menschen betreffe, gefährden dürften. Das Problem der Dickköpfe ist, dass sie in Prozent zwar wenig zu sein scheinen, in absoluten Zahlen aber doch recht viele sind. So waren in Spanien nur 24 Prozent gegen den Verfassungsvertrag, dies waren aber immerhin 2,5 Millionen Bürger.
Kam in früheren Abstimmungen keine zustimmende Mehrheit zustande, konnte mit Amendments der Opposition teilweise Rechnung getragen und der Souverän zu einem zweiten Termin aufgeboten werden. Im Falle Dänemarks beschloss der Gipfel von Edinburg im Dezember 1992 wichtige Ausnahmeregelungen (keinen Zwang zum Euro und zur gemeinsamen Verteidigung, keine zwingende Teilnahme an der weiteren Rechtsentwicklung). So wurde aus einem im Juni 1992 zustande gekommenen Nein von 52,1 Prozent im Mai 1993 ein Ja von 56,8 Prozent. Im Falle des irischen Nein zu Nizza wurden, was das Gesamtprojekt betraf, keine ins Gewicht fallenden Änderungen vorgenommen, hingegen bezüglich der Neutralität für Irland wichtige Zusicherungen abgegeben. Das Nein von 53,9 Prozent 2001 wurde innerhalb eines Jahres in ein Ja von sogar 62,9 Prozent umgewandelt.
Wie gross muss die Begeisterung sein?
Ob es um eine Totalreform wie bei der Vorlage neuer Verfassungen oder nur um eine Teilreform geht, die Nein-Sager haben es in der Regel leichter. Gegnerschaft kann mit Polemik mehr bewirken als befürwortende Würdigung. Man braucht die Leute gar nicht zu Gegnern zu machen, sondern sie nur zu verunsichern. Das führt dazu, dass die Abstimmenden sich sagen, dass man im Zweifelsfall eher Nein stimmen sollte. So können Oppositionsstimmen kurzfristig im politischen Prozess Beachtung erlangen. Zudem werden bescheidene Zustimmungsraten gerne als fehlende Legitimität gedeutet. Bei Verfassungsabstimmungen sind die Erwartungen jedenfalls besonders hoch, da genügt eine 51-Prozent-Mehrheit nicht. Selbst die Zustimmung von 76,5 Prozent bei der spanischen Verfassungsabstimmung im Februar 2005 ist von vereinzelten Kommentatoren als bescheiden eingestuft worden.
Braucht es wirklich Begeisterung und umfassende Mobilisierung? Die schweizerische Abstimmungsforschung hat sich bereits vor Jahren für eine nüchternere Beurteilung von Abstimmungsverhalten ausgesprochen und neben dem traditionellen Staatsbürger den modernen Citoyen entdeckt: Während der traditionelle Mensch aus staatsbürgerlicher Pflicht an jedem Urnengang sozusagen automatisch teilnehme, ob ihn das Projekt direkt betreffe oder nicht und ob es umstritten sei oder nicht, verhalte sich der moderne Mensch egoistischer und rationaler. Egoistischer, indem er sich frage, inwiefern das Projekt für ihn persönlich wichtig sei; rationaler, indem er den wahrscheinlichen Ausgang des Plebiszits einberechne und sich den «Effort» der Stimmabgabe erspare, wenn er annehme, dass das Resultat auch ohne ihn in die von ihm gewünschte Richtung gehe - oder sich Opposition sowieso nicht lohne.
Ein neues gesamteuropäisches Volksrecht
Volksabstimmungen über begrenzte Sachgeschäfte, über einzelne Gesetze beziehungsweise Richtlinien sind auch in der EU von morgen nicht vorgesehen. Der Verfassungsvertrag von Rom enthält in Art. I-47 aber eine revolutionäre Neuerung: «Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, deren Anzahl mindestens eine Million betragen und bei denen es sich um Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl von Mitgliedsstaaten handeln muss, können die Initiative ergreifen und die Kommission auffordern, im Rahmen ihrer Befugnisse geeignete Vorschläge zu Themen zu unterbreiten, zu denen es nach Ansicht jener Bürgerinnen und Bürger eines Rechtsaktes der Union bedarf, um die Verfassung umzusetzen. Die Bestimmungen über die Verfahren und Bedingungen, die für eine solche Bürgerinitiative gelten, einschliesslich der Mindestzahl von Mitgliedsstaaten, aus denen diese Bürgerinnen und Bürger kommen müssen, werden durch Europäisches Gesetz festgelegt.»
Man kann in der Aufnahme dieses Artikels ein Indiz dafür sehen, dass die Idee der direkten Demokratie «ihren Weg» macht. Doch das vorgesehene Initiativrecht ist eng begrenzt. Es beschränkt sich auf eine unformulierte Anregung in einem genau umschriebenen Punkt. Der so angestossene Prozess verläuft dann aber nach dem bereits etablierten Prozedere zwischen Kommission, Rat und Parlament - ohne Berücksichtigung der Basis. Das neue Instrument könnte jedoch die Integration stärken, weil seine Anwendung den Ausbau der transnationalen Kooperation von Parteien und Verbänden erfordert und die Interaktion zwischen unterer und oberer Ebene intensiviert. Die europäische Initiative könnte auch insofern einen Anfang bedeuten, als mit diesem demokratischen Recht weitere demokratische Rechte eingefordert werden könnten.
Auch wenn die neue europäische Initiative zu einem wichtigen Instrument werden sollte, werden weiterhin die meisten Geschäfte auf der Ebene des Europäischen Parlaments behandelt. Doch auch eine indirekte Demokratie ist eine gute Demokratie, ja sie kann sogar eine bessere Demokratie sein. Die Kompetenzen des 1950 von Jean Monnet überhaupt nicht vorgesehenen Parlaments haben seit 1985 in mehreren Etappen einen starken Ausbau erfahren. Dennoch sieht sich die EU weiterhin dem Vorwurf des «Demokratiedefizits» ausgesetzt. Die Kritiker orientieren sich mehrheitlich am klassischen Parlamentsmodell des Nationalstaates und wollen aus dem Parlament eine richtige Volkskammer, aus dem Ministerrat eine zweite Kammer und aus der Kommission eine Regierung machen.
Neues Demokratieverständnis
In jüngerer Zeit melden sich aber auch Stimmen, die diese Vorstellung für verfehlt halten. Es sei eine Illusion zu meinen, dass sich Politik auf entscheidende Orte konzentrieren lasse und dass Politik ihre Legitimation überhaupt aus repräsentativ-demokratischer Willensbildung gewinne. Politik habe kein Zentrum und ziele nicht aufs Ganze. Politik sei polyzentrisch und ziele auf kleine Teillösungen von kleinen Teilproblemen. Das neue Verständnis zeichnet kein statisches Staatsgebäude mit einfacher Geometrie, wie man es in der Schule lernt. Es zeichnet ein dynamisches und hybrides Gebilde und sagt von seinen Wesensmerkmalen, es bilde eine pluralistische Demokratie auf mehreren Ebenen mit einer Vielzahl von beweglichen Arenen und offenen Gruppen, die um Einfluss und provisorische Lösungen kämpfen. Gesetzgebung schaffe nur einen Rahmen, es gebe keine definitiven Lösungen, alles bleibe Stückwerk, beliebig revidierbar und permanent korrigierbar.
Die beiden Welten, die moderne des streng geometrischen Nationalstaats und die postmoderne der nach variabler Geometrie funktionierenden Prozessmaschine, müssen sich gegenseitig nicht ausschliessen. Ob der Entdecker der postmodernen Welt nur eine entsprechende Brille aufgesetzt oder tatsächlich postmodern gewordene Verhältnisse wahrgenommen hat, soll hier offen bleiben. Bei gewissen Formulierungen schwingt schon einiges Wunschdenken mit, wenn von «immer mehr verblassenden Resten von Nationen» gesprochen wird und neben der Vielzahl horizontal angeordneter Interessengruppierungen «vor allem selbstverantwortlich handelnde Individuen» wahrgenommen werden.
Die beiden Politikverständnisse heben zwei sich gegenseitig nicht ausschliessende Realitäten hervor. Auch wenn es nach einem schwachen Versuch eines Ausgleichs aussieht: Die Denker wie die Praktiker, auf nationaler wie auf supranationaler Ebene, sind gut beraten, wenn sie die informellen und inoffiziellen Prozesse ernst nehmen. Wer andererseits die informelle Politik ins Zentrum rückt, sollte die formellen Prozesse nicht unterschätzen und auch nicht gering schätzen. Es gibt wichtiger werdende Zonen, wo sich die beiden begegnen, ja überschneiden.
Die Auseinandersetzungen um die demokratischen Rechte bewegen sich oft zwischen zwei Mustern. Das eine sieht den Trend zu einem fortschreitenden Abbau und einer stetigen Schmälerung der Basispartizipation infolge der ebenfalls zunehmenden Verlagerung der Entscheide auf höhere Ebenen und ferne Orte - wie Brüssel. Das andere Muster meint, in den letzten Jahren einen noch nie da gewesenen globalen Aufbruch in eine neue demokratische Qualität wahrzunehmen und die direkte Demokratie von Etappensieg zu Etappensieg eilen zu sehen - von der Ukraine bis nach Taiwan. Die akademischen Studien, die sich mit den schwierigen Fragen der politischen Partizipation befassen, bewegen sich im Mittelfeld zwischen diesen Extremvorstellungen.
* Der Autor ist Ordinarius für neuere allgemeine Geschichte und Schweizergeschichte an der Universität Basel und Leiter des Europainstituts.
43) Kontroverse um die EU-Verfassung in Wien (HB 11.5) nach oben
Haider fordert Volksabstimmung - und krebst zurück
cer. Wien, 10. Mai
Unmittelbar vor der auf Mittwoch angesetzten Ratifizierung der EU-Verfassung im österreichischen Nationalrat hat Jörg Haider eine Kontroverse zu diesem Thema entfacht. Haider, der Chef des als Juniorpartner mitregierenden BZÖ (Bündnis Zukunft Österreich), fordert eine Volksabstimmung zur Frage der Ratifizierung. Haider hält diese für eine zwingende Notwendigkeit und wird in dieser Auffassung von einigen Verfassungsrechtlern unterstützt, während andere die Unabdingbarkeit einer Volksabstimmung klar verneinen. Bundeskanzler Schüssel hat die Forderung Haiders unmissverständlich zurückgewiesen und wird in seiner Ablehnung vom geschäftsführenden BZÖ-Chef und Vizekanzler Gorbach ebenso unzweideutig unterstützt.
Partner oder Gegner?
Haider stellt sich mit diesem Positionsbezug erstmals in Opposition zu Schüssel, mit dem er formell erst seit rund einem Monat als BZÖ-Chef und damit als Regierungspartner zusammenarbeitet. Nebenbei bringt er Hubert Gorbach, seinen Regenten in Wien, in beträchtliche Verlegenheit. Der Kärntner Landeshauptmann schlägt wieder die gewohnten populistischen Töne an, wenn er der verbündeten Österreichischen Volkspartei (ÖVP) eine «starre Haltung» samt «Drüberfahrmethode» vorwirft. Alle, die eine Volksabstimmung ablehnen - neben der ÖVP auch die oppositionellen Sozialdemokraten und Grünen -, streben laut Haider ein «bürgerfernes Europa» an. Kräftige Unterstützung wird Haider neuerdings wieder von Seiten des Massenblatts «Kronen-Zeitung» zuteil, das Tag für Tag Stimmungsmache betreibt mit lautstarken Schlagzeilen wie: «Es geht nicht ohne Volksabstimmung», «EU-Verfassung wird durchgepeitscht» und «Mehrheit will eine Volksabstimmung».
Ein Vorgeschmack
Die Kontroverse um eine Volksabstimmung in letzter Minute vor der Ratifizierung der EU-Verfassung im Nationalrat bietet einen Vorgeschmack dessen, was Österreich im ersten Halbjahr 2006 erwartet, wenn Schüssel mit seinem Regierungspartner Haider die EU-Präsidentschaft antritt. Noch in seinem ersten Zusammenschluss mit den Freiheitlichen hatte der überzeugte Europäer Schüssel das Thema EU als «Herzstück der Koalition» bezeichnet. Wenn dieses in Frage gestellt werde, «geht es nicht mehr», fügte er hinzu. Jetzt sagt Schüssel gelassen, Haider habe durchaus das Recht, seine Meinung kundzutun, denn es herrsche ja Meinungsfreiheit. Im Klartext heisst dies: Haider könne reden, so viel er wolle - ändern werde dies aber nichts.
Haider selbst sah sich gezwungen, zurückzukrebsen. Seine anfängliche Drohung, die geforderte Volksabstimmung mittels einer Klage der Kärntner Landesregierung beim Verfassungsgericht durchzusetzen, musste Haider eher kleinlaut zurücknehmen, denn sein Koalitionspartner, die Kärntner SPÖ, spielt nicht mit. Die Ironie dabei ist, dass Haider für sein Anliegen ausgerechnet den Verfassungsgerichtshof einspannen wollte, dessen Urteil in Sachen zweisprachige Ortstafeln er seit Jahren nicht vollzieht.
44) Das EU-Parlament will strikte Arbeitszeitregeln (HB
11.5.*) nach oben
Gegen Ausnahmen und für Bereitschaftszeit als Arbeitszeit
Ht. Brüssel, 11. Mai
Geht es nach dem Europäischen Parlament (EP), werden die EU-weit gültigen Mindestvorschriften zu den Arbeits- und Ruhezeiten von Arbeitnehmern (ausser Managern u. ä.) künftig restriktiver ausfallen als von der EU-Kommission vorgeschlagen. Das EP hat am Mittwoch in Strassburg in erster Lesung eine Novelle der geltenden Arbeitszeitrichtlinie verabschiedet, wobei es in zwei Kernfragen vom Kommissionsentwurf abgewichen ist. Die erste Abweichung betrifft das «Opt-out». Laut dieser bisher von Grossbritannien und einigen weiteren Staaten genutzten Option kann ein Mitgliedstaat unter bestimmten Bedingungen, darunter die Zustimmung des Arbeitnehmers, Überschreitungen der wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 48 Wochenstunden zulassen. Laut EP soll diese Möglichkeit drei Jahre nach Inkrafttreten der Novelle abgeschafft werden. Die Kommission hingegen hatte in ihrem im September vorgelegten Vorschlag lediglich eine Verschärfung der Bedingungen vorgesehen, um Missbräuche des «Opt-out» zu bekämpfen (vgl. NZZ vom 23. 9. 04).
Umstrittene Pikettdienste
Laut der zweiten vom EP gutgeheissenen Änderung sollen Bereitschaftsdienste als Arbeitszeit gelten. Die Kommission hatte vorgeschlagen, den «inaktiven» Teil solcher Dienste nicht zwingend als Arbeitszeit zu werten. Als «inaktiv» gilt beispielsweise die Zeit, während deren ein Bereitschaftsarzt im Spital schläft. Diese würde laut Kommissionsvorschlag künftig nur als Arbeitszeit gelten, wenn dies nationale Vorschriften oder Tarifverträge vorsehen. Damit reagierte «Brüssel» auf Urteile des Europäischen Gerichtshofs, laut denen Bereitschaftsdienste aufgrund der bisherigen Arbeitszeitrichtlinie voll als Arbeitszeit gelten. Viele Mitgliedstaaten fürchten erhebliche Kostenfolgen für das Gesundheitswesen. Das EP sieht nun aber lediglich die Möglichkeit vor, die inaktive Zeit bei der Berechnung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit besonders zu gewichten.
Eine wirtschaftspolitische Gretchenfrage
Im Ministerrat (Vertretung der Mitgliedstaaten) wiederum, in dem die Beratungen noch nicht abgeschlossen sind, zeichnet sich beim Bereitschaftsdienst Zustimmung zum Kommissionsvorschlag ab. Das «Opt-out» hingegen ist dort umstritten. Weil EP und Rat gemeinsam entscheiden müssen und die Kommission am Mittwoch ihr Festhalten am «Opt-out» bekräftigt hat, ist der Ausgang des Ringens noch ungewiss. Für die Änderungsforderungen des EP stimmten nicht nur die meisten Sozialdemokraten und Grünen, sondern auch Teile der Konservativen und Liberalen. Das Dossier illustriert erneut die Kluft zwischen jenen, die unter Verweis auf das «europäische Sozialmodell» für restriktive Schutzvorschriften plädieren, und jenen, die mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit Flexibilität fordern. Im Rat wird das erste Lager von Frankreich, das zweite von Grossbritannien angeführt. Vertreter der britischen Regierung und von Arbeitgeberverbänden bedauerten das EP-Votum umgehend, der europäische Gewerkschaftsdachverband begrüsste es.
45) 12 Millionen Menschen sind Opfer von Zwangsarbeit (NZZ
12.5.) nach oben
ILO fordert globale Allianz
Mindestens 12,3 Millionen Menschen sind nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) Opfer von Zwangsarbeit. Im Kampf gegen Zwangsarbeit brauche es eine globale Allianz, fordert die Uno-Sonderorganisation.
gbs. Zwangsarbeit sei ein weltweites Problem, dass alle Regionen und alle wirtschaftlichen Modelle betreffe, heisst es in dem am Mittwoch unter dem Titel «Eine globale Allianz gegen Zwangsarbeit» veröffentlichten ILO-Bericht. Kinder unter 18 Jahren stellten 40 bis 50 Prozent aller Opfer von Zwangsarbeit.
Vier Fünftel der Zwangsarbeiter werden durch private Akteure ausgebeutet. Mindestens 2,4 Millionen Menschen sind konkret Opfer von Menschenhandel. Die Mehrheit davon sind laut ILO Frauen und Kinder, die überwiegend in der Sexindustrie arbeiten müssen.
Auch in reichen Ländern
In armen asiatischen Ländern werden demnach 9,5 Millionen Menschen zur Zwangsarbeit gezwungen. In Lateinamerika sind es 1,3 Millionen, in Schwarzafrika 660'000 und im Nahen Osten sowie in Nordafrika 260'000.
Aber auch in den Industrieländern leisteten 300'000 Menschen Zwangsarbeit, schreibt die ILO weiter. In Osteuropa und den Ländern der früheren Sowjetunion sind es 210'000.
Nach Schätzungen der ILO wird durch Zwangsarbeit jährlich ein Gewinn von 32 Mrd. Dollar - durchschnittlich 13'000 Dollar für jedes Opfer des Menschenhandels - erwirtschaftet. Fast die Hälfte dieses Profits fliesst demnach in die Industrieländer, gefolgt von Asien mit 9,7 Mrd. Dollar.
Politischer Wille nötig
«Mit dem politischen Willen und einem weltweiten Einsatz ist es möglich, die Zwangsarbeit in die Geschichte zu verbannen», wird ILO-Direktor Juan Somavía zitiert. Um das «Muster der Straflosigkeit» zu durchbrechen, müsse Zwangsarbeit strafrechtlich verfolgt werden, fordert die ILO, die in mehreren Ländern Projekte gegen Zwangsarbeit unterstützt.
46) Überraschend starkes Wachstum der deutschen Wirtschaft (NZZ
12.5.)
Plus 1 Prozent im ersten Quartal 2005
Mit kräftigem Rückenwind durch die Exportwirtschaft ist die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal 2005 überraschend stark gewachsen.
(sda/afp) Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, erhöhte sich das Bruttoinlandprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal kalender-, saison- und inflationsbereinigt um ein Prozent. Dies ist nach Angaben der Statistiker das höchste Quartalswachstum seit Anfang 2001.
Ausschliesslich durch Export getragen
Die wirtschaftliche Belebung im Vergleich zum Jahresende 2004 sei «ausschliesslich» von der Aussenwirtschaft und einem kräftigen Exportüberschuss getragen worden, betonten die Experten. Dagegen ging die Wirtschaftsdynamik im Inland weiter zurück. Lediglich die Ausrüstungsinvestitionen und die Investitionen in sonstige Anlagen hätten zugenommen.
Im Vergleich zum Vorjahresquartal blieb die Wirtschaftsleistung unverändert. Grund war, dass es in diesem Jahr zwei Arbeitstage weniger gab. Sonst wäre die Wirtschaft bei dieser Betrachtung um gut ein Prozent gewachsen. Die Wirtschaftsleistung wurde im ersten Quartal von 38,6 Millionen Erwerbstätigen erbracht. Das waren 203'000 oder 0,5% mehr als ein Jahr zuvor.
47)