Michael Aharon Schüller's Private Office
zurück // MAS private office -> Tagesinformationen -> April und Mai 2005 -> Samstag 14.5.2005
![]()
NB 1: Bitte beachten: die hier angeführten Copyright-geschützten Texte und Graphiken u.a. sind nur für den persönlichen Gebrauch! Dies gilt auch für einen Teil der hier erwähnten LINKS! Der Stern hinter dem Artikel-Datum signalisiert, der Artikel ist von einem zurückliegenden Tag, also ein Nachtrag oder eine Wiederholung..
NB 2: Die Artikel werden weitgehend ungeordnet präsentiert, sie
sind nach Wichtigkeit ( durch !-Markierung) oder nach Rubrik nur ansatzweise
geordnet.
NB 3: Die hier wiedergegebenen Artikel lassen keinen Rückschluss auf meine persönliche
Meinung zu. Sie reflektieren aber m.E. den tagsaktuellen Meinungsfluss - eben
das, was "heute" die Zeitgenossen gerade bewegt. Zum zweiten geben sie
schlichtweg Sachinformation oder m.E. aufschlussreiche Kommentare zu
unterschiedlichsten Themen wieder, möglichst aus qualitativ hochwertigen
Quellen und kompetenter Feder.
Links des Tages hier
1) Spyware und Adware vor Würmern und Trojanern (Pressetext
14.5.) mehr...
Panda präsentiert den Malware-Report Q1
2) Forscher bestätigen: Ozeane kontrollieren das Klima (Pressetext
14.5.) mehr...
Zusammenhang zwischen der CO2-Konzentration und polaren Meeren
3) Albert II. von Monaco besteigt im Juli den Thron (ORF.on 14.5.) mehr...
4) 50 Jahre Staatsvertrag (ORF.on 14.5.) mehr...
"Jahre vor 1945": u.a. Oberrabbiner Taglicht musste die Straße waschen
5) Krankenstandstage auf Rekordtief (ORF.on 14.5.) mehr...
6) Bonds mit langen Laufzeiten sichern die Einnahmen von Institutionellen (HB
14.5.) mehr...
50-jährige Staatsanleihen sind beliebt
7) Streit um «Britenrabatt» (HB 14.5.) mehr...
Fronten im EU-Finanzstreit verhärtet
8) Gemeinsamer Wirtschaftsraum geplant (HB 11.5.*) mehr...
EU und Russland bauen Zusammenarbeit aus
9) Stoiber übt scharfe Kritik an Managern (FTD 14.5.) mehr...
10) EU plant Abgabe auf Flugtickets (FTD 14.5.) mehr...
11) Regierung will Rechte von Spekulanten beschneiden (FTD 14.5.) mehr...
12) Jumbo-Pfandbriefe: Ausländer jagen Deutschen Marktanteile ab (FTD
14.5.) mehr...
13) Impressumspflicht für alle Websites (ORF.on 13.5.*) mehr...
14)
Links des Tages nach oben
50 Jahre
"Österreich ist frei"
100 Jahre Las
Vegas - Traumreiseziel
Wo Europa noch
billig ist
1) Spyware und Adware vor Würmern und Trojanern (Pressetext
14.5.) nach oben
Panda präsentiert den Malware-Report Q1
Bilbao (pte/14.05.2005/08:05) - Der spanische Security-Spezialist Panda Software
http://www.pandasoftware.com hat den Malware-Report für das erste Quartal 2005 präsentiert. Mit einem Anteil von 60 Prozent stellten Adware und Spyware laut Panda die größten Bedrohungen im ersten Quartal dar.
Diese Entwicklung symbolisiert einen radikalen Wechsel in der Bedrohungssituation. In den früheren Reports belegten stets Würmer und Trojaner die Spitzenpositionen. Erstmals sind auch Trojaner für mehr infizierte Systeme verantwortlich als Würmer. Laut Panda ist diese Entwicklung auf die Eigenschaften dieser Gattung und die Verbreitung innerhalb diverser Adware und Spyware-Applikationen zurückzuführen.
Der vierteljährliche Malware-Report befasst sich ebenfalls mit einer anderen Art von Malware, die zwar in der Verbreitung nicht an die vorher genannten Bedrohungen heranreicht, jedoch aufgrund der aktuellen Situation und des Schadenspotenzials eine konkrete Bedrohung darstellt: Phishing oder Online-Betrug. In diesem speziellen Bereich liegen die Wachstumsraten bei etwa 20 Prozent. Erwähnenswert ist hierbei, dass eine verwandte Schädlings-Gattung in diesen Zahlen noch gar nicht erfasst ist: "Pharming". Pharming gleicht einer Phishing-Attacke und verwendet zusätzlich Domain-Spoofing-Techniken für einen Angriff. Abgesehen von den neuen Bedrohungen erwiesen sich E-Mail-Würmer wieder als sehr aktiv. Diverse Varianten der Schädlinge "MyDoom", "Bagle" und "Netsky" infizierten regelmäßig die Nutzer weltweit.
"Das erste Quartal 2005 war geprägt von trügerischer Ruhe. Große Epidemien blieben aus und es wurde eine signifikante Steigerung bei der Programmierung diverser Varianten 'erfolgreicher' Schädlinge registriert", kommentierte Luis Corrons, Direktor der Panda Software Labore. "Die extremen Steigerungsraten bei den Adware- und Spyware-Applikationen entsprechen zu 100 Prozent dem Trend, finanziellen Nutzen aus der Malware-Programmierung zu ziehen", so Corrons. (Ende)
(C) Wilhelm Bauer, Pressetext
2) Forscher bestätigen: Ozeane kontrollieren das Klima
(Pressetext 14.5.) nach oben
Zusammenhang zwischen der CO2-Konzentration und polaren Meeren
Zürich/Potsdam (pte/14.05.2005/12:20) - Ein internationales Forscherteam hat nun festgestellt, dass sich für die Temperaturschwankungen der vergangenen 400.000 Jahre ein direkter Zusammenhang zwischen der Konzentration des atmosphärischen Kohlendioxids und der Schichtung der polaren und subpolaren Ozeane nachweisen lässt. Die Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH)
http://www.ethz.ch und des Geoforschungszentrums Potsdam
http://www.gfz-potsdam.de berichten darüber in der jüngsten Ausgabe des Wissenschaftsmagazins Science
http://www.sciencemag.org .
Das Forscherteam unter Leitung von Samuel Jaccard von der ETH Zürich und seinem Kollegen Gerald Haug vom Geoforschungszentrum Potsdam nahm geochemische Messungen an Meeressedimenten des subarktischen Nordpazifiks vor. Dabei konnten die Wissenschaftler feststellen, dass sich die Algenproduktion der Region in ähnlicher Weise ändert wie die atmosphärische CO2-Konzentration während der vergangenen 400.000 Jahre. Die Daten über die CO2-Konzentration wurden aus Eisbohrkernen der Antarktis gewonnen. Die Wissenschaftler konnten beweisen, dass die verstärkte Stabilität der Schichtung durch eine "Süßwasserkappe" dazu führte, dass in den Kaltzeiten weniger Nährstoffe und CO2 an die Wasseroberfläche gelangten und vom Ozean in die Atmosphäre abgegeben wurden. Diese Feststellung ist ein Indiz dafür, dass die physikalische Schichtung der polaren und subpolaren Ozeane als "kommunizierende Röhre" zwischen Ozean und Atmosphäre funktioniert. Die Schichtung der Ozeane spielt damit eine zentrale Rolle in der globalen Klimaentwicklung, berichten die ETH-Forscher.
Der CO2-Gehalt fungiert demnach quasi als Regelmechanismus im globalen Klima. Ohne atmosphärische Treibhausgase würde die mittlere Temperatur des Planeten Erde bei minus 18 Grad Celsius liegen. Die vorindustriellen Treibhausgaskonzentrationen schwankten während der vergangenen 400.000 Jahre zwischen 280 ppm in den Warm- oder Zwischeneiszeiten und 180 ppm in den Kalt- oder Glazialzeiten. Die mittleren globalen Temperaturen lagen zwischen 15 und 12 Grad Celsius. Der heutige atmosphärische CO2-Gehalt beträgt 370 ppm und steigt rapide an. Die damit verbundene derzeitige globale Erwärmung liegt bei etwa 0,7 Grad Celsius seit 130 Jahren. Da der Ozean eine 50 mal höhere CO2-Konzentration als die Atmosphäre hat, kann eine schnell voran schreitende Erwärmung durch menschliche Einflüsse dazu führen, dass sich der Austausch Ozean-Atmosphäre beschleunigt und dies die Erwärmung der Erde vorantreibt.
Zuletzt war es vor etwa drei Mio. Jahren (im Pliozän) so warm wie heute. Zu dieser Zeit war die mittlere Temperatur des Planeten Erde um etwa zwei bis drei Grad höher als heute und die atmosphärische CO2 Konzentration betrug 400-500ppm. Damals war die ozeanische "Süsswasserkappe" im Nord-Pazifik nicht vorhanden und auch im Südpolarmeer war sie stark reduziert. Die Erde hatte kein Eis auf der Nordhemisphäre und der Meeresspiegel lag sechs Meter höher als heute. Das Szenario einer eisfreien Nordhemisphäre könnte bei weiterhin steigenden Treibhausgas-Emissionen bereits in diesem Jahrhundert Wirklichkeit werden, fürchten die Wissenschaftler. (Ende)
(C) Wolfgang Weitlaner, Pressetext
3) Albert II. von Monaco besteigt im Juli den Thron (ORF.on
14.5.) nach oben
Albert II. von Monaco wird am 12. Juli offiziell in sein neues Amt als Herrscher des Fürstentums Monaco eingeführt.
Sechs Tage nach dem Ablauf der dreimonatigen Trauerperiode für seinen verstorbenen Vater Fürst Rainier III. werde die Inthronisierung des neuen Fürsten feierlich begangen, sagte ein Palastsprecher heute.
"Arbeitsfreier Feiertag"
Der Tag werde ein arbeitsfreier Feiertag für alle Monegassen. Der 47-jährige Albert wird der 30. Herrscher auf dem Thron des im 13. Jahrhundert begründeten Fürstengeschlechts. Fürst Rainier war am 6. April im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben.
4) 50 Jahre Staatsvertrag (ORF.on 14.5.) nach
oben
"Jahre vor 1945": u.a. Oberrabbiner Taglicht musste die Straße waschen
Am Vorabend der Staatsvertragsfeiern herrscht über eine Sache definitiv Einigkeit zwischen ÖVP-Chef Bundeskanzler Schüssel und SPÖ-Chef Gusenbauer: Beide legten am Samstag ein klares Bekenntnis zu Österreichs Neutralität ab. Die bedeutet für die Parteichefs allerdings jeweils ganz anderes - und außerdem noch etwas anderes als die übliche Auffassung von Neutralität. Außerdem verwundert, dass beide Parteichefs deutliche Kritik am sozialen Klima in Österreich übten; wenn auch wieder mit unterschiedlichem Hintergrund.
...
... [Historiker] Stourzh erinnerte aber auch an die Jahre vor 1945. An Oberrabbiner Taglicht etwa, der während des Krieges im englischen Exil gestorben ist. Im Frühjahr 1938 musste er im Gebetsmantel Straßen waschen. Seinen Leidensgenossen sprach er Mut zu: "Ich wasche Gottes Erd e... Wenn es Gott so gefällt, so gefällt es auch mir." Der Historiker: "Aus Scham vor dem Angetanen, in Ehrfurcht vor diesen Worten kann man nur verstummen." (Quelle: APA)
Mehr dazu hier
.
5) Krankenstandstage auf Rekordtief (ORF.on 14.5.) nach
oben
Nun ist es amtlich: Die Zahl der Krankenstandstage ist erneut auf ein Rekordtief gesunken - und hat dabei sogar die kühnsten Schätzungen übertroffen. Nur noch 12,2 Tage im Jahr sind heimische Arbeitnehmer krank. Die Wirtschaft will das als Ergebnis von guter "betrieblicher Gesundheitsförderung" sehen, Vertreter der Arbeitnehmer haben eine andere Erklärung. Für sie ist klar: Die Angst um den Job treibt immer mehr Kranke an den Arbeitsplatz. Und die Arbeitgeber scheinen das auch bewusst auszunützen.
Mehr dazu hier
.
6) Bonds mit langen Laufzeiten sichern die Einnahmen von Institutionellen
(HB 14.5.) nach oben
50-jährige Staatsanleihen sind beliebt
Anleihen mit extrem langen Laufzeiten sind gefragt wie nie zuvor. Der britische Schatzkanzler Gordon Brown kündigte vor kurzem die Emission von Bonds mit 50-jähriger Laufzeit im ersten Quartal des Fiskaljahres an – Frankreich hat als erstes europäisches Land bereits Ende Februar Schuldtitel mit Fälligkeit im Jahr 2055 begeben.
Bislang lag die längste verfügbare Laufzeitvariante staatlicher Bonds bei 30 Jahren. Trotz des mageren Renditeaufschlags der französischen Ultra-Langläufer von drei bis vier Basispunkten gegenüber den 30-jährigen Staatsanleihen aus Frankreich war das Interesse institutioneller Investoren groß. Auch Italien und Deutschland denken über die Emission 50-jähriger Bonds nach.
Insbesondere Pensionsfonds und Versicherer in Ländern wie Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland und Frankreich sind für die gestiegene Nachfrage nach Ultra-Langläufern verantwortlich. Nach Reformen der Rechnungslegungsbestimmungen sind institutionelle Investoren in einigen Ländern gezwungen, die Laufzeiten ihrer Vermögenswerte an ihre künftigen Zahlungsverpflichtungen anzugleichen. Ziel des verpflichtungsgerechten Vermögensmanagements ist es, Risiken zu minimieren und einen Rückgriff auf die Reserven des Anbieters bei unerwarteten Verlusten zu vermeiden.
Die Struktur der Zahlungsverpflichtungen ist stark von Marktentwicklungen und demographischen Faktoren abhängig. Bei sinkenden Geburtenraten und einer ständig steigenden Lebenserwartung ist etwa auf lange Sicht mit einem geringeren Wachstumspotenzial und niedrigeren Zinssätzen zu rechnen. Zudem müssen künftig immer weniger Erwerbstätige für immer mehr Rentner Ruhestandszahlungen und Gesundheitskosten erwirtschaften. Diese Entwicklungen bergen Risiken, die institutionelle Investoren bislang auf der Einnahmeseite mit konventionellen Bonds, Strips und inflationsindexierten Papieren nur bis zu einem Zeitraum von etwa 30 Jahren absichern konnten. 50-jährige Anleihen füllen nun die bislang bestehende Angebotslücke am langen Ende des Laufzeitspektrums.
Allerdings wird mit Ultra-Langläufern auch das derzeit niedrige Zinsniveau auf lange Zeit festgeschrieben. Ist zu viel Kapital langfristig an niedrige Kupons gebunden, dann mindert dies die Renditechancen eines Portfolios in Hochzinsphasen. Dafür verfügen Ultra-Langläufer im Vergleich zu Papieren mit früherer Fälligkeit über eine höhere Konvexität (Maß zur Messung der Kurssensitivität).
Erfüllung regulatorischer Anforderungen, Optimierung von Duration und Konvexität, Sicherung von Einnahmen auf lange Sicht – das sind die Vorteile der Ultra-Langläufer. Auf der Negativseite steht im derzeitigen Niedrigzinsumfeld die langfristige Zinsbindung der Papiere. Doch eine weltweite Umfrage des französischen Schatzamtes unter 550 institutionellen Investoren ergab, dass 49 Prozent der Befragten sich für die französischen Ultra-Langläufer interessieren.
Für den Erfolg der Ultra-Langläufer spricht auch, dass europäische Pensionsfonds derzeit einen hohen Anteil ihres Vermögens in Aktien investiert haben. Insgesamt beläuft sich ihr Aktienbesitz auf fast eine Billion Euro. Wenn nur 25 Prozent dieser Aktienanlagen in Anleihen mit längerer Laufzeit umgeschichtet würden, ergäbe sich ein Marktpotenzial von mehr als 200 Mrd. Euro.
Lionel Oster ist Leiter Staatsanleihen Europa bei F&C Management Asset Management plc in London.
HANDELSBLATT, Samstag, 14. Mai 2005, 17:36 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1032532
7)Streit um «Britenrabatt» (HB 14.5.) nach
oben
Fronten im EU-Finanzstreit verhärtet
HB BERLIN. Im Streit um das künftige Finanzetat der Europäischen Union zeichnet sich weiterhin keine Lösung ab. Deutschland und fünf weitere Nettozahler in die EU-Kasse – Frankreich, Großbritannien, Österreich, die Niederlande und Schweden – bekräftigten am Samstag in Luxemburg beim Treffen der EU-Finanzminister ihren Kurs einer strikten Ausgabenbegrenzung.
«Wenn wir unsere Kernziele nicht durchsetzen, gibt es mit uns keine Einigung im Juni», sagte Finanz-Staatssekretär Caio Koch-Weser am Samstag in Luxemburg. Der Luxemburger Regierungschef und Ratspräsident Jean-Claude Juncker strebt eine Einigung auf die neue Finanzplanung bis zum EU-Gipfel im Juni an. Ob dies gelingt, ist allerdings fraglich.
Deutschland verlangt, dass die Ausgaben in der nächsten Finanzperiode 2007 bis 2013 strikt auf ein Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung begrenzt werden. Die EU-Kommission will dagegen die Ausgaben deutlich erhöhen und strebt einen Wert von 1,26 Prozent an. Brüssel wird dabei von den Südländern und den neuen EU-Mitgliedstaaten unterstützt. Das Ein-Prozent-Modell sieht für den Zeitraum bis 2013 Ausgaben von insgesamt 815 Milliarden Euro vor. Die EU-Kommission strebt dagegen Gesamtausgaben von über einer Billion Euro an.
Koch-Weser sagte, für Deutschland bedeute dies, dass die Beitragszahlungen von derzeit jährlich 22 Milliarden Euro bis 2013 auf 40 Milliarden Euro steigen würden. «Das ist nicht leistbar», sagte der Staatssekretär, der Bundesfinanzminister Hans Eichel (SPD) auf dem Treffen vertritt.
Koch-Weser ergänzte, dass das gegenwärtige Finanzierungsmodell der EU der Vergangenheit, «die heute nicht mehr Realität ist», angehöre. Deutschland sei, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf, unter den 25 EU-Staaten mittlerweile nur noch auf Platz elf, bei den Nettozahlungen pro Kopf indes auf Platz drei. Der Staatssekretär unterstützte einen von der EU-Kommission vorgeschlagenen Korrekturmechanismus, der die Beiträge der einzelnen Mitgliedsländer besser ins Verhältnis setzt.
Bestandteil dessen ist auch die Abschaffung des so genannten «Britenrabatts», der Großbritannien seit 1984 einen Abschlag seines EU-Beitrags einräumt. 2003 betrug die Ermäßigung rund 4,6 Milliarden Euro. Der Rabatt war eingeführt worden, weil es im Königreich im Vergleich zu anderen EU-Staaten weniger Bauern gibt.
Da die Agrarausgaben der EU aber rückläufig sind, wird der Rabatt von den anderen EU-Staaten als nicht mehr zeitgemäß empfunden. Der österreichische Finanzminister Karl-Heinz Grasser sagte, Großbritannien sei heute «eines der reichsten Länder Welt»; daher sei die «Existenzberechtigung des Rabatts weggefallen». Insgesamt 24 EU-Staaten fordern die Abschaffung des Britenrabatts, was London bislang ablehnt.
In einem Papier der Luxemburger EU-Präsidentschaft wird eine stufenweise Abschaffung des Rabatts vorgeschlagen, ohne dies näher auszuführen. Luxemburg warnt, dass der «Britenrabatt» bis 2013 dramatisch ansteigen werde, falls er beibehalten werde. Großbritannien würde bei Aufrechterhaltung des derzeitigen Systems nicht seinen Anteil für die neuen EU-Länder aufbringen, zitierte die dpa aus dem Papier.
HANDELSBLATT, Samstag, 14. Mai 2005, 15:22 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1037203
8) Gemeinsamer Wirtschaftsraum geplant (HB 11.5.*) nach
oben
EU und Russland bauen Zusammenarbeit aus
Die Europäische Union und Russland wollen ihre Beziehungen auf eine neue Grundlage stellen. Einen Tag nach den Feiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs einigten sich EU-Vertreter und der russische Präsident Wladimir Putin in Moskau auf ein Rahmenprogramm für eine "strategische Partnerschaft".
ebo/HB BRÜSSEL/MOSKAU. Es soll das 1997 geschlossene bilaterale Kooperationsabkommen ergänzen und unter anderem einen "offenen und integrierten Markt" zwischen der EU und Russland schaffen. Die Grundsatzvereinbarung in den Bereichen Wirtschaft, Äußere und Innere Sicherheit sowie Wissenschaft und Kultur sei ein Kompromiss zum beiderseitigen Vorteil, betonte Putin nach Beratungen mit der EU-Führung im Kreml. Sie mache es möglich, gemeinsam "ein großes Europa" zu bauen. Der EU-Außenbeauftragte Javier Solana sprach von einem "guten Treffen" mit der russischen Führung. "Wir machen enorme Fortschritte bei der Vertiefung unserer Beziehungen", betonte Solana in Moskau.
Bereits jetzt arbeiten die EU und Russland in der Nahost-Politik, in Iran und im Libanon eng zusammen. Von strategischer Bedeutung ist auch die Wirtschaftskooperation. Die EU ist Russlands größter Handelspartner. Rund die Hälfte aller russischen Exporte gehen in die Union. Vor allem für Deutschland sind die Öl- und Gaslieferungen aus Russland unverzichtbar.
"Road-Map" für vier "gemeinsame Räume"
Die Kooperation wurde jedoch immer wieder von Konflikten überschattet. So sträubte sich Moskau lange gegen eine Ausweitung des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens auf die neuen EU-Länder. Bis heute sind die Beziehungen zu den baltischen EU-Staaten angespannt. Noch gestern weigerte sich Putin, sich für die Sowjetherrschaft im Baltikum nach dem Zweiten Weltkrieg zu entschuldigen. "Diese Frage ist abgeschlossen. Wir wollen darüber nicht mehr reden", sagte der Kreml-Chef. Der sowjetische Kongress der Volksdeputierten habe den Hitler-Stalin-Pakt bereits 1989 für nichtig erklärt, betonte er.
Um sich nicht in Grundsatzfragen zu verheddern, wählte die EU einen pragmatischen Weg der Annäherung. Sie will mit Russland künftig in vier "gemeinsamen Räumen" zusammenarbeiten, für die jeweils eine "Road-Map" mit detaillierten Zielen und Maßnahmen vereinbart wurde. Im geplanten gemeinsamen Wirtschaftsraum ist zum Beispiel die Beseitigung von Handels- und Investitionshemmnissen vorgesehen. Die EU fordert von Russland, Reformen auf der Basis der Nicht-Diskriminierung, der Transparenz und der "Good governance" einzuleiten. Im Gegenzug verspricht sie Unterstützung für die geplante Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation WTO.
Umstritten ist die Zusammenarbeit in Osteuropa und Zentralasien. Russland steht der EU-Nachbarschaftspolitik skeptisch gegenüber und fürchtet, nach Georgien und der Ukraine weiteren Einfluss in der Region zu verlieren. Die EU strebe keine neuen Einflusszonen an, betonte demgegenüber der amtierende EU-Ratspräsident Jean-Claude Juncker in Moskau.
Quelle: Handelsblatt Nr. 090 vom 11.05.05 Seite 11
HANDELSBLATT, Samstag, 14. Mai 2005, 12:01 Uhr
Wenn Sie auf diesen Artikel verweisen möchten, benutzen Sie bitte folgenden Link:
http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1036478
9) Stoiber übt scharfe Kritik an Managern (FTD
14.5.) nach oben
CSU-Chef Edmund Stoiber hat die Kapitalismuskritik der SPD als Gipfel der Verlogenheit kritisiert, aber zugleich die deutschen Manager gerügt. Namentlich kritisierte er den scheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Börse, Rolf Breuer.
Auf dem kleinen Parteitag der CSU am Samstag in München sagte der bayerische Ministerpräsident, die Unternehmensführer sollten "nicht alles bei der Politik abladen, sondern sich selbst an der Nase fassen". Stoiber kritisierte namentlich den Aufsichtsratschef der Deutschen Börse, Rolf Breuer, der immer "nach der Freiheit geschrieen habe", aber nun, nachdem er selbst im Aufsichtsrat der Deutschen Börse unter Druck geraten sei, nach schärferen Gesetzen gegen Hedge-Fonds rufe.
"Wenn der jetzt sozusagen nach der Hand des Staates ruft, dann zeigt das auch, dass vielleicht unsere Manager nicht in dem Maße die Herausforderungen angenommen haben, die mit der Globalisierung und der Europäisierung bestehen", sagte Stoiber unter großem Beifall des CSU-Parteitags.
Der CSU-Chef versicherte, seine Partei wäre zu einer sachlichen Debatte über Fehlleistungen in manchen deutschen Unternehmen bereit, wenn sie so sachlich und sensibel geführt werde, wie dies Bundeskanzler Gerhard Schröder bei der Eröffnung des neuen BMW-Werks in Leipzig getan habe. Die SPD betreibe jedoch einen "Gipfel der Heuchelei", indem sie ausländische Finanzinvestoren beschimpfe und zugleich die von ihrer Regierung beschlossenen Erleichterungen für hochspekulative Hedge-Fonds in Pressemitteilungen als Erfolg feiere.
"Heller Wahnsinn"
Die SPD-Regierung habe in Wirklichkeit mit ihrer Steuerreform den Verkauf von Beteiligungsverkäufen völlig steuerfrei gestellt und damit nicht nur Milliardenausfälle bei der Körperschaftssteuer verursacht, sondern für den Einstieg zahlreicher ausländischer Investoren bei deutschen Firmen gesorgt. Nun verunglimpfe SPD-Chef Franz Müntefering jedoch Unternehmen und Finanzinvestoren pauschal und füge damit dem Standort Deutschland schweren Schaden zu.
"Wenn man jetzt für Verunsicherung bei ausländischen Kapitalgebern sorgt, dann führt das zu einer Reduzierung von Kapital und Investitionen in unserm Land", sagte Stoiber. Es sei "heller Wahnsinn nur um das sozialistische Herz der Truppen der SPD zu wärmen" sich so "an Deutschland und der Wirklichkeit zu versündigen, wie das Herr Müntefering macht", sagte Stoiber weiter.
Der CSU-Chef forderte dagegen eine "Revitalisierung der marktwirtschaftliche Kräfte" in Deutschland. "Wir brauchen weniger Franz Müntefering, wir brauchen viel mehr Ludwig Erhard", sagte Stoiber. Deutschland müsse mehr für Forschung und Innovationen sorgen, um für mehr Wirtschaftswachstum zu sorgen.
Deutschland kann es besser
"Die Sozialausgaben dürfen nicht stärker wachsen als die Wirtschaft", sagte Stoiber weiter. Rot-Grün sei dagegen für "Rekordarbeitslosigkeit, Rekordarmut, Rekordverschuldung und Steuerausfälle in Milliardenhöhe" verantwortlich. "Wir sind fest davon überzeugt dass es Deutschland besser kann", sagte der CSU-Vorsitzende.
Die Wahl in Nordrhein-Westfalen kommende Woche sei dabei ein entscheidender Meilenstein für den politischen Wechsel auch im Bund. Nordrhein-Westfalen habe unter der langen SPD-Herrschaft vom einstigen "Motor des deutschen Wirtschaftswunders" einen dramatischen Niedergang erlebt: "Fast 40 Jahre SPD-Regierung haben dieses großartige Land wirklich herunter gewirtschaftet", sagte Stoiber.
ap, 14.05.2005
© 2005 Financial Times Deutschland
10) EU plant Abgabe auf Flugtickets (FTD 14.5.) nach
oben
Die EU-Finanzminister haben Pläne zur Einführung einer Kerosinsteuer zu den Akten gelegt. Nun ist eine Abgabe auf Flugtickets im Gespräch, um die Ausgaben für die Entwicklungshilfe zu erhöhen.
Darauf hätten sich die EU-Finanzminister am Samstag in Luxemburg im Grundsatz verständigt, teilte EU-Ratspräsident Jean-Claude Juncker mit. "Alle Mitgliedstaaten sind bereit, einen solchen Beitrag einzuführen." Offen ist allerdings noch die genaue Ausgestaltung einer solchen Abgabe, mit der vor allem die Säuglingssterblichkeit in den Entwicklungsländern reduziert werden soll.
Die Vereinten Nationen haben als Ziel ausgegeben, den Anteil der Entwicklungshilfe in den Industriestaaten bis 2015 auf 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu steigern. Damit soll die weltweite Armut und die Säuglingssterblichkeit bekämpft werden. Das zusätzliche Geld soll in ein Impfprogramm fließen, für das nach EU-Angaben insgesamt rund 4 Mrd. Euro erforderlich sind.
Da die EU-Staaten die erforderlichen Ausgaben zurzeit offenbar nicht schultern können, suchen die Finanzminister nach neuen Einnahmequellen. Die Idee einer internationalen Steuer auf Finanztransaktionen ist vom Tisch. In Luxemburg wurde auch die Idee einer Steuer auf Kerosin beerdigt, da ein solcher Beschluss die Einstimmigkeit der EU-Staaten erfordert hätte. Die Minimallösung könnte nun eine Abgabe auf Flugtickets sein.
Konkreter Vorschlag bis Juni
Juncker sagte, fünf bis sechs Mitgliedstaaten seien bereit, eine solche Abgabe obligatorisch zu erheben. Die anderen Länder wollen einen freiwilligen Beitrag von Fluggesellschaften und Passagieren einfordern. Laut EU-Kommission kämen mit einer Abgabe von 10 Euro auf jedes Flugticket rund 6 Mrd. Euro zusammen. Anfang Juni will die Kommission einen konkreten Vorschlag vorlegen. Juncker hofft auf eine Einigung beim nächsten Treffen der Finanzminister oder spätestens beim Gipfel am 17. Juni.
Der deutsche Finanz-Staatssekretär Caio Koch-Weser äußerte sich skeptisch, ob eine freiwillige Abgabe funktionieren werde. Notwendig seien aber innovative Finanzierungsinstrumente, um die Uno-Ziele zu erreichen. Zum 0,7-Prozent-Ziel sagte Kock-Weser mit Blick auf die angespannte Haushaltslage: "Wir müssen ehrgeizig, aber auch realistisch sein." Ziel der Bundesregierung ist, in diesem Jahr 0,33 Prozent des BIP in die Entwicklungshilfe zu investieren.
Die EU-Kommission will die EU-Staaten auf ein Zwischenziel von durchschnittlich 0,56 Prozent bis 2010 verpflichten. Koch-Weser lehnte dies aber ab. Auch Japan und die USA hätten Schwierigkeiten, die UN-Ziele zu erreichen. Laut Koch-Weser zahlen die USA derzeit 0,15 Prozent ihres BIP als Entwicklungshilfe, in Japan beträgt der Anteil 0,19 Prozent.
ap, 14.05.2005
© 2005 Financial Times Deutschland
11) Regierung will Rechte von Spekulanten beschneiden (FTD
14.5.) nach oben
Die Bundesregierung prüft Möglichkeiten, die Eigentumsrechte von spekulativen Anlegern an Unternehmen einzuschränken. Die Pläne zielen vor allem auf Hedge-Fonds, die im Zentrum der Kapitalismuskritik der SPD stehen.
Es werde erwogen, ob für Aktionäre erst dann ein Stimmrecht gelten solle, wenn die Anteilseigner ihre Aktien bereits eine bestimmte Zeit gehalten hätten, berichtete die "Welt am Sonntag" vorab unter Berufung auf Regierungskreise im Kanzleramt. Eine solche Neuregelung richte sich gegen so genannte Hedge-Fonds, die oft nur sehr kurzfristig Anteile an Unternehmen halten, um sie schnell wieder mit Gewinn zu verkaufen. Die Überlegungen würden allerdings im Bundesfinanzministerium skeptisch beurteilt.
Einen ähnlichen Vorschlag hatte vor zwei Wochen der stellvertretende SPD-Fraktionschef Ludwig Stiegler gemacht. Eine Sprecherin des Ministeriums verwies auf eine Arbeitsgruppe unter Federführung ihres Ressorts, die im Auftrag von Bundeskanzler Gerhard Schröder Möglichkeiten für eine stärkere Kontrolle und mehr Transparenz bei Hedge-Fonds prüfen soll. Ergebnisse sollen am 13. Juni auf einer SPD-Wirtschaftskonferenz vorgelegt werden.
Bundesfinanzminister Hans Eichel kündigte bereits an, er werde sich bei Hedge-Fonds für die Ausweitung der deutschen Standards in Europa einsetzen. Die Zeitung zitierte nun aus einem internen Papier des Finanzministeriums: "Die Bundesregierung strebt eine europäische Harmonisierung von Hedge-Fonds an, die gleichermaßen am Schutz der Anleger, an der Stabilität der internationalen Finanzmärkte und an der Entwicklung eines dynamischen europäischen Hedge-Fonds-Marktes orientiert sind."
Warnung vor Insellösung
Die Ministeriumsexperten warnten aber davor, die Eigentumsrechte speziell von Hedge-Fonds an Unternehmen einzuschränken. "Ihre Eigenschaft als Hedge-Fonds dürfte es europa- und verfassungsrechtlich nicht rechtfertigen, sie als Aktionär anders zu behandeln als andere Aktionäre", heiße es in einer anderen internen Vorlage des Finanzressorts. Auch andere institutionelle Anleger richteten die Ausübung ihrer Stimmrechte an kurzfristigen Interessen aus. "Eine nationale Insellösung würde nur dazu führen, dass Hedge-Fonds statt in Deutschland im Ausland aufgelegt würden."
Hintergrund der Überlegungen ist die von SPD-Chef Franz Müntefering angestoßene Debatte um Auswüchse des Kapitalismus und die Vorgänge um die Deutsche Börse. Der Hedge-Fonds TCI - Großaktionär der Deutschen Börse - hatte erfolgreich die Absetzung von Börsenchef Werner Seifert betrieben. Müntefering hatte in seiner Kapitalismus-Kritik Investoren mit Heuschreckenschwärmen verglichen, die über ein Unternehmen herfielen, Gewinne abgrasten und dann wieder verschwänden.
reuters, 14.05.2005
© 2005 Financial Times Deutschland, © Illustration: FTD

12) Jumbo-Pfandbriefe: Ausländer jagen Deutschen Marktanteile ab
(FTD 14.5.) nach oben
von Yasmin Osman, Frankfurt
Beim Start der Jumbos vor zehn Jahren waren die deutschen Banken noch allein. Inzwischen bedrängen europäische Rivalen mit eigenen Produkten den deutschen Pfandbrief mit einem Volumen von mindestens 1 Mrd. Euro.
So funktionieren Jumbo-Pfandbriefe
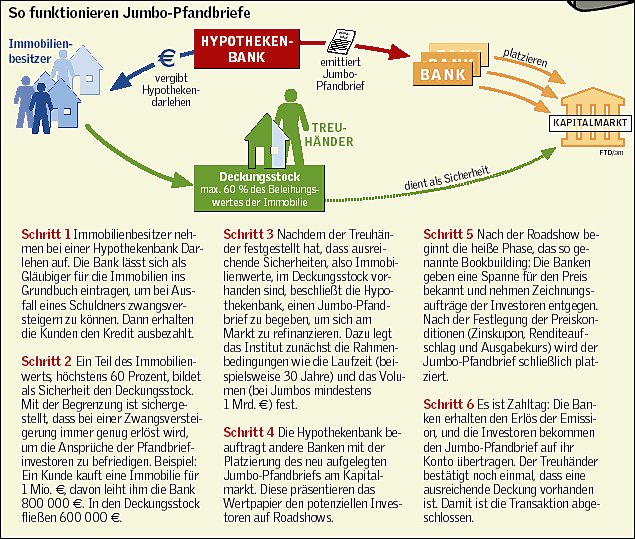
zum Artikelanfang hier
Das einst urdeutsche Produkt Jumbo-Pfandbrief ist einer der größten Exportschlager der Bundesrepublik. Einige wichtige Neuerungen, die vor fast auf den Tag genau zehn Jahren ihren Anfang nahmen, haben den Jumbo international inzwischen so salonfähig gemacht, dass fast überall in Europa ähnliche Wertpapiere entstanden. Dies wird für das Ursprungsland allerdings auch zum Problem: Denn die Konkurrenz für die deutschen Emittenten ist gewachsen.
Pfandbriefe sind besondere Anleihen, die mit Staatskrediten oder Hypothekendarlehen unterlegt sind und deshalb sehr sicher sind. Unter Jumbo-Pfandbriefen versteht man Pfandbriefe, die ein Mindestvolumen von 1 Mrd. Euro haben und für die mindestens drei Banken Kauf- und Verkaufkurse stellen müssen.
"Heutzutage kommt ein großer Investor nicht mehr an diesem Produkt vorbei", sagt Friedrich Munsberg, Vorstandsmitglied der Münchner Hypothekenbank. "Selbst die Notenbank von Taiwan hat eine Mitarbeiterin, die nur für Pfandbriefe zuständig ist", berichtet Christian Haller, Leiter Sales bei Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW) in Frankfurt, der für die Bank gleichzeitig das Neugeschäft mit den Pfandbriefen in Europa verantwortet. In den USA sei der Pfandbrief dagegen nie ein Erfolg gewesen.
Mittlerweile sprechen Experten nur noch vom europäischen Covered-Bond-Markt, wie der internationale Name für Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Produkte lautet. "Es gibt heute nur noch wenige weiße Flecken auf der westeuropäischen Karte, wo es noch keine Covered-Bond-Gesetze gibt", begründet das Haller. "Selbst die englischen Banken, die noch vor Jahren den Covered Bonds ablehnend gegenüberstanden, haben diese als Refinanzierungsmöglichkeit für Hypothekendarlehen entdeckt", sagt Johannes Rudolph, Pfandbriefanalyst bei HSBC Trinkaus & Burkhardt.
Aus der Not geboren - Neuemissionsvolumen von Jumbos
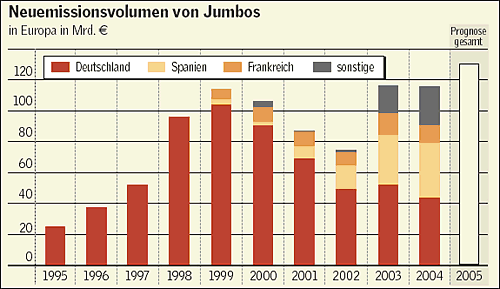
zum Artikelanfang hier
Die internationale Karriere des Pfandbriefs hätte sich kaum ein Hypothekenbanker Mitte der 90er Jahre träumen lassen. Denn der Jumbo war aus der Not geboren. "1994/95 geriet der Pfandbriefmarkt unter Druck, was das Image und das Investoreninteresse anbelangte", erinnert sich Friedrich Munsberg, damals für die Mittelbeschaffung (Treasury) der Frankfurter Hypothekenbank Centralboden verantwortlich, die den ersten Jumbo begab. "Bis zu diesem Zeitpunkt war der Pfandbriefmarkt ein Markt für Anleger, die ihre Papiere bis zur Endfälligkeit hielten." Doch dann änderten sich die Wünsche der Investoren, die zunehmend aktiver wurden. "Sie monierten, der Markt sei nicht liquide genug."
Das machte die Refinanzierung der deutschen Hypothekenbanken damals im Vergleich zu Bundesanleihen teurer. Bei der zehnjährigen Laufzeit stieg die Renditedifferenz zu Staatsanleihen von rund 0,12 Prozentpunkten (zwölf Basispunkte) 1991 auf etwa 37 Basispunkte 1994.
Die entscheidende Neuerung hört sich aus heutiger Sicht unspektakulär an: Der damalige Kapitalmarktchef der Frankfurter Hypothekenbank, Henning Rasche, versprach den Investoren, Kauf- und Verkaufkurse zu stellen. "Das war mutig, denn die Bank hatte keine Mitarbeiter mit Marketmaking-Erfahrung, keine entsprechende technische Unterstützung und keinen eigenen Swap-Tisch, um sich günstig gegen das Zinsänderungsrisiko abzusichern", sagt Munsberg. Allerdings entwickelten sich die Zinsen in dieser Zeit günstig: Sie fielen.
Aktuell handeln rund 70 Prozent der Jumbos im einstelligen Basispunktebereich über der Bund-Kurve. Vergessen sind Misserfolge wie der Versuch, Mega-Jumbos von 5 Mrd. Euro zu schaffen, oder die gescheiterte Einführung eines Jumbo-Futures.
Konkurrenzkampf um Investoren - Ausstehende Jumbos
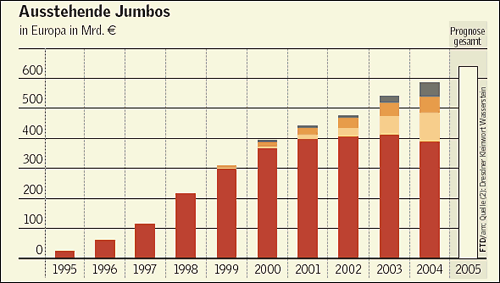
zum Artikelanfang hier
Die niedrigen Renditeabstände zeigen, dass sich der deutsche Jumbo trotz des wachsenden Wettbewerbs gut hält. Selbst vorsichtige Investoren wie Zentralbanken gehören zu den Käufern von Pfandbriefen. Das neue Pfandbriefgesetz, das im Juli in Kraft tritt und unter Auflagen allen deutschen Banken erlaubt, Pfandbriefe zu begeben, stößt bei Experten meist auf Zustimmung. Im Wettbewerb um das beste Gesetz habe Deutschland damit wieder die Nase vorn, sagt Nikolaus Giesberg, Leiter Covered Bonds bei Morgan Stanley. Zu spüren sei der Wettbewerb dennoch. "Der Jumbo hat den Konkurrenzkampf um Investoren aufgenommen."
So verliert der deutsche Jumbo an Bedeutung. "Deutschland hat beim Pfandbriefbestand zwar noch einen Anteil von über 60 Prozent, bei den großvolumigen Jumbo-Neuemissionen haben aber mittlerweile ausländische Emissionen die Oberhand gewonnen", sagt Packmohr. Im Januar 2005 rutschte das ausstehende Volumen deutscher Pfandbriefe erstmals seit Mai 1999 wieder unter die 1000-Mrd. Euro-Grenze. Der Jumbomarkt schrumpfte seit Jahresbeginn auf rund 385 Mrd. Euro. Der europäische Jumbomarkt hat ein Volumen von 610 Mrd. Euro.
Chronik
Mai 1995: Die Frankfurter Hypothekenbank Centralboden (Vorgängerinstitut der Eurohypo) begibt einen 500 Mio. DM großen Pfandbrief und verpflichtet sich, Kauf- und Verkaufkurse zu stellen (Market Making).
Juli 1995: Die Deutsche Hypothekenbank (mittlerweile Eurohypo) emittiert den ersten Jumbo-Pfandbrief mit externem Marketmaking.
August 1995: Die Depfa begibt den ersten syndizierten Jumbo-Pfandbrief, bietet das Papier also mit Hilfe eines Konsortiums aus externen Banken den Investoren an.
März 1996: Die Hypothekenbanken einigen sich auf einheitliche Ausstattungs- und Liquiditätsstandards für Jumbo-Pfandbriefe: Mindestvolumen 1 Mrd. DM (wird 2003 auf 1 Mrd. Euro) erhöht); drei Banken müssen Kurse stellen; nur festverzinsliche, endfällige Pfandbriefe mit jährlicher Zinszahlung erlaubt.
Februar 1997: Hypothekenbanken und Syndikatsbanken (Market Maker) verabschieden die Verwendung einer standardisierten Dokumentation, die international üblichen Standards entspricht.
März 1997: Die öffentlich-rechtlichen Pfandbriefemittenten schließen sich den Mindeststandards der Hypothekenbanken an.
August 1999: Die AHBR begibt den ersten, 5 Mrd. Euro großen Jumbo. Das ist das bislang höchste Emissionsvolumen.
1999: Erste spanische Cédula-Jumbos und französische Jumbo Obligations Fonciéres kommen auf den Markt. Ein Jahr später folgt Luxemburg mit Lettres de Gage.
2003: Die britische HBOS emittiert einen britischen Jumbo, ohne gesetzliche Grundlage. Das fehlende Gesetz wird durch vertragliche Bestimmungen und Strukturierungstechnik ersetzt. Jumbos aus Österreich und Irland werden angeboten.
März 2005: Erster Jumbo aus Italien durch CDP.
ftd.de, 14.05.2005
© 2005 Financial Times Deutschland
13) Impressumspflicht für alle Websites (ORF.on
13.5.*) nach oben
Originalartikel siehe hier
Der Nationalrat hat das neue Mediengesetz am Donnerstag einstimmig verabschiedet. Neu sind unter anderem Bestimmungen für Online-Publikationen - mit weit reichenden Folgen. So muss künftig ausnahmslos jede Website mit einem Impressum samt Namen und Anschrift aufwarten können.
Der Nationalrat hat Donnerstagabend einstimmig eine Novelle zum Mediengesetz verabschiedet. Diese Novelle hat einige Auswirkungen auf den Online-Bereich. Erstmals können die einzelnen Bestimmungen des Gesetzes auch auf das Internet bzw. andere elektronische Medien angewendet werden können. Bei der Bestimmung, was als Medium gilt und was nicht, ist die Novelle nicht gerade zimperlich. In einigen Bereichen ist sogar jede beliebige Website vom neuen Gesetz betroffen.
Mediengesetz erweitert
"Schon bisher ging die Rechtsprechung davon aus, dass das Mediengesetz auch für über das Internet verbreitete Inhalte gilt", zieht Franz Schmidbauer, Richter in Salzburg und Experte für Internet-Recht, Bilanz. "Unklar war aber bisher, welche Regelungen konkret anwendbar sind und welche nicht, ging das Mediengesetz doch bisher bloß von Papiermedien und Rundfunk aus".
siehe auch unter Nationalrat beschließt neues Mediengesetz
Impressum für jede Website
Dies hat sich nun geändert. Einer der weitrechendsten Umstellungen ist, dass jede Website - egal ob privat oder kommerziell, umfangreich oder klein - über ein Impressum verfügen muss. In diesem müssen zumindest Name und Adresse stehen, so Schmidbauer zu futurezone.ORF.at - ohne Ausnahme. "Eine Website ist in Zukunft, so wie etwa auch ein mindestens vier Mal jährlich erscheinender elektronischer Newsletter, ein periodisches elektronisches Medium", so Schmidbauer. "Der Betreiber oder Versender wird automatisch zum Medieninhaber." Für Websites, die über die Darstellung des persönlichen Lebensbereiches oder die Präsentation des Medieninhabers hinausgehenden Informationsgehalt aufweisen, der geeignet ist, die öffentliche Meinungsbildung zu beeinflussen, gelten noch strengere Regeln.
Umfangreichere Pflichten
Neben einem umfangreicheren Impressum gibt es eine Reihe von Pflichten und möglichen Ansprüchen: Zahlung von Entschädigungsbeträgen bis 100.000 Euro, Veröffentlichung einer Gegendarstellung, Offenlegungspflicht, Kennzeichnungspflicht für entgeltliche Einschaltungen, Urteilsveröffentlichung, Beschlagnahme [Löschung der Website] sowie Mitteilung über Verfahrenseinleitung.
Die Änderungen im Mediengesetz siehe hier
Gesetz tritt am 1. Juli in Kraft
"Das Hauptproblem an dieser Regelung ist ihre Unbestimmtheit", kritisiert Schmidbauer. "Wann weist eine Website einen Informationsgehalt auf, der geeignet ist, die öffentliche Meinungsbildung zu beeinflussen?"
Auf die Absicht des Betreibers kommt es dabei nicht an, sondern nur auf die objektive Eignung.
So wird als Beispiel angegeben, dass wenn auf der Website eines Gärtnereibetriebes auch umweltpolitische Themen erörtert werden, dies ausreicht, um zur vollen Anwendung des Mediengesetzes zu gelangen.
Die Gesetzesnovelle gelangt nun in den Bundesrat, der es in den nächsten Wochen absegnen soll. In Kraft treten sollen die Änderungen bereits am 1. Juli 2005.
(C) Hannes Stieger, Futurezone, ORF
14)