Bitte geben Sie dazu das konventionelle Zitat der schriftlichen Fassung an, auch wenn sie Ihnen nicht vorliegt. Die benötigten Angaben finden Sie zu Beginn jedes Aufsatzes. Fügen Sie dem Zitat die URL = die eindeutige Internet-Adresse in der domain der Zeitschrift ars musicologica hinzu.
Verwenden Sie bitte auch in dem Fall, daß Sie diese Arbeit in der Kopie oder einem Zeitschriften-mirror auf einem anderen Server vorfinden, die originale URL, die aus diesem Grunde zu Beginn der Arbeit ausdrücklich angegeben ist.
Zur Bedienung: Durch Klicken auf Anmerkungsziffern springen Sie zur Anmerkung bzw. zurück in den Text. Durch Klicken auf eine Überschrift gelangen Sie vom Inhaltsverzeichnis in den Text bzw. zurück ins Inhaltsverzeichnis.
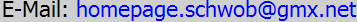 >
>'Komponieren' kommt von 'componere', d. h. 'zusammenfügen'. Üblicherweise stellt man sich dazu einen 'klassischen' oder 'romantischen' Komponisten vor, der erst ein Motiv erfindet, daraus ein Thema, dann weitere Motive und Themen und das alles zu seinem Werk zusammenfügt. Beim einen Komponisten geht dies explosionsartig vor sich: das allererste Motiv wird zum Urknall des späteren Werkes. Bei einem anderen könnten Themenfindung wie Zusammenfügen einem ständigen inneren Kampf gleichen. Doch in beiden Fällen entsteht das Ganze aus dem Detail.
Alban Bergs Kompositionsmethode2 ist grundsätzlich anders: hier entsteht das Detail aus der Konzeption der Großform. Zunächst schreibt er das Libretto, entscheidet sich für Satzidee(n) und Formplan, erstellt die Ur-Reihe, arbeitet in einer riesigen Tabelle alle verwendbaren Reihenableitungen und Transpositionen heraus, erstellt Rhythmen-Tabellen, definiert die Generaltempi, die dynamische Entwicklung und die genaue Anzahl an Takten, die jede Szene haben soll. Beim Schreiben des Particells hält er sich fast immer exakt an diese Vorgaben, führt also das selbst gesetzte Schema aus.
Danach betrachtet Berg das Werk als fertig, denn das Ausschreiben der Partitur erscheint ihm nur als Anfüllen des Ausgeführten. Entsprechend gibt es auch keine Entwurfspartitur; das dem Particell folgende Stadium ist bereits die Partitur in Reinschrift.
Das entstehende Werk unterliegt also keiner zufälligen Fortspinnung, sondern wird erst im Großen, dann immer kleinräumiger und schließlich im kleinsten Detail geplant. Das mußte Alban Bergs Überzeugung nach wohl so sein, denn mit der Aufgabe der Funktionsharmonik gibt es keinen durch die Erwartung nahegelegten Standard-Verlauf mehr, an den man sich halten oder den man zur Überraschung aller an einer bestimmten Stelle verlassen kann. Damit das Endprodukt nicht zufällig oder willkürlich, sondern beabsichtigt und folgerichtig erscheint, kann der Komponist zwei Wege einschlagen: entweder er hält es in aphoristischer Kürze (wie Webern in einigen Werken) oder er beachtet eine strenge Form, die von Symmetrien und Parallelen derart durchsetzt ist, daß der Hörer zumindest unterbewußt die Ordnung als solche akzeptiert. Wirkungsvoller noch als durch die Übernahme von Schönbergs Dodekaphonie hat Berg durch strenges Formdenken das Fehlen der formbildenden Kraft der Funktionsharmonik überwunden.
Wer eine detaillierte Analyse ausführt, setzt sich oft der Kritik aus, etwa in bezug auf Zahlensymbolik oder Symmetrie die Analyse zu weit betrieben zu haben oder zumindest viel weiter, als der Komponist es bewußt getan hat. Im Falle Alban Bergs hingegen meint man als Forschender, nur einen kleinen Teil seiner Überlegungen zu erahnen.
Um anschließend die konkrete Situation des Prolog-Entwurfs besser verdeutlichen zu können, sollen hier (mit Hilfe von Rudolf Stephans Beitrag)3 weitere Hinweise zu Bergs Arbeitsweise gegeben werden. Berg komponierte grundsätzlich am Klavier und unterschied sich damit von seinem Lehrer Schönberg oder auch von Hindemith; ebenfalls am Klavier komponierten etwa Webern, Bruckner und Strawinsky. Wie erwähnt, hatte Berg einen starken Hang zur Übersystematisierung; so finden sich auf seinen Skizzenblätten oft mehr Berechnungen als Noten, so hakte er beim Schreiben der Partitur die am Rand des Particells notierten Instrumente ab, wenn er die Stimme fertiggeschrieben hatte. Berg benötigte sowohl einen Anlaß als auch eine innere Motivation zum Komponieren; Anlaß konnten etwa ein Auftrag (wie im Falle des Violinkonzerts durch den Geiger Louis Krasner) oder auch ein runder Geburtstag seines Lehrers Schönberg sein; die innere Motivation bezog sich auf etwas, das Berg naheging (wie der Tod von Manon Gropius beim Violinkonzert) oder auf seine eigene Erfahrung (wie im Fall von Wozzeck Bergs Kriegsdienst im ersten Weltkrieg). Manchmal scheint er eine solche Erfahrung krampfhaft gesucht zu haben (Rudolf Stephan erwähnt etwa die "lächerlichen Abenteuer", die Berg in der Zeit, als er die Lulu komponierte, gesucht habe4). Ein Bekenntnis zur Menschlichkeit ist bei der Wahl des Lulu-Stoffes wohl ebenso ausschlaggebend gewesen wie im Falle des "Wozzeck".
Nicht leichter als die Frage nach der inneren Motivation ist die des Anlasses von Lulu. Nachdem der Wozzeck einen respektablen Erfolg erzielt hatte und als eines der ersten Werke Bergs internationale Beachtung fand -- d. h. überall mehr als in Wien --, scheint es für Berg nie in Frage gestanden zu haben, wieder eine große Oper zu schreiben. Wahrscheinlich hatte er von verschiedenen Dirigenten und Intendanten neben einer grundsätzlichen Ermutigung auch mehr oder weniger konkrete Zusagen, seine nächste Oper aufzuführen.
Einen konkreten Auftraggeber, den Berg als freiberuflicher Komponist existentiell und psychologisch benötigte, hat es wohl anfangs nicht gegeben, später haben die Universal Edition und interessierte Opernhäuser (nach 1933 nicht mehr in Deutschland, aber in den USA und Zürich) in gewisser Weise diese Funktion übernommen; daß Berg dies so empfunden hat, zeigt sich etwa in einem Brief an Weber (Ende 1931), in dem es heißt: "ich arbeite langsam, wie immer, wenn ich warten kann, können es die U.E. und die USA auch." 5
Als Voraussetzung mußte Berg zunächst die zwei ziemlich langen Wedekind-Dramen zu einem kompakten Libretto verkürzen, was nicht ohne interpretierende Bearbeitung möglich war; der Komponist bewies dabei wie schon beim Wozzeck ein beachtliches dichterisches Feingefühl. Diese Arbeit wurde im Frühjahr 1929 beendet, also noch vor dem Vertrag mit Wedekinds Erben im August desselben Jahres. Während der Arbeit am Libretto scheint Berg auch die für seine Arbeitsweise notwendigen Reihentabellen, Rhythmusskizzen etc. angefertigt zu haben. Anschließend arbeitete er am Particell, und zwar vom Herbst 1929 bis Juli 1931 am ersten Akt, dann bis September 1933 am zweiten und bis Frühjahr 1934 am dritten Akt. Der Prolog wurde zuletzt komponiert. Im April 1934 war das Particell komplett. Den Sommer dieses Jahres verbrachte Berg mit der Zusammenstellung der sog. "Lulu-Suite" und den "Symphonischen Stücken aus der Oper Lulu", die er als eine Art Werbung bzw. "Propaganda" 6 verwenden wollte. Diese 'symphonischen Stücke' hörte er als einziges Stück der Lulu-Musik kurz vor seinem Tod bei einem Konzert in Wien.
Nachdem der Komponist schon im Sommer 1929 die Konzertarie "Der Wein" eingeschoben hatte, unterbrach er von April bis August 1935 die Arbeit an der Instrumentation der "Lulu", um das Violinkonzert zu schreiben. -- Im Dezember 1935 starb Alban Berg an einer Blutvergiftung, ohne die Instrumentation des dritten Aktes abgeschlossen zu haben. -- Die Fertigstellung der Instrumentationslücken durch andere Komponisten wurde von der Witwe Helene Berg bis zu ihrem Tod 1976 verhindert, doch schon ein Jahr später begann Friedrich Cerha trotz einiger Widerstände offiziell mit der Instrumentation. 1979 erfolgte in Paris unter Pierre Boulez die Uraufführung der vervollständigten Fassung, die teils auf große, teils auf keine Akzeptanz stieß.
Wenn der hier untersuchte Entwurf zum Prolog mit dem 23. Juni 1928 datiert ist, muß es sich also entweder um eine der ersten musikalischen Arbeiten an "Lulu", wenn nicht überhaupt die erste, 7 oder um ein Mißverständnis unsererseits mit der Datierung handeln. Ein solches Mißverständnis könnte etwa darin bestehen, daß das Datum älter ist als das Notat darunter. Diese Möglichkeit wird weder von den beiden Autoren, die sich bisher mit diesem Entwurf in Aufsätzen beschäftigt haben, Thomas F. Ertelt (1986) 8 und Douglas M. Green (1991),9 noch von der Lulu-Skizzenforscherin Patricia Hall in ihrem Buch zu den autographen Lulu-Quellen (1996)10 in Erwägung gezogen.
Tatsächlich bestätigt auch das verwendete musikalische Material, daß dieser Entwurf im Rahmen der Lulu-Komposition sehr früh entstanden sein muß (s. u.). Ertelt meint sogar, es sei "nicht abwegig, daß für den Komponisten selbst mit der Niederschrift des Prologentwurfs der Akt des 'Komponieranfangs' zu 'Lulu' (nach Maßgabe einer zusammenhängenden Niederschrift also) vollzogen wurde. Dem entspräche auch die äußere Form, die einer Reinschrift nahekommt, jedenfalls von nachdrücklicher Sorgfalt zeugt; ganz im Gegensatz zur extremen Flüchtigkeit, mit der die Skizzen für die Endfassung hingeworfen sind".11
Was Ertelt hier nicht erwähnt, ist, daß es offenbar zwei Schichten oder zwei Arten des Umgangs mit dem Entwurf gibt: einerseits eine sehr sorgfältig geschriebene, particellartige Niederschrift, andererseits die Aufgabe der Reinschrift durch Hineinkritzeln, wildes Durchstreichen (statt Rasieren / Radieren, wie man es bei einer Reinschrift vielleicht erwarten könnte) etc.
Wie gesagt: die Endfassung des Prologs wurde nach einem Brief Bergs an Webern am 28. April 1934 in Angriff genommen und ist damit der letzte im Particell fertiggestellte Teil der Oper.
Das Schreiben der Einleitung hat hauptsächlich den Effekt, daß man damit einen Anfangspunkt setzt. Würde der Autor mit einem beliebigen Kapitel des Buches (bzw. der Komposition einer beliebigen Szene der Oper) beginnen, hätte er vielleicht Sorgen, sich zu verzetteln oder etwas zu schreiben, was sich später nicht in das Gesamtkonzept fügt.
Aus diesen Überlegungen ist Thomas Ertelts Theorie, Alban Berg hätte mit diesem Entwurf den Beginn der eigentlichen Komposition gesetzt und daher ein zumindest anfangs außerordentlich sauberes, reinschriftähnliches Particell angefertigt,12 das ihm später jedoch nicht mehr verwendbar erschien, einleuchtend und plausibel -- wenn auch kaum beweisbar.
Die seit den Anfängen der Musikwissenschaft lebhaft diskutierte Frage, ob und wie man Skizzen für die Analyse heranziehen kann, hat Patricia Hall im Einleitungskapitel ihres Buches über die autographen Lulu-Quellen gestellt und in Einschränkungen bejaht. Vorsicht ist auf jeden Fall geboten, wie selbst die Skizzenforscherin zugibt. Doch: "[...] while everything is in the printed score, we often fail to perceive or understand its organization. [...] properties of Berg's music that may be difficult to recognize in the finished score suddenly become obvious when laid out in a sketch."13 Daher kann eine Skizze Informationen preisgeben, die im fertigen Werk nicht mehr angegeben, aber dennoch musikalisch vorhanden sind. Die (von Hall nicht explizit diskutierte) Gefahr besteht in Fehldeutungen: in der Skizze könnte etwas stehen und erklärt sein, das im Original in dieser Form nicht mehr aufscheint, aber vom Analysierenden dort hineininterpretiert wird.
Im Falle des vorliegenden Entwurfs ist diese Gefahr gering; die Unterschiede zur späteren gültigen Fassung sind zu groß, daß man ernsthaft auf die Idee kommen könnte, den Entwurf zur Analyse heranzuziehen. Es verbleiben zwei hauptsächliche Fragenkomplexe.
Erstens könnte man nach dem Grund für die Unterschiede fragen: handelt es sich um den Entwurf für eine ganz andere Version, und warum hat Berg diese verworfen?
Zweitens könnte man die bei genauerem Hinsehen vorhandenen Gemeinsamkeiten in den Vordergrund stellen und fragen: Hatte Berg den Entwurf noch vorliegen? Oder hatte er ihn noch unscharf im Kopf? Oder ist die Endfassung völlig unabhängig vom Entwurf komponiert, so daß etwaige Ähnlichkeiten nur darauf zurückzuführen sind, daß der gleiche Komponist auch sechs ereignis- und entwicklungsreiche Jahre später die gleiche Textstelle noch ähnlich komponiert?
Eine Auswahl der dazu relevanten Fakten soll hier präsentiert werden, ohne daß sich durch sie eine eindeutige, ohne Interpretation auskommende Antwort auf diese Fragen, letztlich also die Frage nach extremer Überarbeitung oder völliger Neukomposition, ergeben kann.
Er umfaßt einen Bogen 12zeiliges15 Notenpapier à zwei Blätter. Die Seiten haben eine Größe von 26,5 x 34 cm. Auf der Vorderseite des Bogens (fol. 1r) befindet sich ein Markenzeichen mit einer Art Wappentier und den Initialen "J.E.", darunter "No 2 12linig".16 Als Schreibwerkzeug diente hauptsächlich Bleistift, es sind aber auch Eintragungen mit Buntstiften in mehreren Farben vorhanden. Alle vier Seiten des Bogens sind beschriftet:
Die weiteren Systeme sind im Stile eines Klavierauszugs, d. h. mit Singstimme
und Klaviersystem, notiert.
Während die Singstimme bis zum Ende der Seite und auch noch drei
Takte auf der folgenden Seite (fol. 2r) notiert ist -- die Noten wirken
sehr vorläufig, aber der Eindruck resultiert hauptsächlich aus
der Verwendung kopfloser Noten zur Notation des Sprechgesangs --, bricht
das Particell der Orchesterstimmen allmählich ab: im zweiten System
in T. 6 sind erste Anzeichen von Korrekturen und weniger deutliche Bleistifteintragungen
erkennbar, in T. 8 hört das Notat völlig auf.
Die Deutlichkeit des Bleistiftnotats steht in Zusammenhang mit der beim
Schreiben aufgewendeten Andruckkraft, diese wiederum mit der Schreibgeschwindigkeit.
Es ist jedoch fraglos erkennbar, daß der Komponist nach einem
überdeutlichen Beginn der Niederschrift zunehmend weniger Sorgfalt
auf die Lesbarkeit gelegt hat. Neben der sauberen Schrift gibt es ein weiteres
Indiz dafür, daß er zunächst eine Reinschrift geplant hatte:
er hat zwischen den Systemen je eine Notenzeile freigelassen, ein bei Skizzen
unüblicher, bei Reinschriften hingegen häufig verwendeter Brauch.
Zahlreiche Eintragungen ergänzen den Notentext: der gesungene
bzw. gesprochene Text, Regieanweisungen, Angaben über zu verwendende
Instrumente (z. B. "col Fag:[otto]" über der Singstimme zu Beginn
des zweiten Systems), Dynamikbezeichnungen und eine Reihe von Angaben zu
den verwendeten Reihen. Letztere sind teilweise mit Buntstiften verschiedener
Farben (oliv, rot), teilweise auch mit Bleistift geschrieben, ohne daß
ein offensichtliches System erkennbar wäre.
Auf dieser Seite (fol. 1v) befindet sich auch die für die chronologische
Einordnung wichtige Datierung, schräg ins linke obere Eck geschrieben:
"23/6. 28", also der 23. Juni 1928.17
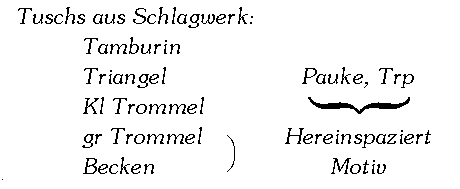
Die drei instrumentalen Takte vor dem Auftritt und Einsatz des Ausrufers zeigen einen sukzessive einsetzenden zwölftönigen Klang, der sich nicht ohne weiteres aus der Urreihe der Oper herleiten läßt. Besondere Kennzeichen dieses Klanges sind die Triller auf jeder der ausgehaltenen Noten, durch die die sechs einsetzenden Töne zum schwirrenden zwölftönigen Komplex werden, und die erstaunliche Tatsache, daß die ersten drei Noten einen C-Dur-Dreiklang ergeben. Es war für Berg wohl ein reizvoller Gedanke, seine erste Oper nach Regeln der Dodekaphonie mit einem solchen zwölftönigen Klang beginnen zu lassen, wobei das vermeintliche C-Dur am Anfang als eine seiner zahlreichen Reminiszenzen an die Dur-Moll-Ära gedeutet werden müßte. Interessanterweise hat Berg die Idee mit dem 12-Ton-Klang, die in der Planungsphase immer wieder nachweisbar ist, in der endgültigen Fassung verworfen und überhaupt in der ganzen Oper nicht verwendet.20
Der nun einsetzende Ausrufer beginnt mit zwei halb gesungenen Noten und wechselt dann auf zunehmenden Sprechgesang über, wobei Berg ab T. 6 überhaupt keine Notenköpfe mehr notiert hat. Während die Singstimme in dieser Weise bis T. 13 auf der nächsten Seite (fol. 2r) ausgeführt ist (und damit den Textabschnitt von "Hereinspaziert" bis "das menschliche Genie" umfaßt), ist die Begleitung nur bis T. 8 eingetragen und zudem ab T. 6 heftigen Änderungen durch Streichungen unterzogen worden. Es ist fast so, als ob man den Komponisten beim Aufgeben des Entwurfs sehen könnte. Dennoch scheint Berg diese Probleme anfänglich nicht für unlösbar gehalten zu haben,
denn am Rest von Blatt 2r sind Notizen zur Ausführung des restlichen Prologs, insbesondere zu Sprachmelodie und Schlagwerk, zu finden. Bis zum letzten "Hereinspaziert" sollten die Tuschs des Schlagwerks zunehmend variiert und gesteigert werden, als Übergang zur ersten Szene (Alwas "Darf man eintreten?", in der Endfassung "Darf ich eintreten?") waren die ersten vier Takte "rückläufig" bis zum Liegenbleiben des Trillers auf c' und e' vorgesehen.
In den folgenden Takten dominiert musikalisch die Melodie des Sprechgesangs bzw. Gesangs, die eine genaue Textausdeutung darstellt, über das Instrumentarium, obwohl die Orchestrierung mit einigen Effekten (etwa den mit dem Unterarm zu spielenden Cluster im Klavier in T. 16) und den Gebrauch des (Zirkus-) Schlagwerks abwechslungsreich gestaltet ist. Bei aller relativen Unabhängigkeit der Orchesterstimmen (im Sinne von rhythmischer Polyphonie, z. T. mit Imitation) macht der Komponist dennoch wiederholt Gebrauch vom schon zu Beginn des Prologs verwendeten Mittel der kollektiven Aufwärts- und Abwärtsbewegung, am ausgeprägtesten beim 'Attacca' am Schluß (T. 80) zu einem zirkusgerechten Trommelwirbel.
Auffällig ist vor allem, daß Berg in der Endfassung auf den
Effekt mit dem Triller in allen Stimmen, der der wesentliche Gedanke des
Entwurfes ist, völlig verzichtet. (Nur das Tambourin hat einen Triller
vorgezeichnet, diesen aber mit der Bemerkung "bedeutet: schütteln".)
Die starke Bewegung nach oben und dann nach unten in fast allen Instrumenten
ersetzt den Effekt des Trillers. Wie er in fertiger Instrumentation geklungen
hätte, können wir uns leider nur vorstellen.
Bald nach dem Beginn der Komposition des ersten Aktes klagte Berg in einem Brief an Schönberg, daß es schwer sei, eine ganze Oper auf der Basis einer Reihe zu komponieren (s. u.). Zum Vergleich müßte man sich die Schwierigkeiten vorstellen, die ein Komponist hätte, wenn er ganze Oper in einer einzigen Tonart komponieren sollte! Daher bereicherte Berg später das zur Verfügung stehende musikalische Material um Nebenreihen und Ableitungen der Grundreihe.23
Der Entwurf zum Prolog gehört noch der Phase der Komposition mit einer Reihe an, die Endfassung als eines der letzten komponierten Stücke der Oper hingegen der Zeit mit dem umfangreichsten ausgearbeiteten Rohmaterial. Daraus resultiert ein grundlegender Unterschied in der Ausgangsbasis und im verwendeten Material.
Mit diesem Argument kann man erklären, warum Berg den Entwurf 1934 nicht wieder aufgegriffen hat, aber nicht, warum er 1928 nach einigen Takten steckengeblieben ist.
b. Eine Parallele sieht Green zwischen der Bemerkung im Entwurf, zum Schluß die vier ersten Takte rückläufig zu spielen, und dem Schluß des Prologs in der Endfassung.24 Ob dieser Bezug beabsichtig ist, kann jedoch nicht mit Sicherheit behauptet werden; schließlich handelt es sich in erster Linie um ein Echo oder auch einen Krebs vom Rhythmus zum letzten "Hereinspaziert" des Tierbändigers. Green beklagt, daß dieses Detail wegen zu großer rhythmischer Freiheiten der Ausrufer in keiner der von ihm gehörten Aufnahmen wahrnehmbar ist, doch ist dieses Argument nicht unbedingt ausschlaggebend, da in Bergs Opernpartituren vieles nur visuell oder gar nur forschend rezipiert werden kann. Auch aus den Partituren beispielsweise eines Mozart kann man nicht jedes raffinierte Detail hörend rezipieren.
c. Bereits in den ersten Worten des Ausrufers findet Green einige Elemente, die in der Oper leitmotivisch werden sollten, etwa die 'Maler-Akkorde' oder die 'Medizinalrats-Terzen',25 ohne jedoch eine Begründung ins Felde zu führen, warum diese 'Leitmotive' zum Beginn des Prolog-Entwurfs in einer Beziehung stehen könnten. Einige Takte später, die freilich im Entwurf nicht ausgeführt sind, bei der Aufzählung der Tiere, die der Tierbändiger dem Publikum zu zeigen gedenkt, könnte die Verwendung leitmotivischen Materials einen Sinn ergeben, hier aber nicht. Grund für diese unadäquate Materialverwendung ist, daß Berg zu diesem Zeitpunkt die Leitmotive noch nicht ausgearbeitet hatte. Diese Ähnlichkeiten sind ihm sozusagen passiert, oder er hat später Raubbau in seinem Entwurf betrieben. Hier läge folglich ein Grund vor, weshalb er diese Fassung 1934 nicht wieder aufnehmen konnte.
d. Patricia Hall betont die multiplen Charaktere in Lulu, d. h. die Tatsache, daß Berg gewisse Personen verschiedener Akte als ident betrachtet hat. Insbesondere entsprechen die Freier bzw. Besucher der Prostituierten Lulu im 3. Akt ihren Opfern in den vorangegangenen Akten.26
Somit wäre es logisch, daß der Prolog eine zentrale Rolle einnimmt, daß diese Identifizierung über die im Prolog vom Tierbändiger aufgezählten Tiere (Tiger ( Dr. Schön, Bär ( Medizinalrat, Affe ( Alwa, Kamel ( Maler; Schlange ( Lulu) erfolgt.27 Weiters könnte man folgern, daß eine solche Schlüsselstelle, die einerseits die Rolle einer Ouvertüre einnimmt und das Geschehnis vorhersagt, andererseits eine inhaltliche Verbindung zwischen dem ersten Teil der Oper (dem Erdgeist-Teil, Lulus gesellschaftlicher Aufstieg) und dem zweiten (Pandora-Teil, Abstieg) darstellt, zuletzt komponiert worden sein muß. Als Berg die vorliegende allererste Skizze anfertigte, war seine analytische Interpretation des Stoffes noch nicht abgeschlossen. Selbst wenn er den Prolog zu diesem Zeitpunkt fertiggestellt hätte, hätte er später eine Überarbeitung wohl für notwendig gehalten.
Allerdings ist aus diesen Parallelrollen abgesehen von der Tatsache, daß sich in der Praxis der Intendant einige Sänger erspart, nicht so viel geworden, wie sich der Komponist wohl zeitweilig gewünscht hätte. Anhand der Skizzen kann Patricia Hall seine Planung genau aufzeigen, aber die Streichung eines Freiers und andere aus Gründen der Kürzung notwendige Maßnahmen stören die Symmetrie stark.
Daher sind nicht nur im frühen Entwurf, wo es wegen des Standes der Ausarbeitung nicht überrascht, sondern auch in der endgültigen Fassung des Prologs die leitmotivischen Anspielungen auf die verschiedenen Männer des Dramas eher gering ausgefallen: die Musik spielt nicht auf die hinter den Tieren stehenden Personen an, sondern stellt (als Programm-Musik) die Tiere selbst dar, wobei die Tonhöhe der Gesangstimme weiterhin der Sprachmelodie verpflichtet bleibt, der Rhythmus hingegen den Charakter des gerade erwähnten Tieres annimmt.
e. Ein wesentliches Problem von Musik und Literatur ist die Gestaltung der Zeit im Widerspruch zwischen Detail und Ganzem. Üblicherweise tastet sich der Analysierende vom Ganzen ins Detail vor; oft kommt er gar nicht so weit, die Details wieder zusammenzufügen. Diesem Vorgang entspricht der "Bogen", von dem Musiker oft sprechen; gute Instrumentalpädagogen versuchen, ihre Schüler und Studenten von der Taktbetonung zur Gestaltung ganzer Perioden zu bringen -- und gerade hier liegt eines der größten interpretatorischen Probleme.
Das gleiche Problem existiert in der Komposition. So zeigt die Analyse von Schubert-Liedern mit verschiedenen Fassungen (etwa den Harfner-Gesängen), daß der Komponist in den späteren Versionen von der Ausdeutung einzelner Wörter zur Gestaltung des Inhalts vorgedrungen ist.
Für Alban Berg war dieses Problem bei weitem nicht so gravierend wie für andere, da er, wie schon erwähnt, das Detail erst komponiert hat, wenn die jeweils übergeordnete Einheit bereits fertig geplant war. Dennoch fällt im gerade im Vergleich Entwurf -- Endfassung des Lulu-Prologs auf, daß die Endfassung die großen Linien stärker betont und viel souveräner mit dem Detail umgeht. Am deutlichsten kommt dieses Moment beim Einsatz des Tierbändigers zur Geltung: im Entwurf beginnt er auf fester Tonhöhe halb gesungen, setzt dann halb gesprochen fort. Auch in der Endfassung verwendet er an späterer Stelle diese Techniken, am Anfang aber spricht er in freier rhythmischer Gestaltung. Diese Textpassage ist, verglichen mit dem folgenden, nicht so wichtig, daß sie einer Ausdeutung bedarf: es ist nur das 'Hereinspaziert'. In dem Moment, wo der Tierbändiger zu dramatischen Vergleichen greift ("Was seht Ihr in den Lust- und Trauerspielen?! Haustiere, die so wohlgesittet..."), beginnt auch die Notierung der Sprechtonhöhe und des Sprechrhythmus.
Man kann also konstatieren, daß der Weg zum stimmigen Kunstwerk im Großen auch Meistern wie Schubert oder Berg nicht erspart geblieben ist. Die Entwurfsfassung deutet schon die ersten Worte zu stark aus, um zu einer einheitlichen Komposition des ganzen Prologs, der ohnehin gegenüber der Vorlage im Theaterstück "Erdgeist" ziemlich verkürzt ist, führen zu können.
f. Ertelt weist in seiner Arbeit auf gewisse musikalische Probleme im Prologentwurf hin, etwa auf einen nicht konsequent ausgeführten (und damit untragbaren) Krebsgang der Urreihe.28 Überhaupt ist die Einschränkung auf eine Reihe nach seiner Meinung -- und darin kann man ihm gut folgen -- ein Hindernis bei der geschlossenen Gestaltung der Szene, während die lockere Reihung in der folgenden Szene sich dafür besser eignet. Am 9. Juli 1928, zwei Wochen nach dem Abbrechen des Prologentwurfs, schreibt Berg den bekannten Brief an Schönberg, in dem er u. a. sagt: "Aber es geht sehr langsam und schwer vonstatten. Schuld daran trägt wohl die fast 2jährige Komponierpause, dann die immerhin beträchtliche Schwierigkeit, die Musik einer ganzen Oper mit 'einer Reihe' zu bestreiten [...]".29
Später hat Berg als Lösung verschiedene Nebenreihen aus der Hauptreihe abgeleitet, indem er etwa so lange jeden achten Ton der (kreisförmig gedachten) Urreihe nahm, bis er wiederum eine 12-Töne-Reihe hatte. Ein erster Hinweis darauf könnte eine Notiz auf Blatt 2r des Prologentwurfs sein: "das Quartenthema aus den 2+10er Reihen bzw. 8er Reihen enstehen lassen!"
g. Etwas erstaunt ist man, daß Berg im Entwurf den Tierbändiger zu einem Ausrufer degradiert hat. Wie Green richtig bemerkt, ist es zwar plausibler, daß ein Ausrufer das Programm ankündigt als der Tierbändiger; die Tiere vorführen, insbesondere die Schlange, kann jedoch nur der Tierbändiger persönlich. Green führt auch das Argument ins Feld, daß es schade gewesen wäre, die Kleidung des Tierbändigers -- zinnoberroter Frack, weiße Beinkleider, Stulpstiefel, Hetzpeitsche -- aufzugeben (wobei der Revolver von Berg geopfert wurde).30
Man kann den Gedanken aber noch weiter spinnen, als es Green getan hat. Ein Tierbändiger, der seine Arbeit vorstellt, spricht in einer natürlicheren Sprache als ein geübter Ausrufer, der mit einem melodischen Sprechgesang versucht, sich akustisch besser verständlich zu machen. Tatsächlich beginnt im Prologentwurf der Ausrufer mit zwei halb gesungenen Noten, um dann zu halb gesprochenen Tönen überzugehen; der Tierbändiger der Endfassung beginnt weitgehend frei, nur der Rhythmus der ersten und letzten Silben ist ihm vorgeschrieben. So gesehen, ergibt die Änderung der Rollenbezeichnung für die musikalische Gestaltung einen wesentlichen Unterschied.
h. Trotz all dem, d. h. trotz der Tatsache, daß Berg zu Recht den Entwurf verworfen hat, kann man nicht behaupten, daß die Arbeit an diesem Entwurf für ihn vergebliche Mühe gewesen wäre. Nicht nur in die Endfassung des Prologs, sondern auch in andere Szenen der Oper sind Elemente dieser ersten Niederschrift eingegangen, wie insbesondere die von Douglass M. Green gefundenen 'leitmotivischen' bzw. später leitmotivisch gewordenen Elemente zeigen.
Klicken Sie auf den Bildausschnitt, um die Graphik der Edition (31 K) zu öffnen! Mit dem 'Back'-Button Ihres Browsers können Sie von dort wieder in den aktuellen Text zurückkehren.
Ein Faksimile der Skizze wird in Berücksichtigung des Urheberrechtes
nicht veröffentlicht; einen Eindruck geben die Abbildungen bei Ertelt,
Hereinspaziert... und Douglas M. Green, A False Start... (s. Literatur).
Zur bereits erwähnten Titelseite (1r): Hier steht, vertikal zwischen vierter und fünfter Notenzeile und horizontal in der Mitte (zentriert) "Prolog". In den ersten beiden Zeilen befindet sich ein Klaviersystem mit insbesondere metrisch kaum entzifferbaren Noten, deren Zusammenhang mit der hier edierten Skizze unklar ist. Am rechten Rand des Blattes befinden sich vom dritten bis zum fünften Notensystem ebenfalls quasi unlesbare Rechnungen und andere Notizen, teilweise mit rotem Buntstift geschrieben. Ein in der siebten Notenzeile klebender Papierfetzen eines anderen Papierstücks könnte darauf hindeuten, daß hier einmal etwas aufgeklebt war oder werden sollte, oder hier etwas hängengeblieben ist. Weiters befindet sich hier das Markenzeichen des Notenpapierdruckers mit den Initialen "J.E."
Als typische Skizze mit Unstimmigkeiten, uneindeutigen Notaten und 'unleserlichen' Notizen widersetzt sich der vorliegende Entwurf zum Lulu-Prolog einer 'normalen' Edition. Insbesondere solche Feinheiten, die großteils nur im Autograph zu erkennen sind und bereits in einer reprographischen Wiedergabe (Mikrofilm, Fotokopie) verlorengehen, etwa die Verwendung von Buntstiften, die Schwärze (Andruckstärke) von Noten etc. können nicht am Notenblatt der Edition, sondern nur in diesem begleitenden Bericht wiedergegeben werden. Da das Ergebnis der Edition keinerlei praktisch-musikalischen Nutzen (im Sinne von Aufführbarkeit) hat, wurde auf Details Wert gelegt bzw. wurden Fehler etwa in Notenwerten nicht korrigiert. Das optische Erscheinungsbild wurde einschließlich der Zeilenwechsel beibehalten.
Zur Angabe einer Stelle dient folgendes System: Takt, Notenwert, Zeile, Stimme. Die Zeilen sind wie folgt angegeben: Gesang, Instr.[umentalexzerptstimme] 1 bis 2 (bzw. 1 bis 3 im ersten System), Schl.[agzeug] 1 oder 2. Die Taktstriche sind in der Vorlage innerhalb des Instrumentariums durchgezogen, zum Gesang hin unterbrochen, nur zu Anfang gibt es Unregelmäßigkeiten, hinter denen kaum eine Absicht vermutet werden kann und die daher hier nicht wiedergegeben werden.
Zeit
Zeile
Bermerkung
T. 1, 2. Viertel
Instr. 1
Zu welcher Stimme die Viertelpause in der Oberstimme gehört, bzw.
warum sie der Komponist gesetzt hat, ist unklar. Wie die meisten Viertelpausen
des 'reifen' Alban Berg (nach 1908)33
und auch in diesem Entwurf liegt sie quer.
T. 2, 2. Achtel
Schl. 2
Die Beschriftung unter der Notenzeile (darüber steht "Becken")
ist bis auf "gr." nicht gut lesbar; entsprechend der Aufzählung des
Schlagzeuginstrumentariums auf Blatt 2r ist die "gr.[oße] Tr[o]m[mel]"
wahrscheinlich.
T. 2, 2. Viertel
Schl. 1
In der Tambourin-Zeile wurde im Notenwert des 2. Viertels eine Viertelpause
durch eine Achtelpause übermalt; es folgen das in der Edition wiedergegebene
Triangel-Dreieck und -- anstatt des notwendigen Notenwertes einer Achtel
-- eine kleine punktierte Viertel mit einem Hals nach unten, der an der
Note rechts ansetzt.
T. 3
Schl. 1
Die Tambourin- / kl. Trommel-Zeile wechselt im neuen System von ihrem
alten Ort (zwischen Gesang und Instr. 1) zwischen Instr. 1 und 2.
T. 3 ganz
Schl. 2
Die Linie für das eingefügte Schlagzeugsystem, die in T.
2 beginnt, war bis zum Ende der Zeile nach T. 3 fortgesetzt und später
ungebraucht wegradiert, ist aber noch deutlich zu erkennen.
T. 3, 2. Achtel
Instr. 1
"O IX" (Originalreihe, Transposition 9) ist mit olivgrünem Buntstift
geschrieben
T. 3, 2. Achtel bis Taktende
Instr. 3
Die mit "4 Pken" überschriebenen vier Noten sind sehr schwach
geschrieben
T. 4-14
Gesang
Der Gesangstext wird exakt wiedergegeben, nur die Setzung der Silbentrennstriche
erfolgt aus technischen Gründen nicht immer so wie im Autograph.
T. 4
Schl. 1
Die Tambourin- / kl. Trommel-Zeile wird zu Taktbeginn unterbrochen
und beginnt beim 2. Viertel des Taktes von neuem, wenn auch (aus Platzgründen)
etwas tiefer. Sie endet mit dem Takt.
T. 4, 3. Viertel
unter Instr. 2
i: andere Lesungen möglich
T. 5, 4. Achtel
über Instr. 1
"O II" (Originalreihe, Transposition 2) ist mit olivgrünem Buntstift
geschrieben.
T. 5, vor 3. Viertel
unter Instr. 2
"(" ist mit olivgrünem Buntstift geschrieben.
T. 6, 1. Viertel
Instr. 1+2
Bei den Vierteln des Akkordes (c', dis', g', a') handelt es sich wahrscheinlich
um zugemalte Halbe. Solche würden dem zur Taktergänzung erforderlichen
Notenwert (fünf Achtel) eher, wenn auch nicht ganz entsprechen.
T. 6, 2. Achtel
Gesang
Ab hier gibt es in der Gesangstimme nur noch 'kopflose' Noten, die
auch auf Hilfslinien verzichten und die Tonhöhe manchmal nicht exakt
angeben (was wohl auch nicht beabsichtigt war). Diese Noten werden in der
Edition mit ×-Köpfen wiedergegeben.
T. 6, 6. Achtel
unter Instr. 1
"O IV" (Originalreihe, Transposition 4) ist mit olivgrünem Buntstift
geschrieben.
T. 6, 6. Achtel
Instr. 1
g' und a', von der vorigen Note übergebunden, sind sehr schwach
notiert.
T. 6, 3. Viertel
Gesang
Punktierte Achtel: Punkt sehr hoch (knapp unter Balken) oder gar nicht
notiert; Punktierung aber wegen folgender Sechzehntelnote wahrscheinlich.
T. 7, 1. Viertel + 3. Achtel
Gesang
Die in der Edition als e' und c' wiedergegebenen Töne sind ohne
Hilfslinien notiert.
T. 7
Instr. 2
die zwei Akkorde (d' + fis' mit beginnendem Achtelbalken sowie es''
+ g'' als Viertel) sind sehr schwach notiert.
T. 8-T.9
Instr. 1+2
Instr. 1 ist sehr schwach und flüchtig notiert. Die Zeile von
Instr. 2 bleibt in T. 8 leer. Das Notat in T. 9 in Instr. 2 ist wahrscheinlich
die Korrektur zu den durchgestrichenen Noten in der Zeile von Instr. 1.
T. 8
Instr. 1
Metrische Korrektheit im Sinne von drei Vierteln ist hier nicht gegeben,
außer man betrachtet die erste Note im Takt, die eindeutig als Viertel
notiert ist, als Achtel und ignoriert (wie bei einer Verzierung) die metrische
Dauer der beiden Sechzehntel.
T. 8, ca. 2. Viertel
Instr. 1
Im Akkord d'+fis' (Achtel) ist das d' nachträglich 'dazugequetscht'.
Unter dem Vorzeichen des fis' befindet sich ein unleserliches Zeichen;
logischerweise könnte es sich um einen zu tief gesetzten Auflöser
für das (hinzugeschriebene) d' handeln, doch sieht es eher wie eine
Achtelpause aus.
T. 9
Instr. 1
Hier ist allerlei notiert und durchgestrichen (gekritzelt); da das
Notat kaum lesbar ist, wurde auf eine Transkription verzichtet.
T. 9, 1. Achtel (Sechzehntel)
Instr. 2
Die erste Note trägt einen Sechzehntelbalken, der wohl ein Versehen
ist: es gibt keine komplementäre Sechzehntelnote dazu, metrisch ist
eine Achtel erforderlich.
T. 10-14
Instr. 1+2
Ab T. 10 ist keine Begleitung mehr notiert.
2 Die folgenden Fakten stammen aus der gründlichen Untersuchung von Rudolf Stephan, die allerdings andere Akzente setzt. -- Rudolf Stephan: Von der Planung zum musikalischen Kunstwerk. Über Alban Bergs Komponieren. In: Vom Einfall zum Kunstwerk. Der Kompositionsprozeß in der Musik des 20. Jahrhunderts. Hg. v. Hermann Danuser und Günter Katzenberger. Laaber: Laaber-Verlag, 1993. (Publikationen der Hochschule für Musik und Theater Hannover; 4.) S. 253-272.
3 Stephan, Bergs Komponieren (s. o.).
4 Stephan, Bergs Komponieren (s. o.), S. 254.
5 Zitiert nach Douglas Jarman: "Lulu" -- Geschichte und Hintergrund. In: [Begleitheft zur Kassettenedition] Alban Berg: Lulu. Pierre Boulez, Orchestre de l'Opéra de Paris. [Aufn. nach der UA der von Friedrich Cerha vervollständigten Fassung, 1979.] Deutsche Grammophon / Polydor (1979) 3308 345 bis 3308 348. S. 142-144, hier S. 143. -- Das genaue Datum bzw. die von ihm zitierte Vorlage hat Jarman leider nicht angegeben.
6 Jarman, "Lulu" -- Geschichte und Hintergrund (s. o.), S. 143.
7 Andere frühe Arbeiten, die im späteren Werk aufgegangen sind, etwa die Reihentafel vom 17. Juli 1927, hätte Berg auch für das 'Pippa'-Projekt verwenden können -- zumindest wird das vielfach angenommen. -- Vgl. Patricia Hall: A View of Berg's Lulu Through The Autograph Sources. Berkeley -- Los Angeles -- London: University of California Pr., 1996. S. 31.
8 Thomas F. Ertelt: "Hereinspaziert..." Ein früher Entwurf des Prologs zu Alban Bergs "Lulu". In: Österreichische Musikzeitschrift 41 (1986), S. 15-25.
9 Douglass M. Green: A False Start for Lulu. An Early Version of the Prologue. In: Alban Berg. Historical and Analytical Perspectives. Hg. v. David Gable und Robert P. Morgan. Oxford: Clarendon Pr., 1991. S. 203-213.
10 Hall, A View of Berg's Lulu (s. o.). Zum hier diskutierten Entwurf siehe eine relativ kurze Erwähnung auf S. 33 sowie das Faksimile von fol. 1r auf S. 34.
11 Ertelt, "Hereinspaziert..." (s. o.), S. 16.
12 Ertelt, "Hereinspaziert..." (s. o.), S. 16.
13 Hall, A View of Berg's Lulu (s. o.), S. 12.
14 Die Einsichtnahme ins Autograph in der Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek hat dankenswerterweise Hofrat Dr. Josef Gmeiner ermöglicht.
15 Obwohl es sich um eine grundlegende Frage der Notationspraxis handelt, schwimmt hier die Terminologie, insbesondere was "Linie", "Zeile" und "System" anbelangt. Diese Ausdrücke werden hier wie folgt verwendet: das Notenblatt besteht aus 12 Zeilen à 5 Linien, die Zeilen werden durch Akkoladen zu Systemen zusammengefaßt.
16 Dieses Notenpapier scheint Berg in den ersten Jahren der Lulu-Komposition häufig für Skizzen verwendet zu haben. Die unter der gleichen Signatur verwahrte Skizze zur 'Pariser Szene' hingegen ist auf 14zeiligem Papier ausgeführt. Da Berg dieses Papier erst seit 1930 verwendete, muß die Skizze zur 'Pariser Szene' später datiert werden. -- Vgl. Hall, A View of Berg's Lulu (s. o.), S. 29: "Berg used twelve-staff paper almost exclusively in his first two years of writing but gradually switched to fourteen-staff paper in 1930.", weiters S. 47.
17 Diese Seite findet sich faksimiliert in den Aufsätzen von Ertelt und Green und im Buch von Patricia Hall. -- Ertelt, "Hereinspaziert..." (s. o.), S. 17. -- Green, A False Start (s. o.), S. 205. -- Hall, A View of Berg's Lulu (s. o.), S. 34.
18 Diese Seite ist faksimiliert nicht verfügbar, jedoch kommt die 'diplomatische Übertragung" bei Ertelt dem Original relativ nahe. -- Ertelt, "Hereinspaziert..." (s. o.), S. 23.
19 Ertelt, "Hereinspaziert..." (s. o.), S. 15.
20 Ausführlicher zur Rolle des 12-Ton-Klanges hier und in anderen Skizzen zu "Lulu": Ertelt, "Hereinspaziert..." (s. o.), S. 20 u. 22.
21 Die folgende Übersicht beschränkt sich auf für den Vergleich mit dem Entwurf relevante Kriterien bzw. auf Elemente, die man ohne nähere Studien der Partitur hörend oder lesend rezipieren kann, und ist relativ oberflächlich -- verglichen mit dem, was eine gründliche Analyse aus der Lulu-Partitur herauslesen kann.
22 Vgl. dazu Ertelt, "Hereinspaziert..." (s. o.), S. 19.
23 Vgl. das Kapitel V. "The Progress of a Method: Berg's Tone Rows for Lulu" in Hall, A View of Berg's Lulu (s. o.), S. 109-127.
24 Green, A False Start (s. o.), S. 212.
25 Green, A False Start (s. o.), S. 209.
26 Das ist der Hauptaspekt des Aufsatzes von Patricia Hall: Role and Form in Berg's Sketches for Lulu. In: Alban Berg. Historical and Analytical Perspectives. Hg. v. David Gable u. Robert P. Morgan. Oxford: Clarendon Pr., 1991. S. 235-259.
27 Über die Zuordnung zu den Tieren gibt es verschiedene Ansichten, die in unterschiedlichen Auffassungen zwischen Wedekind bzw. seiner Interpretatoren einerseits und Alban Berg andererseits begründet zu sein scheinen; konstant ist dabei nur die Zuordnung des Tigers als (Chefredakteur) Dr. Schön, des Kamels als Maler (Kunstmaler Schwarz) und -- wie aus dem Text selbst hervorgeht -- der Schlange als Lulu. Peter Unger und Harmut Vinçon ordnen in ihren Anmerkungen zum Erdgeist-Text wie folgt zu: den Bären dem Medizinalrat (Dr. Goll), den Affen dem (Schriftsteller) Alwa, das Kamel dem Maler (Kunstmaler Schwarz). Dietmar Holland identifiziert hingegen bei seiner Erläuterung der Oper "Lulu" den Tierbändiger mit Alwa (und damit mit 'Alban' Berg), den Bären mit dem Athleten, den 'kleinen amüsanten Affen' mit den drei Tenorbuffo-Partien Prinz, Kammerdiener und Marquis, Schigolch als Gewürm, den Medizinalrat sowie den Bankier unter den Reptilien und Molchen, die Gräfin Geschwitz mit dem Krokodil. -- Frank Wedekind: Erdgeist. Die Büchse der Pandora. Tragödien. Hg. v. Peter Unger und Hartmut Vinçon. O.O.: Goldmann, 6. Aufl. [1995]. Textapparat und Anmerkungen, S. 206. -- Dietmar Holland: Inhalt der Oper. In: Alban Berg. Lulu. Texte, Materialien, Kommentare. Hg. v. Attila Csampai und Dietmar Holland. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1985. S. 30-33, hier S. 30.
28 Ertelt, "Hereinspaziert..." (s. o.), S. 18-19.
29 Volker Scherliess: Briefe Alban Bers aus der Entstehungszeit der "Lulu". In: Melos / Neue Zeitschrift für Musik 43/137 (1976), S. 108-114, hier S. 109. Zitiert nach Ertelt, "Hereinspaziert..." (s. o.), S. 19.
30 Green, A False Start (s. o.), S. 210.
31 Ertelt, "Hereinspaziert..." (s. o.), S. 19.
32 Ertelt, "Hereinspaziert..." (s. o.), S. 23.
33
Vgl. Rosemary Hilmar: Katalog der Musikhandschriften, Schriften und Studien
Alban Bergs im Fond[s] Alban Berg und der weiteren handschriftlichen Quellen
im Besitz der Österreichischen Nationalbibliothek. Wien: Universal
Edition, 1980. (Alban Berg Studien.) S. 10.