CERIODAPHNIA PULCHELLA
Carapax
Die Skulpturierung besteht aus unregelmäßigen Polygonen, die
von schmalen Leisten eingerahmt sind (Bild 69). Die caudalen Enden sind
häufig in Zipfel ausgezogen. Die Größe der Polygone nimmt
nach ventral deutlich zu, auch werden sie regelmäßiger und zwar
geht die Tendenz zu annähernd gleichseitigen Sechsecken. Die durchschnittliche
Größe nimmt von dorsal nach ventral etwa um die Hälfte zu.
Ob es sich bei diesem Phänomen der Größenzunahme, wie bei
Daphnia um ein Einfügen oder Weglassen von Grenzen zwischen den einzelnen
Gebilden handelt, ist bei Ceriodaphnia pulchella wegen der Unregelmäßigkeit
der Schuppen nicht feststellbar.
Subskulpturen sind hier weit weniger deutlich ausgebildet, als bei der Ceriodaphnia
reticulata.
Die Skulpturierung setzt sich bis in den Nackenbereich auf Höhe Fornix
fort, der Kopf besitzt als Skulpturierung längliche Polygone.
Der spitz zulaufende Fortsatz des Kopfpanzers in den übrigen Carapax
reicht nicht ganz bis zur halben Gesamtlänge des Tieres.
Die Spina ist kürzer, als die von Ceriodaphnia reticulata.
 |
Bild 69: Ceriodaphnia pulchella; Lateralansicht
in toto. |
Ephippium
Das Ephippium ähnelt in hohem Maße dem von Ceriodaphnia reticulata.
Äußere Form und Skulpturierung sind in etwa ident (Bild 70). Eine
relativ sichere Unterscheidung läßt sich nur anhand der Cuticularstiftchen
treffen. Sie sind bei Ceriodaphnia pulchella am ganzen Ephippium spärlicher
verteilt und etwas länger als bei der vorigen Art, sie erreichen die
Länge von 2 µm (Bild 71). Die Stiftchen sind sehr unregelmäßig
verteilt. Ringbildungen sind sowohl am skulpturierten ventralen Teil, als
auch im Eibereich nur sehr wage angedeutet.
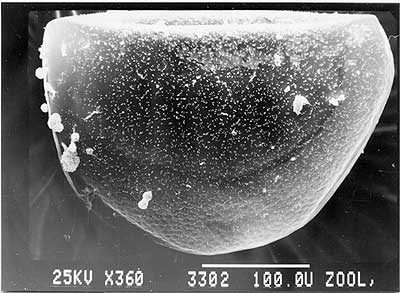 |
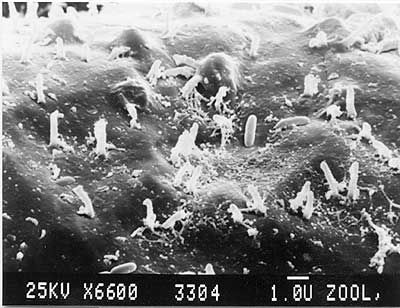 |
Bild 70: Ceriodaphnia pulchella; Ephippium in toto. |
Bild 71: Ceriodaphnia pulchella; Ephippialskulptur. |