CERIODAPHNIA ROTUNDA
Carapax
Die Skulpturierung ist sehr unregelmäßig, die Polygone können
vier bis neun Ecken haben (Bild 78). Die Leisten zwischen den einzelnen
Skulpturen sind derb, bis zu 1,5 µm dick. Die Größe
der Polygone liegt zwischen 10 und 30 µm, wobei die Skulpturen
im dorsalen Bereich kleiner sind (10-15 µm) als auf dem übrigen
Körper. Allerdings ist eine Grenze zwischen den großen und
kleineren Skulpturen nicht so klar zu ziehen, wie z.B. bei Ceriodaphnia
laticaudata.
Subskulpturen sind durchwegs vorhanden, sie sind auf den Skulpturen
unregelmäßig verteilt und ragen meist nur 0,3 µm über
die Cuticula hinaus. Im Bereich dieser Größe ist auch der
Durchmesser der Stiftchen.
Die Art der Skulpturierung setzt sich auch über Nacken und Kopf
fort. Am Kopf sind die ventralen Enden der Polygone spitz ausgezogen
und heben sich von der Cuticula ab. Im lichtmikroskopischen Bild sind
diese Zipfel am ventralen Ende des Kopfes als "Stiftchen"
erkennbar, ein wichtiges Bestimmungsmerkmal dieser Art (Flössner
1972), vor allem zur Unterscheidung von Ceriodaphnia laticaudata (Bild
79).
Die Einsenkung im Nacken ist flach, der nach caudal spitz auslaufende
Teil des Kopfpanzers ragt bis zur halben Länge des gesamten Tieres
in den übrigen Carapax hinein, bei Ephippialweibchen weist er nach
dorsal. Die Spina ist länger als bei der vorigen Art und fehlt
beim Ephippialweibchen.
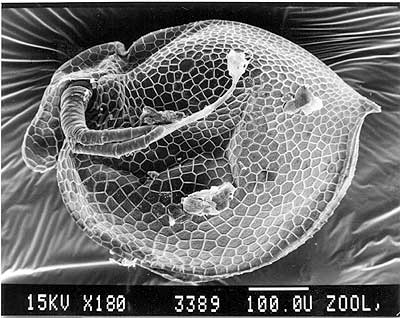 |
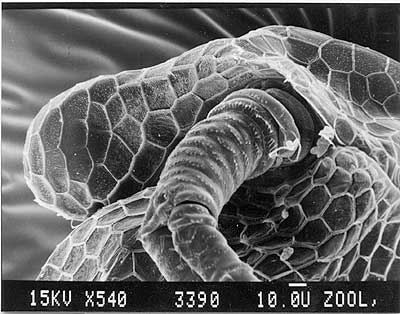 |
Bild 78: Ceriodaphnia rotunda; Lateralansicht
in toto. |
Bild 79: Ceriodaphnia rotunda; Kopf in Lateralansicht. |
Ephippium
Das Ephippium ist typisch für die Gattung (Bild 80). Bei einer Länge
von 350 µm beträgt die Höhe 280 µm. Der "Knick"
am caudalen Ende (siehe Ceriodaphnia reticulata) ist kaum ausgebildet,
das Hinterende ist vielmehr annähernd rund, das Ephippium ist dadurch
fast völlig symmetrisch.
Die Subskulpturen sind bei dieser Art stärker (oder besser: augenfälliger)
ausgebildet, als die Skulpturen. Im ventralen und caudalen Bereich besteht
die Skulpturierung aus den typischen Sechsecken, die durch Einsenkungen
voneinander getrennt sind. Eibereich und Kiel sind kaum skulpturiert,
es gibt lediglich sehr flache Erhebungen. Die größten Skulpturen
haben einen Durchmesser von 10 µm.
Auch eine Musterung, also durchgehende Bahnen der Skulpturen, läßt
sich erkennen, sie entspricht etwa der von Ceriodaphnia reticulata.
Die Subskulpturen prägen das Bild der Oberfläche des Ephippiums.
Sie bestehen aus 1-2,5 µm langen und 0,2-0,3 µm Cuticularstiftchen-(Bild
81). Sie sind auf den Skulpturen zu finden und immer ringförmig angeordnet,
die stumpfen, freien Enden weisen vom Ring gesehen nach außen. Die
Anordnung der Stiftchen in den Ringen ist nicht sehr regelmäßig,
oft stehen auch mehrere Subskulpturen hintereinander (von der Ringmitte
aus gesehen). Im Großen läßt sich sagen, daß die
Durchmesser der Ringe in etwa die Hälfte der Durchmesser der Hauptskulpturen
betragen.
Die Stiftchen sind regional unterschiedlich lang. Die längsten mit
bis zu 2,5 µm Länge finden sich im Bereich des Kieles. Im Eibereich
sind die Stiftchen bis zu 2 µm lang, die kürzesten mit maximal
1,5 µm sind im ventralen und caudalen Bereich auf den Sechsecken
zu finden.
Der Kielbereich ähnelt, mit Ausnahme der Cuticularstiftchen, dem
von Ceriodaphnia laticaudata. Wulstartige Stränge von etwa 20 µm
Durchmesser, die an den caudalen und cranialen Enden spitz zulaufen.
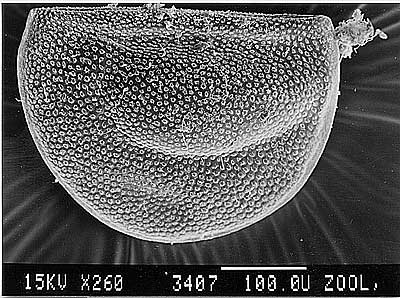 |
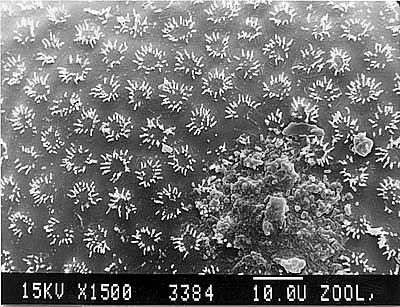 |
Bild 80: Ceriodaphnia rotunda; Ephippium in
toto. |
Bild 81: Ceriodaphnia rotunda; Ephippialskulptur. |