CTENODAPHNIA ATKINSONI
Carapax
Die Carapaxskulptur des parthenogenetischen Weibchens sieht ähnlich
aus wie bei Ctenodaphnia magna, mit dem Unterschied, daß die einzelnen
Quadrate (Seitenlänge etwa 18µm) caudal in keiner Region
des Körpers Zipfel bilden (Bilder 7+8). Die Länge der Spina
beträgt bei den von mir im burgenländischen Seewinkel gefundenen
Exemplaren 2 Fünftel der Gesamtkörperlänge. Als Besonderheit
ist bei Ctenodaphnia atkinsoni die Nackenleiste am dorsalen Kopfteil
zu einer herzförmigen, sog. Nackenplatte verbreitert (Bild 9).
Der Rückenkiel ist auf halber Höhe des Tieres (ohne Spina
betrachtet) eingekerbt. Trägt das Tier ein Ephippium in sich, so
fällt diese Stelle mit dem rostralen Ende des Ephippiums zusammen.
Schließlich teilt sich der Kiel in zwei bestachelte Leisten, die
auseinanderlaufen, sich dann nach median wenden und schließlich,
bereits wieder leicht nach caudad weisend, vereinigen. Die Stacheln
enden noch im caudalen Drittel der Platte, nur die verstärkten
Leisten umschließen die restliche Platte.
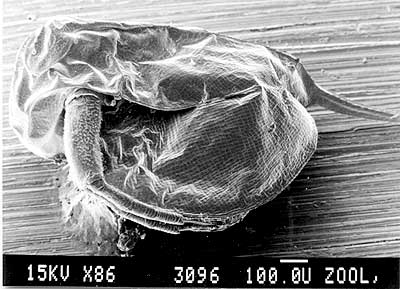 |
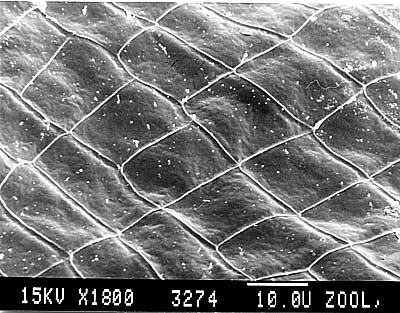 |
Bild 7: Ctenodaphnia atkinsoni; Dorsalansicht
in toto. |
Bild 8: Ctenodaphnia atkinsoni; Carapaxskulptur. |
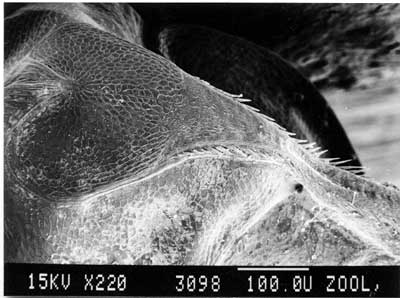 |
Bild 9: Ctenodaphnia atkinsoni; Dorso-lateral-Ansicht
des Nackenbereiches, mit herzförmiger Nackenplatte. |
Ephippium
Das Ephippium ist, von lateral gesehen, leicht asymmetrisch, stets mehr
als doppelt so lang, wie breit und verjüngt sich nach rostral.
Als Anhänge sind bei frischen Ephippien nach caudad stets die Spina
und nach rostrad der geteilte Kiel zu erkennen (Bild 10). Der Kiel teilt
sich bei dieser Art erst nach zwei Dritteln seiner gesamten, über
das Ephippium hinausragenden Länge vollständig (Bild 11; vergl.
Ctenodaphnia similis). Die Lage der beiden Eier ist typisch für
Ctenodaphnia. Die Eier sind wegen der meist dunkelbraunen bis schwärzlichen
Färbung der Ephippialhülle bei dieser Art schwer zu sehen.
Die Skulptur besteht zum großen Teil aus unregelmäßigen,
kuppelförmigen Höckern. Gegen den Rand hin wird die Skulpturierung
meist flacher, vor allem im ventralen Teil reißt das Ephippium
zwischen den Höckern ein. Diese Risse zwischen den Höckern
erscheinen nicht rund, sondern sechseckig (Bild 12). Eine fixe Regel,
daß auch am übrigen Ephippium jeder Höcker von sechs
anderen umgeben ist, läßt sich auch bei näherer Betrachtung
nicht aufstellen. Der Durchmesser der Höcker ist regional stark
verschieden, auf durchschnittlichen Ephippien überschreitet er
jedoch nie 10 µm.
Fundorte
Die Lebensansprüche von Ctenodaphnia atkinsoni sind ähnlich
wie die von Ctenodaphnia magna. Die Art fand sich 1988 unter anderem
in der südlichen Krainerlacke. Sie hatte dort ein sehr frühes
Maximum von Individuen (Ende April), verschwand dann (siehe auch: Löffler
1958), und tauchte im Herbst, nachdem die, im Spätsommer ausgetrocknete,
südliche Krainerlacke wieder gefüllt war, mit einem Maximum
Ende Oktober erneut auf. Sexualtiere waren im Herbst jedoch nicht mehr
zu finden.
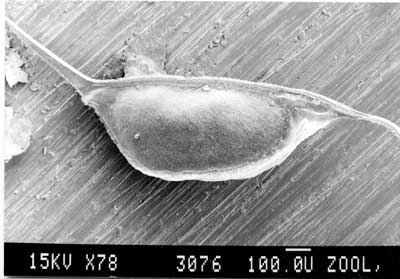 |
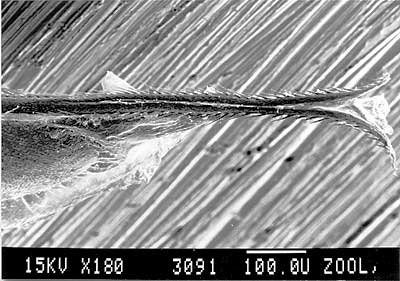 |
Bild 10: Ctenodaphnia atkinsoni; Ephippium
in toto. |
Bild 11: Ctenodaphnia atkinsoni; Caudale Ephippialanhänge. |
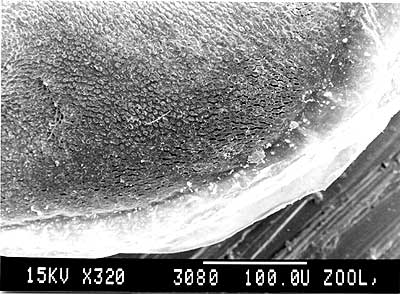 |
Bild 12: Ctenodaphnia atkinsoni; Ephippialskulptur. |