CTENODAPHNIA SIMILIS
Carapax
Bei den netzartigen Quadraten am Carapax von Ctenodaphnia similis (Bild
13) kommt es zu zipfeligen Verlängerungen der nach caudal gerichteten
Ecken (Bild 14). Die Verlängerung ist jedoch nicht so stark, wie
bei Ctenodaphnia magna. In der Diagonalen von rostral?dorsal nach caudal?ventral
ist in der ventralen Hälfte des Carapax eine längenmäßige
Verdoppelung der ansonsten quadratischen Felder zu bemerken (Bild 15).
Durch den Wegfall jeder zweiten Trennlinie entstehen also Rechtecke,
die etwa doppelt so lang wie breit sind. Im ganzen ist die Skulpturierung
des Carapax bei Ctenodaphnia similis eher unregelmäßig. Die
Nackenleiste ist bei Ctenodaphnia similis zwar gespalten, jedoch bleiben
die beiden Längshälften im Tier eng nebeneinanderliegend und
enden, ähnlich wie bei Ctenodaphnia magna, ohne weitere Fortsätze
oder Verbreiterungen auf halber Höhe des Kopfes. Erst mit dem Freiwerden
des Ephippiums teilt sich der Kiel vollständig (s. Ephippium).
Die Spina ist bei Ctenodaphnia similis die längste der Untergattung,
sie kann mehr als ein Drittel der gesamten Körperlänge betragen.
Sie ist dabei sehr zart und spitz und bricht beim Ephippium besonders
leicht ab.
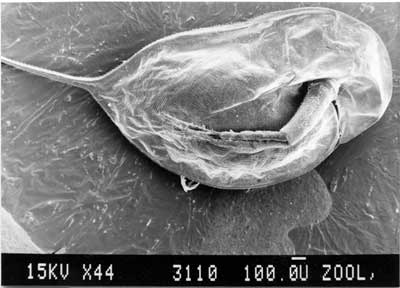 |
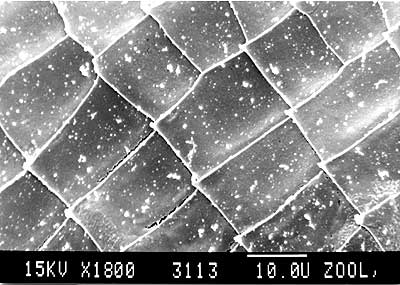 |
Bild 13: Ctenodaphnia similis; Lateralansicht
in toto. |
Bild 14: Ctenodaphnia similis; Carapaxskulptur. |
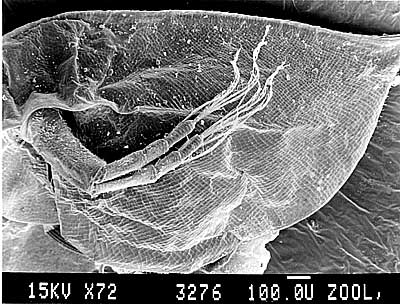 |
Bild 15: Ctenodaphnia similis; Carapaxskulptur
Übersicht. Die dorsalen Schüppchen sind doppelt so groß,
wie die ventralen. |
Ephippium
Das Ephippium entspricht in den Umrissen dem von Ctenodaphnia magna
(Bild 16). Die Färbung ist deutlich heller, leicht rötlich.
Die durchschnittliche Länge ohne Anhänge beträgt auch
hier zwischen 1,0 und 1,3 µm. Die Spina ist steil nach dorsal
gerichtet. Ventral der Spina ist bei dieser Art ein weiterer Rest des
Carapax zu finden. Dieser zeigt noch die normale Carapaxstruktur. Caudal
an diesen Anhang ist eine Doppelreihe Stacheln zu finden, wie auch am
entsprechenden Teil am parthenogenetischen Weibchen. Die Nackenleiste
ist hier auf seiner ganzen Länge, die über das Ephippium hinausragt,
gespalten. Die beiden Anhänge sind mit je einer Stachelreihe versehen
und meist mehr oder weniger stark aufgerollt. Durch diese gekrausten
und bestachelten Anhänge bleiben die Ephippien dieser Art besonders
leicht, z.B. in Fadenalgengewirr oder ähnlichem, hängen und
sind im freien Sediment oft kaum zu finden.
Die Skulpturierung der Ephippien bei Ctenodaphnia similis ist in der
Untergattung am wenigsten differenziert. Im Bereich der Eier sieht man
sehr unregelmäßige Leisten (Bild 17), die sich gegen den
Rand des Eibezirks zu wabenartigen Arealen verdichten. Im Randbereich
besteht die Skulptur aus sehr flachen, unregelmäßigen Schollen
(Bild 18), diese Schollen weichen meist ein wenig auseinander, sodaß
tiefe Furchen entstehen. In vielen Fällen wird eine einzelne Scholle
von 6 anderen umstanden, es können aber auch weniger oder mehr
(bis zu 8 Stück) sein. Von Erhebungen oder auch nur zipfelartigen
Verlängerungen der caudalen Ecken ist bei dieser Art am Ephippium
nichts zu sehen. Die Durchmesser der unregelmäßigen Schollen
schwanken zwischen 5 µm und 10 µm. In Kielansicht fällt
auf, daß der Kiel auch über dem Ephippium zwar nicht gespalten,
aber doch deutlich eingebuchtet ist. Die Spaltung der Stachelreihen
beginnt kurz vor dem rostralen Ende des Ephippiums, also deutlich früher
als bei Ctenodaphnia atkinsoni.
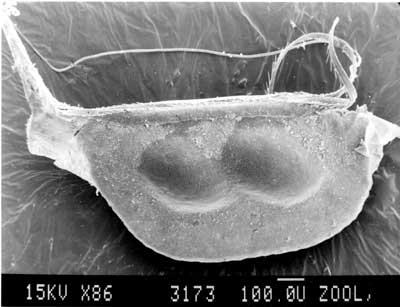 |
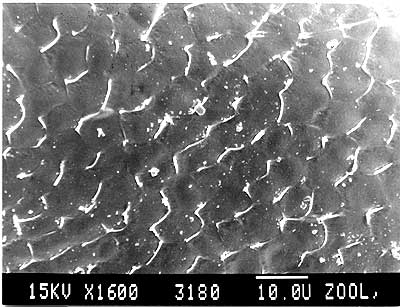 |
Bild 16: Ctenodaphnia similis; Ephippium in
toto. |
Bild 17: Ctenodaphnia similis; Ephippialskulptur
im Eibereich. |
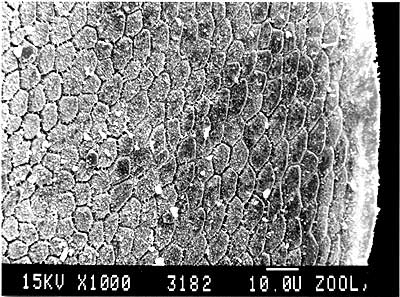 |
Bild 18: Ctenodaphnia similis; Ephippialskulptur
imRandbereich. |
Fundorte
Bevorzugte Gewässer von Ctenodaphnia similis sind stark erwärmte,
salzhaltige Steppengewässer. Nach Brooks (1957) wird sie noch bei
120 Promille Salinität angetroffen. Decksbach (1930) fand sie in
einem Tümpel, dessen Oberflächentemperatur 40 Grad Celsius
betrug. In Mitteleuropa dürfte die Art selten zu finden sein. Die
Art erscheint im Jahr mit einem späten Maximum Ende Mai. Nach den
herbstlichen Regengüssen fand sich in der Lacke neben Ctenodaphnia
atkinsoni auch Ctenodaphnia similis, doch auch hier gab es im Herbst
keine Geschlechtstiere; auch diese Art dürfte im Burgenland einen
Geschlechtszyklus im Jahr haben.