DAPHNIA CURVIROSTRIS
Diese Art dürfte eine der häufigsten Daphniidae in Ost- Österreich
sein. Zur Abgrenzung von der verwandten Art D. pulex dienen die Antenne
1 (die Sinneshärchen ragen direkt aus dem Kopfboden, siehe Bild
19), die fehlende Dorsalbestachelung und die sondenknopfartige Anschwellung
des Rostrums beim Männchen (Bild 20). Aber, wie sich zeigte, können
die beiden Arten auch anhand des Ephippiums sicher von einander unterschieden
werden (s. jeweilige Beschreibung).
Im Wiener Prater, in der Nähe des Lusthaus- bzw. Mauthner Wassers,
fanden sich D. curvirostris und D. pulex gemeinsam in einem Tümpel.
Bastarde oder sonstige Übergangsformen zwischen den beiden Arten
waren dabei nicht zu finden. Sämtliche oben genannten Merkmale
waren jeweils eindeutig ausgebildet.
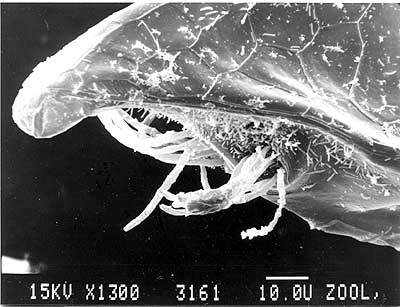 |
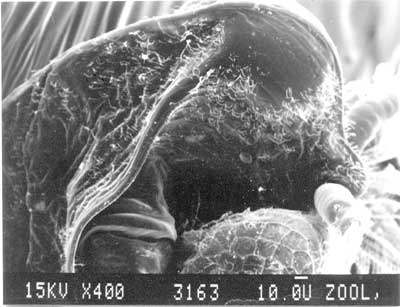 |
Bild 19: Daphnia curvirostris; Rostrumspitze
mit Antenne 1. Nur die Sinnesborsten ragen aus dem Kopf heraus. |
Bild 20: Daphnia curvirostris; Lateralansicht
des Kopfes beim Männchen. Der Ansatz der Antenne 1 ist sondenknopfartig
angeschwollen. |
Carapax
Die Carapaxskulptur ist Daphnia-typisch. Die Seitenlänge der Carapaxschuppen
ist von dorsal nach ventral zunehmend, und zwar durch den Wegfall von
jeder zweiten Zwischengrenze der Schuppen im ventralen Carapaxabschnitt.
Im Gegensatz zu Ctenodaphnia similis findet hier diese Verdoppelung
der Schuppengröße in beiden Diagonalen statt, sodaß
die Schuppen, abgesehen von einigen Rechtecken im Übergangsbereich,
wieder quadratisch sind, eben mit der doppelten Seitenlänge. Die
Seitenlänge der Quadrate beträgt nahe dem Rückenkiel
bei einem durchschnittlichen Exemplar 10-15 µm, nahe dem Ventralrand
rund 20-25 µm. Die gedachte Übergangslinie beginnt cranial
etwa in Höhe des Komplexauges, verläuft dann bogenförmig
nach caudal-ventral, mündet dort 200-300 µm vor der Spina
in den ventralen Schalenrand (Bild 21).
Die caudalen Spitzen der Schuppen sind am Körper leicht spitz ausgezogen,
heben sich aber kaum von der Unterlage ab (Bild 22).
Der Kopfpanzer ragt dorsal etwa bis zu zwei Drittel der gesamten Körperlänge
in den restlichen Carapax hinein und ist nach caudal in einen Zipfel
ausgezogen. Die Grenze zwischen Kopf und Carapax ist nur durch eine
schwach angedeutete Furche gezogen. Deutlicher ist diese Grenze beim
Ephippialweibchen zu sehen (Bild 23). Caudal schliebt sich in diesem
Falle auch unmittelbar das Ephippium an die Grenze Kopfpanzer-übriger
Carapax an. Der dorsale Kiel ist bei Daphnia curvirostris nie über
die ganze Länge bestachelt, bestachelt sind nur die Spina und etwa
150 µm des dorsalen Kieles im Anschluß an die Spina nach
cranial. Die Spina ist bei dieser Art meist nicht sehr lang, Flössner
(1972) gibt die Länge mit einem Viertel des Schalenlänge an.
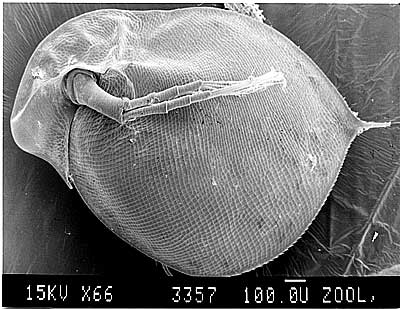 |
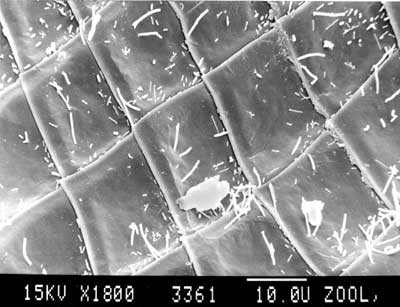 |
Bild 21: Daphnia curvirostris; Lateralansicht
des Weibchens in toto. |
Bild 22: Daphnia curvirostris; Carapaxskulptur. |
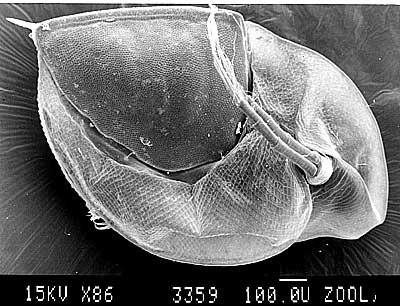 |
Bild 23: Daphnia curvirostris; Ephippialweibchen
in toto. |
Ephippium
Das Ephippium ist asymmetrisch, von der Grundgestalt dreieckig, wobei
das leicht zugespitzte Ende nach caudal weist. Der Dorsalkiel ist wenig
konvex gebogen. Am rostralen Ende ist das Ephippium rechtwinkelig abgestutzt,
auch diese Kante ist, besonders im ventralen Anteil, nach außen
gebogen. Besonders stark ist die dritte Kante gekrümmt, sie führt
in kontinuierlichem Bogen zum dorsocaudalen Ende. Dieses trägt
auch die Spina, die bei durchschnittlichen Exemplaren etwa ein Fünftel
der gesamten Länge des Ephippiums einnimmt. Die Spina ist besonders
zart und verkümmert bei älteren Ephippien bald vollständig.
Die Spina ist bestachelt, die Länge der Stacheln liegt bei 15-20
µm. Die gesamte Länge des Ephippiums beträgt bei den
Exemplaren aus der Umgebung von Illmitz ohne Spina durchschnittlich
750 µm, die größte Breite 600 µm.
Die Lage der Eier ist typisch für die Untergattung, meist liegen
sie symmetrisch zueinander. Die Länge der Eier differiert zwischen
300 µm und 400 µm (Bild 24).
Die Skulpturierung besteht bei Daphnia curvirostris aus unregelmäßigen,
eher flachen Vertiefungen, die von mehr oder weniger stark ausgebildeten
Leisten umrahmt werden. In der deutlichsten Ausprägung der Leisten
ist eine sechskantige Anordnung erkennbar, die Sechsecke stoßen
dann auch an den Kanten aneinander und bilden ein wabenartiges Netz
aus (Bild 25). Die Vertiefungen sind in diesem Bereich flach, länglich
oval bis rund, mit runzeliger Skulptur. Auf diese Weise ist die Ephippialskulptur
nur im caudodorsalen Abschnitt, also in der Nähe der Spina und
entlang fast des gesamten Rückenkieles ausgebildet. Weiter ventral
löst sich der wabenartige Verband der Leisten auf, es bleiben häufig
nur 2 oder 4 Leisten stehen, und zwar die nach rostral-ventral gerichteten.
So entstehen Zickzacklinien, aber auch alleine stehende Skulpturen.
Die Vertiefungen sind in der Regel in diesen proximalen Abschnitten
des Ephippiums tiefer eingezogen und stärker gerunzelt als im caudo-dorsalen
Teil (Bild 26). Gegen den Rand hin werden die Leisten und Vertiefungen
sehr unregelmäßig, häufig stark in die Länge gezogen
und flach, die Leisten können im Randbereich auch völlig fehlen.
Eine Musterung (i.e. regelmäßige Anordnung der einzelnen
Skulpturen) ist am Ephippium von Daphnia curvirostris zwar stellenweise
sehr undeutlich, aber doch erkennbar. Sie entspricht der Anordnung der
Quadrate beim parthenogenetischen Weibchen. Besonders undeutlich ist
die Musterung im Bereich der Eier zu erkennen, da die einzelnen Skulpturen
durch die Auftreibungen über den Eiern stark auseinanderweichen.
Der Kiel des Ephippiums ist bei dieser Art durch eine flache Einsenkung
vom übrigen Ephippium abgesetzt, von dorsal betrachtet ungeteilt
und ohne Stacheln.
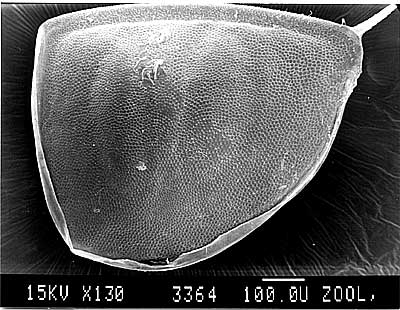 |
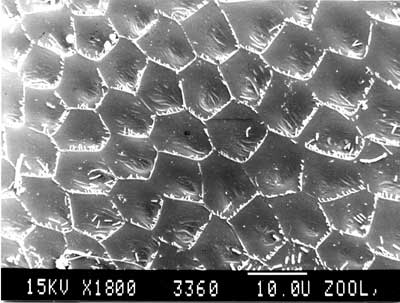 |
Bild 24: Daphnia curvirostris; Ephippium in
toto. |
Bild 25: Daphnia curvirostris; Ephippialskulptur
Eibereich. |
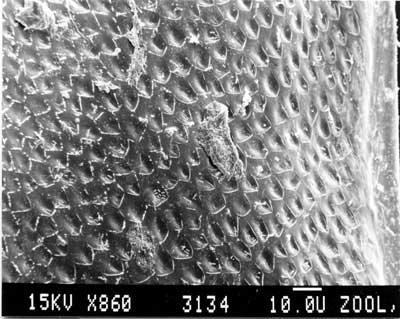 |
Bild 26: Daphnia curvirostris; Ephippialskulptur
Randbereich cranial. |
Fundorte
Angaben über die Verbreitung dieser Art sind äußerst
lückenhaft, da sie früher als Daphnia pulex, bzw. deren Variation
betrachtet wurde (Herbst, 1962; Manujlova, 1964). Neben morphologischen
Untersuchungen bestätigten auch genetische Arbeiten (Trentini,
1980), daß D. curvirostris eine eigene Art darstellt.
Interessant scheinen die Angaben von Naidenov (1967), der die Art als
typisch für periodische Kleingewässer in Flußauen beschreibt
und Hrabacek (1959 b), der die gleichen Beobachtungen für Augebiete
in der Tschechoslowakei berichtet. Dies bestätigt meine Ergebnisse
für die Donauauen östlich von Wien, daß auch dort hauptsächlich
Daphnia curvirostris vorkommt.