DAPHNIA HYALINA
Die Art kommt zwar in Ostösterreich
nicht vor (die untersuchten Exemplare stammen aus dem Wallersee), läßt
aber einen interessanten Vergleich mit Daphnia longispina zu und ist
deshalb erwähnt.
Die Möglichkeit der Hybridbildung mit anderen Arten wird in der
Literatur unterschiedlich bewertet. Flössner und Kraus (1986) schließen
sie weitgehend aus, sie ordnen vielmehr vermeintliche Hybriden zwischen
D. hyalina und D. galeata letzterer Art zu.
Nach genetischen Arbeiten (Wolf and Mort, 1986; Wolf, 1987) existieren
Hyalina-Galeata-Hybriden, spielen aber nur eine untergeordnete Rolle.
Im oberösterreichischen Wallersee kommt neben D. hyalina noch D.
cucullata vor, zwischen diesen beiden Arten schließen auch die
Genetiker Hybridbildungen weitgehend aus.
Carapax
Die Skulpturierung ist daphniatypisch und sehr regelmäßig
rhombisch bis quadratisch angeordnet. Die Seitenlänge der Skulpturen
liegt zwischen 10 und 30 µm. Die Schuppen sind auf dem ganzen
Körper etwa gleich groß (Bild 36). Sie sind sehr flach und
heben sich kaum von den dahinterliegenden Schuppen ab (Bild 37). Im
Lichtmikroskop wirken dadurch die Grenzen zwischen den Skulpturen sehr
zart (>Name: hyalina). Die nach caudad gerichteten Ecken sind sehr
wenig bis gar nicht zipfelig ausgezogen.
Der Kopfpanzer ist fast völlig unskulpturiert (Bild 38), Reste
einer Skulpturierung finden sich an der Rostrumspitze, sowie im Bereich
des Nackens, wo der Kopfpanzer in den übrigen Carapax bis etwa
zur halben Gesamtlänge des Tieres hineinragt. Hier ist die Skulpturierung
auch nur sehr schwach ausgebildet und hat interessanterweise die Form
von regelmäßigen Sechsecken. Die Nackenfalte ist meist flach.
Die Spina ist in der Länge variabel, an der Basis etwas schwächer
als bei Daphnia longispina.
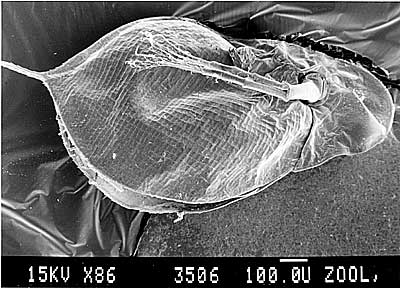 |
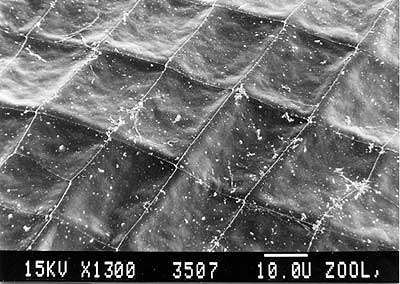 |
Bild 36: Daphnia hyalina; Lateralansicht in
toto. |
Bild 37: Daphnia hyalina; Ephippialskulptur. |
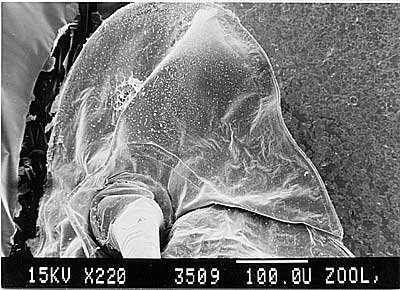 |
Bild 38: Daphnia hyalina; Lateralansicht des
Kopfes. |
Ephippium
Das Ephippium zeigt große Übereinstimmungen mit dem von Daphnia
longispina. Die äußere Form ist mit Ausnahme des Spinaansatzes
und des Kieles (siehe später) praktisch ident (Bild 39). Die dorsale
Kante ist meist gerade bis leicht konvex.
Die Skulpturierung besteht auch hier aus wulstartigen Ringen, die im
Zentrum eingesenkt sind. Diese Einsenkungen sind flacher als bei der
vorigen Art und nie trichterförmig, die Tiefe ist in der Regel
deutlich geringer als der Durchmesser der Einsenkung (Bild 40). Der
Außendurchmesser der wulstartigen Ringe beträgt zwischen
6µm und 9µm. Leisten oder Kanten sind auf dem Ephippium
nicht vorhanden. Auch hier sind die Ringe meist nicht voneinander isoliert
(Bild 41).
Der Kiel ist, wie bei Daphnia longispina, deutlich vom übrigen
Korpus abgesetzt. Er ist unregelmäßig mit bis zu 3µm
langen Zacken besetzt, die bisweilen eine Tendenz zu kammartigen Gebilden
zeigen. Die Zacken sind mit dem freien Ende stets nach caudal gerichtet.
Bemerkenswert ist Ansatz der Spina. Dieser befindet sich nicht, wie
bei anderen Daphnia-Arten im Übergangsbereich von Dorsalkante zur
caudal-ventralen Rundung, sondern fast zur Gänze in der Flucht
der Dorsalkante.
Die Dorsalkante ist, solange das Ephippium noch nicht abgeworfen ist,
leicht konkav gebogen. Vor allem am caudalen Ende wirkt es dadurch leicht
zugespitzt.
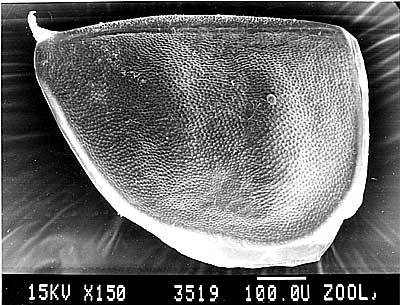 |
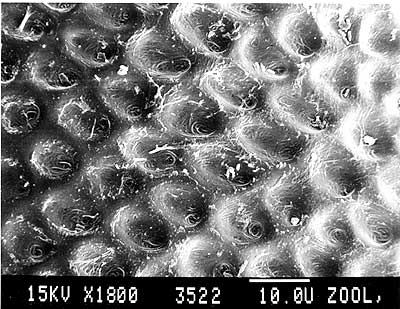 |
Bild 39: Daphnia hyalina; Ephippium in toto. |
Bild 40: Daphnia hyalina; Ephippialskulptur
Eibereich. |
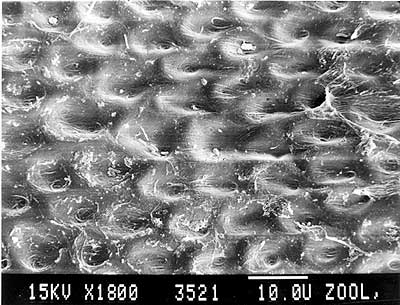 |
Bild 41: Daphnia hyalina; Ephippialskulptur
Eibereich mit verschmolzenen Grenzen. |