DAPHNIA LONGISPINA
Das Taxon kann mit verwandten Arten, vor allem der Hyalina- Galeata-Gruppe,
Hybriden bilden (mündl. Mitteilung von Dr. Hrbacek, Prag). Um Hybriden
weitgehend ausschließen zu können, wurden sowohl Tiere, als
auch Ephippien aus dem oberösterreichischen Mondsee genommen. In
diesem Gewässer kommen zur Zeit verwandte Arten nicht vor, haben
jedenfalls kein Massenauftreten (eigene Beob., limn. Sommerkurs SS 87).
Carapax
Die Carapaxschuppen sind Daphnia-typisch. Es werden regional Schuppengrenzen
eingefügt bzw. weggelassen, jedoch sind derlei Zonen unregelmäßig
über den ganzen Körper verteilt (Bild 32). Auch findet man
aufgrund der unregelmäßigen Anordnung zuweilen Drei-, Fünf-
und Sechsecke mit unterschiedlichen Seitenkantenlängen (Bild 33).
Die Seitenkantenlängen der Schuppen betragen zwischen 10 µm
und 30 µm. Die nach caudal gerichteten Ecken der Quadrate sind
wenig bis gar nicht zipfelig ausgezogen (regional verschieden), auf
jeden Fall noch weniger als bei Daphnia curvirostris.
Der Kopfpanzer ist auch beim parthenogenetischen Weibchen durch eine
durchgehende Falte vom Körper abgesetzt und ragt über die
Hälfte der gesamten Körperlänge (ohne Spina) in den übrigen
Carapax hinein.
Der dorsale Kiel ist nur auf etwa 100 µm, anschließend an
die Spina, bestachelt.
Die Spina ist bei dieser Art meist sehr lang, kann aber auch kurz sein
und bisweilen fehlen (Flössner 1972).
 |
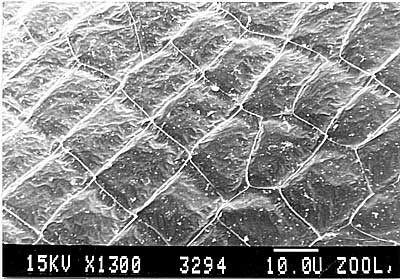 |
Bild 32: Daphnia longispina; Lateralansicht
in toto. |
Bild 33: Daphnia longispina; Ephippialskulptur. |
Ephippium
Die Form des Ephippiums von Daphnia longispina (Bild 34) ist der des
Ephippiums von Daphnia curvirostris sehr ähnlich, nur der Kiel
ist bei dieser Art durch eine tiefe Einsenkung vom übrigen Ephippium
abgegrenzt. Der Kiel ist unregelmäßig mit bis zu 3 µm
langen Zacken besetzt, diese sind mit dem freien Ende nach caudal gerichtet.
Die Länge der Spina unterliegt großen Schwankungen.
Die Skulpturierung besteht durchwegs aus mehr oder weniger runden, kraterförmigen
Erhebungen, wulstartigen Ringen, die in der Mitte wieder eingesenkt
sind (Bild 35). Scharf gezogene Linien oder Leisten, wie bei Daphnia
curvirostris, sind keine vorhanden. Der Außendurchmesser der Ringe
beträgt zwischen 7 µm und 10 µm, die innere Einsenkung
nimmt etwas mehr als den halben Außendurchmesser ein. Meist erreicht
die Tiefe die Länge des inneren Durchmessers, oder übertrifft
diese sogar beträchtlich. Letztere trichterförmigen Einsenkungen
finden sich am häufigsten außerhalb der Eibezirke. In den
flacheren Vertiefungen finden sich zumeist unregelmäßige
kleine Löcher, die möglicherweise auf Pilz und Bakterienbefall
zurückzuführen sind.
Die Krater stehen meist nicht isoliert, die wulstartigen Ringe sind
in mehr oder weniger regelmäßigen Bahnen untereinander in
Verbindung, woraus sich eine Musterung ergibt, die in etwa dem Schuppenverlauf
beim parthenogenetischen Weibchen entspricht.
 |
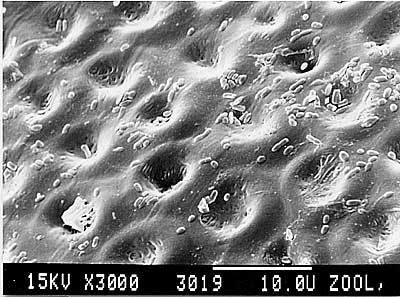 |
Bild 34: Daphnia longispina; Ephippium in
toto. |
Bild 35: Daphnia longispina; Ephippialskulptur. |
Fundorte
Die Art ist sehr anpassungsfähig, kommt in Österreich von
kleinen Tümpeln in Flußauen bis in größere Gewässern
vor. Bei Marchegg fand ich sie auch in einem regelmäßig austrocknenden
Tümpel. Im Seewinkel scheint sie die stark sodahältigen Gewässer
zu meiden, ist in diesem Gebiet jedoch regelmäßig in humösen
Braunwässern zu finden (z.B. in den Resten der Schwarzseelacke
zwischen Apetlon und Wallern).
In großen, perennierenden Gewässern scheint die Art immer
dizyklisch zu sein, mit einer schwachen Sexualperiode von März
bis Juli und einer starken von Oktober bis Dezember. In solchen Gewässern
kann Daphnia longispina auch überwintern. In kleinen und periodisch
austrocknenden Tümpeln und Weihern neigt die Art zur Monozyklie,
das Dichtemaximum mit anschließender Ephippialproduktion ist dann
meist in den Sommermonaten zu beobachten (Flössner 1972; eigene
Beobachtungen).