DAPHNIA PULEX
Carapax
Neben den bekannten Differenzierungsmerkmalen (Antennula (Bild 27),
Dorsalbestachelung) ist die Art auch anhand der Carapax- und Ephippialskulpturierung
klar von Daphnia curvirostris (siehe dort) zu unterscheiden.
Die Skulpturierung ist hier am ganzen Körper von annähernd
gleicher Größe, nur regional werden Schuppengrenzen eingefügt
oder weggelassen (Bild 28). Die Skulpturierung ist im ventralen Bereich
regelmäßiger ausgebildet. Die Seitenlänge einer Schuppe
liegt zwischen 10 µm und 20 µm.
Die caudalen Spitzen der Schuppen sind stärker verlängert
als bei Daphnia curvirostris und spitz zulaufend (Bild 29).
Die Verlängerung des Kopfpanzers ragt bis zu einem Drittel der
gesamten Körperlänge in den Carapax hinein, sie ist beim Ephippialweibchen
leicht nach dorsal gedrückt. Im Bereich des Nackens ist dorsal
der Antenne 2 eine Nackenfalte angedeutet, stärker ausgeprägt
ist dieses Merkmal beim Ephippialweibchen. Eine Nackenfalte ist ansonsten
nur bei der Gattung Ceriodapahnia zu finden.
Der dosale Kiel ist, von der Spina ausgehend, bis etwa zur halben Länge
des gesamten Tieres bestachelt. Am Spinaansatz sind die nach caudal
gerichteten Stacheln etwa 30 µm lang und werden nach cranial kürzer.
Die Skulpturierung des Nackenbereiches besteht aus unregelmäßigen
Polygonen, am Kopf herrschen längliche Skulpturen vor.
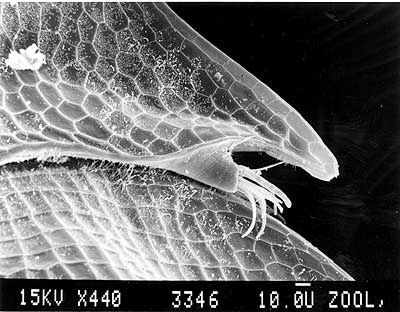 |
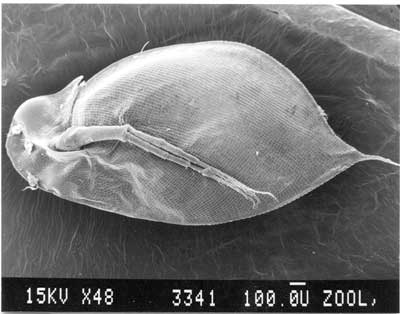 |
Bild 27: Daphnia pulex; Kopf mit Antenne 1. |
Bild 28: Daphnia pulex; Lateralansicht in
toto. |
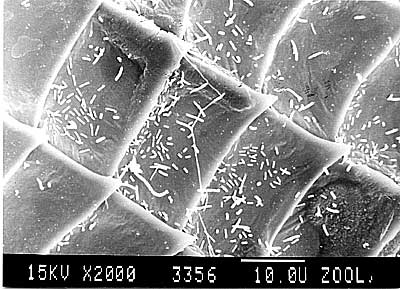 |
Bild 29: Daphnia pulex; Carapaxskulptur. |
Ephippium
Das Ephippium ist im Vergleich zu dem von Daphnia curvirostris meist
länger. Die Dorsalkante ist deutlich konvex gebogen. Die craniale
Kante zieht in einem Winkel von < 90° ist, nach ventral-caudal.
Die caudale Kante schließt mit der dorsalen in der (gattungs-)üblichen
Weise einen Winkel von etwa 45 Grad nach ein. Die bogenförmige
Krümmung bleibt auf das ventrale Drittel beschränkt (Bild
30).
Die Spina ist meist kurz und bestachelt. Die durchschnittliche Länge
des Ephippiums beträgt 1200 µm, die Höhe 800 µm.
Die Lage der beiden Eier ist gattungstypisch, aber meist nicht parallel
zueinander, der Abstand ist ventral deutlich geringer.
Die Skulptur besteht aus trichterförmigen Vertiefungen von bis
zu 5 µm. Die Form der Vertiefungen ist unregelmäßig,
von rundlich bis schlitzförmig langgestreckt, am Grunde unregelmäßig
gerunzelt (Bild 31). Um die einzelnen Vertiefungen finden sich schwache
Leisten, die aber fehlen können und nie regelmäßig wabenartige
Netze aufbauen, wie bei Daphnia curvirostris. Eine hexagonale Anordnung
der Leisten läßt sich dennoch erkennen. Die ungefähre
Größe einer einzelnen Skulptur (also Vertiefung + umgebende
Leisten, falls vorhanden) liegt bei 10 µm.
Regionale Unterschiede bezüglich Größe der Vertiefungen
oder Regelmäßigkeit der Leisten lassen sich nicht feststellen,
lediglich in einem kleinen Bereich um den Ansatz der Spina (Durchmesser
etwa 10 µm) sind die Vertiefungen flacher und die Leisten regelmäßig
netzartig ausgebildet.
Eine durchgehende Musterung ist nicht zu verfolgen.
Der Kiel ist vom übrigen Ephippium abgesetzt und dicht mit bis
zu 10 µm langen Zacken und kleineren Fransen bestückt. Die
Anordnung dieser cuticularen Fortsätze ist unregelmäßig,
meist sind mit der freien Spitze leicht nach caudal gerichtet. Von der
ursprünglichen Doppelreihe von Dornen am Kiel des parthenogenetischen
Weibchens ist nichts mehr zu erkennen.
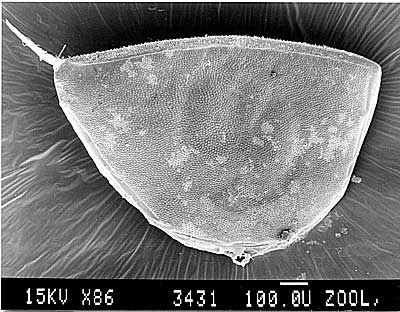 |
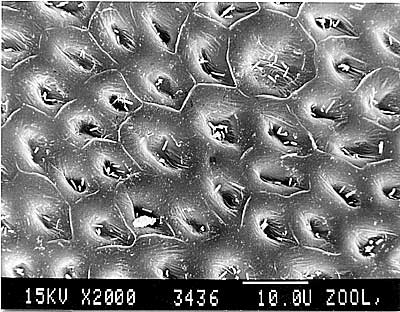 |
Bild 30: Daphnia pulex; Ephippium in toto. |
Bild 31: Daphnia pulex; Ephippialskulptur. |
Fundorte
Die Art dürfte im untersuchten Gebiet seltener vorkommen, als gemeinhin
angenommen. In den Donauauen bei Wien fand ich sie in fischfreien, periodischen
Tümpeln, zumeist in Gesellschaft mit Daphnia curvirostris, wobei
letztere Art in der Regel dominierte. Übergangsformen oder Bastarde
zwischen den beiden Arten konnte ich nicht beobachten.