Gattung:MEGAFENESTRA
MEGAFENESTRA AURITA
Carapax
Die Länge eines durchschnittlichen Tieres beträgt 1000
µm - 1400 µm, die Höhe (dorso-ventral) 700 µm
- 800 µm (Bild 86). Der Carapax dieser Art ist, bis auf wenige
Polygone an der ventral-cranialen Ecke des Körpercarapax und
an der typischen, langen und zugespitzen Rostrumspitze, völlig
unskulpturiert. Aber auch diese spärliche Skulpturierung kann
fehlen. Auch eine Subskulptur ist nicht eindeutig nachzuweisen.
Auffallend ist, daß die Art meist einen starken Bakterienbewuchs
aufweist, am dichtesten an den strömungsgeschützten Stellen
des Carapax. Der Bakterienbewuchs ist wahrscheinlich auf die Lebensweise
unmittelbar unter dem Oberflächenhäutchen zurückzuführen.
Bei vielen Tieren scheint der Kopfpanzer ohne Unterbrechungen oder
Einfaltungen in den Körper überzugehen. Nicht immer ist
die Nackenfalte und ein nach caudal verlängerter Kopfpanzer
zu erkennen. Endgültigen Aufschluß gibt auch hier die
Betrachtung eines Ephippialweibchens. Die spitz zulaufende Verlängerung
des Kopfpanzers weist hier mit dem freien Ende nach dorsal. Beim
parthenogenetischen Weibchen reicht sie zu 2/5 der gesamten Körperlänge
in den Carapax hinein. Die extrem flache Nackenfalte ist, sofern
vorhanden, sehr weit caudal, etwa 150 µm vor dem Ende des
Kopfpanzers.
Die beiden Mucrones am caudo-ventralen Eck sind sehr kurz und plump.
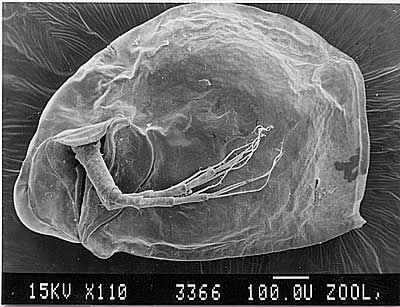 |
Bild 86: Megafenestra aurita; Lateralansicht
in toto. |
Ephippium
Das Ephippium weicht von den bei den anderen, von mir untersuchen,
Arten erheblich ab.
Die Form ist asymmetrisch (Bild 87). Der craniale Winkel Dorsalkante-Korpus
ist > 90 Grad, der caudale < 90°. Es ergibt sich daher eine
nach caudal leicht zugespitzte Spindelform, ähnlich wie bei der
Gattung Simocephalus.
Die ungefähre Länge beträgt 50 µm, die Höhe
35 µm.
Das Ei ist leicht nach cranial verschoben, die Längsachse des
Eies ist nicht exakt parallel zur Dorsalkante, sondern steigt von
cranial-medial nach caudal-dorsal leicht an.
Das Ephippium ist auf der gesamten Oberfläche mehr oder weniger
deutlich skulpturiert. Mit Ausnahme des Eibereichs, des Kielbereichs
und des äußeren Randes besteht die Skulpturierung aus Sechsecken,
die leicht hochgewölbt und durch flache Einsenkungen voneinander
getrennt sind (Bild 88). Die durchschnittliche Größe eines
Sechseckes liegt bei 7-8 µm.
Die Skulptur des Eibereichs ist nur schwach ausgebildet, unregelmäßige
Protuberanzen mit runden, kantigen oder länglichen Querschnitten
(Bild 88). Auch die Größe ist unterschiedlich, ebenso die
Abstände zwischen den einzelnen Protuberanzen.
Über längere Strecken durchgehende Bahnen oder eine Musterung
sind nicht zu erkennen, ebenso fehlt jegliche Art von Subskulpturen.
Auffallend ist eine Art Einsenkung, die durchgehend zwischen dem Bereich
über dem Ei (eigentlich: lateral des Eies) und dem restlichen
Korpus. Sie verläuft als unregelmäßige Zick- Zack-Linie
rund um den Eibereich. Diese Einsenkung dürfte durch die ringförmige,
seitliche Hochwölbung des Ephippiums rund um den Eibereich bedingt
sein. Eine solche, flächige Hochwölbung ist bei dieser Art
einzigartig, bei allen anderen, von mir untersuchten Arten der Daphniiden
ist lediglich der Eibereich hochgewölbt.
Auch in Dorsalansicht bietet sich ein aberrantes Bild. Die wulstartig
vorspringende Leiste zu beiden Seiten der Dorsalkante (wie bei Scapholeberis
mucronata und rammneri) ist bei dieser Art nur am noch unreifen Ephippium
andeutungsweise zu erkennen. Beim fertigen Ephippium geht der seitliche
Korpus ohne weiteren Wulst in die parallelen Stränge der dorsalen
Kante über. Die Stränge sind unauffällig, an beiden
Enden spitz zulaufend.
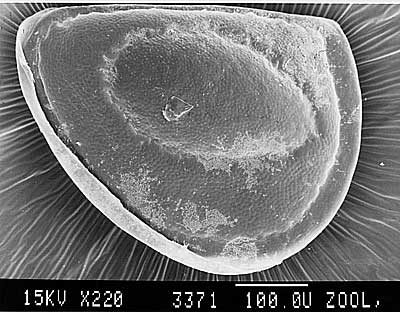 |
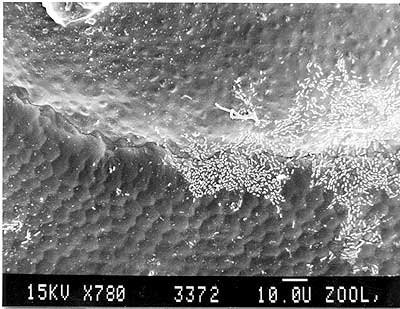 |
Bild 87: Megafenestra aurita; Ephippium
in toto. |
Bild 88: Megafenestra aurita; Ephippialskulptur.
Obere Bildhälfte: Eibereich. Untere Bildhälfte: Randbereich
ventral. |