Gattung: SCAPHOLEBERIS
SCAPHOLEBERIS RAMMNERI
Diese Art dürfte im burgenländischen Seewinkel recht häufig sein. Eine sichere Unterscheidung von Scapholeberis mucronata ist allerdings nur mit dem Rasterelektronenmikroskop möglich. Als typische rammneri- Merkmale (nach Schultz, 1983) seien die Form des Rostrums (Bild 89), die mehr oder weniger deutliche Querstreifung am Hinterende, die Furcakrallenbedornung (Bild 90), die flache Einsenkung hinter dem Kopfpanzer, sowie das permanente Fehlen eines Stirnhornes angeführt.
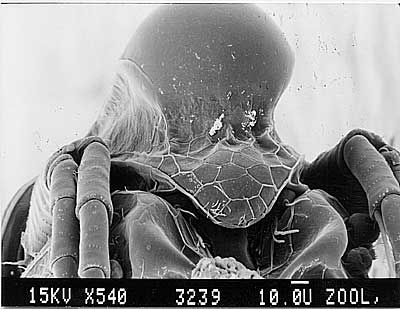 |
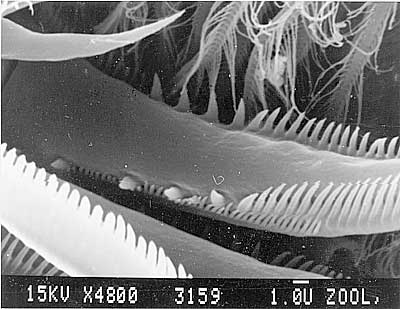 |
Bild 89: Scapholeberis rammneri; Ventralansicht
des Kopfes. |
Bild 90: Scapholeberis rammneri; Bestachelung
der Furcakrallen. |
Carapax
Die Skulpturierung ist bei ausgewachsenen Tieren vor allem im dorsalen
Bereich nur noch sehr schwach zu erkennen (Bild 91). Ventral ist
sie wesentlich derber entwickelt. Sie besteht aus unregelmäßigen
Polygonen, die von relativ dicken Leisten eingerahmt sind. In der
Körpermitte sind die Polygone unregelmäßig angeordnet
und von eher rundlicher Gestalt. Gegen das Hinterende erhalten die
Polygone eine einheitliche Ausrichtung in der dorso-ventralen Richtung.
Ferner fallen hier die Grenzen zwischen den Polygonen parallel zur
Körperlängsachse des Tieres weg, es entstehen dadurch
die typischen Querstreifen am Hinterende dieser Art. Auch am Vorderende
des Carapax, kurz vor dem Kopf, ist eine Ausrichtung der Skulpturen
zu bemerken, hier sind sie in Bögen rund um die Einlenkung
der Antenne 2 angeordnet.
Der Kopfpanzer ist meist nur durch eine sehr flache Einsenkung vom
übrigen Carapax abgesetzt. Er ragt beim hochrückigen parthenogenetischen
Weibchen weniger als ein Fünftel der gesamten Körperlänge
in den Carapax hinein, beim Ephippialweibchen etwa ein Drittel.
Eine Spina ist auch nicht andeutungsweise zu erkennen. Die paarigen
Mucrones sind lang und spitz, wenngleich meist kürzer als bei
Scapholeberis mucronata.
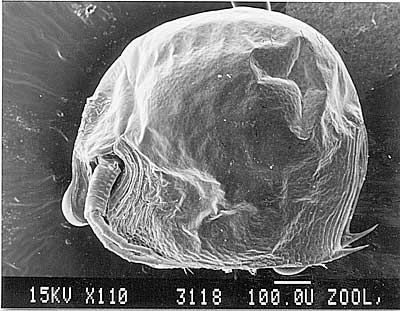 |
Bild 91: Scapholeberis rammneri; Lateralansicht
in toto. |
Ephippium
Das Ephippium ist gattungstypisch (Bild 92). Es ist etwa 240 µm
lange und 160 µm hoch (dorso-ventrale Erstreckung). Der gedachte
Mittelpunkt des Kreissegments, das der Korpus beschreibt, liegt
etwa ein Drittel der gesamten Höhe des Ephippiums unterhalb
(ventral) der geraden Dorsalkante.
Das Ephippium ist fast zur Gänze von einem Häutchen überzogen
und scheint dadurch weitgehend unskulpturiert. Lediglich am ventralen
Rand sind Skulpturen erkennbar. Teils handelt es sich um flache,
eher unregelmäßige Vertiefungen, teils ist eine Tendenz
zu netzartig-sechseckigen Leisten zu erkennen.
Die vorspringenden Wülste sind bei Scapholeberis rammneri gut
ausgebildet (Bild 93). Sie sind etwa 35 µm stark und erstrecken
sich 40 µm rostral des caudalen Endes bzw. 45 µm ventral
der dorsalen Kante nach 40 µm caudal des rostralen Endes bzw.
34 µm ventral der Dorsalkante, verlaufen also in sehr spitzem
Winkel zur dorsalen Kante, von caudal nach cranial gesehen ansteigend.
In Dorsalansicht sind die Wülste bogenförmig gekrümmt,
die cranialen Enden ist dem Dorsalkiel etwas näher, als die
caudalen.
Der Dorsalkiel ist abgerundet, im Querschnitt etwa von der gleichen
Stärke wie die beiden Wülste und unskulpturiert.
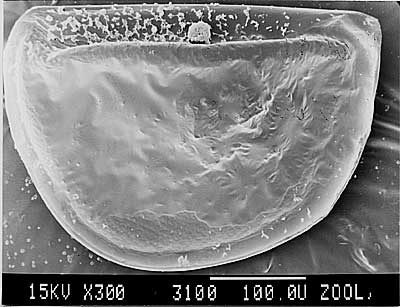 |
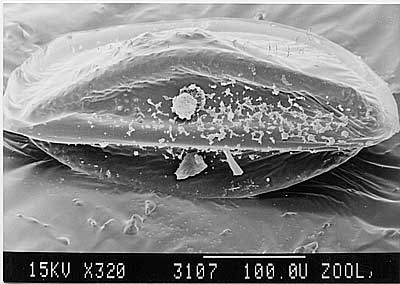 |
Bild 92: Scapholeberis rammneri; Ephippium
in toto. |
Bild 93: Scapholeberis rammneri; Ephippium
in Dorso-Lateral-Ansicht. |
Fundorte
Die Art ist burgenländischen Seewinkel sehr häufig anzutreffen,
sowohl in flachen Sodalacken, als auch in "schwarzen"
Schilftümpeln. In der südlichen Krainerlacke hatte die
Art im Frühjahr ihr Maximum (man kann hier durchaus von einem
Massenvorkommen sprechen), nach der Sexualperiode verschwand sie,
tauchte erst nach den herbstlichen Regenfällen sehr vereinzelt
wieder auf. Geschlechtstiere tauchten im Herbst nicht mehr auf.
In Autümpeln bei Marchegg fand sich die Art in kleineren, periodisch
austrocknenden Gewässern. In Weihern ist sie in der Regel durch
Scapholeberis mucronata verdrängt.