SIMOCEPHALUS
EXSPINOSUS
Carapax
Die Skulpturierung ist bei dieser Art derber als bei der vorigen
(Bild 60). Die einzelnen Schuppen sind meist leicht aufgewölbt,
die sich überlappenden (caudalen) Enden heben sich etwas
von der dahinterliegenden Schuppe ab. Ferner sind die Schuppen
langgezogener, als bei der vorigen Art. Die typische "Querstreifung"
ist dadurch noch deutlicher ausgeprägt.
Der Teil des Kopfpanzers caudal der Querfurche ist skulpturiert
wie bei Simocephalus vetulus. Cranial der Furche finden sich
hier als Skulpturierung konzentrisch angeordnete Ellipsoide,
wobei die freien, überlappenden Enden der Schuppen immer
nach distal weisen (Bild 61). Die Querfalte ist in den meisten
Fällen flacher als bei der vorigen Art, allerdings sind
die Verhältnisse auch innerhalb der Art, je nach Alter
des Tieres unterschiedlich. Der Kopfpanzer ragt auch hier etwa
bis zu einem Drittel der Gesamtkörperlänge in den
Carapax hinein. Der Fortsatz des Kopfpanzers wird beim Ephippialweibchen
nicht nach dorsal gedrückt.
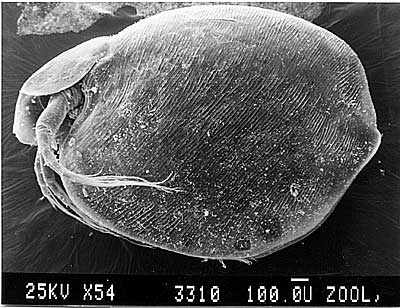 |
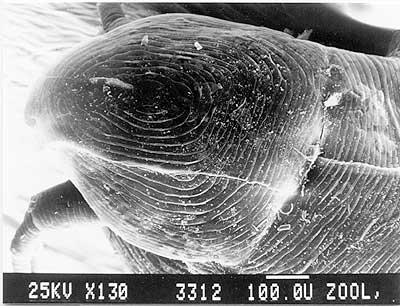 |
Bild 60: Simocephalus exspinosus;
Lateralansicht in toto. |
Bild 61: Simocephalus exspinosus;
Dorsalansicht des Nackenbereiches. |
Ephippium
Das Ephippium dieser Art ähnelt in Form und Skulpturierung
in hohem Maße dem von Simocephalus vetulus (Bild 62).
Größe des Ephippiums, Aussehen und Anordnung der
Protuberanzen variieren auch hier innerhalb der Art. Unterschiede
zur vorigen Art finden sich lediglich im Bereich der Dorsalkante.
Die beiden Schalenhälften sind hier meist stark aufgewölbt,
es entstehen zwei wulstartige Stränge, die in Dorsalansicht
annähernd parallel verlaufen (Bild 63). Von den beiden
Kanten der aneinanderstoßenden Schalenhälften ist,
im Gegensatz zu Simocephalus vetulus bei intakten Ephippien
nichts zu sehen. An den beiden Enden laufen die Stränge
spitz zusammen. Ventral der Stränge nähern sich die
beiden Ephippialhälften einander wieder, um schließlich
in die Hauptwölbung über dem Ei überzugehen.
Die Skulpturierung der beiden Stränge ist bei Simocephalus
exspinosus meist feiner als am übrigen Corpus. Die einzelnen
Skulpturen sind kleiner und stehen enger beisammen. Genauere
Angaben lassen sich aufgrund der schwankenden Verhältnisse
innerhalb der Art nicht machen.
Eine durchgehend einheitliche Ausrichtung der Skulpturen läßt
sich in keinem Bereich feststellen.
Auffällig, daß Ephippialweibchen stets um etwa ein
Drittel kleiner sind als parthenogenetische Weibchen.
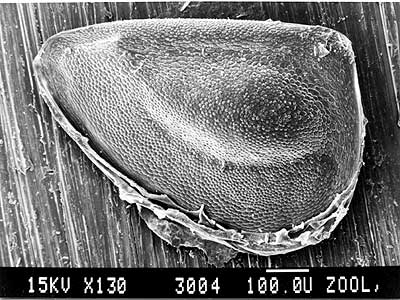 |
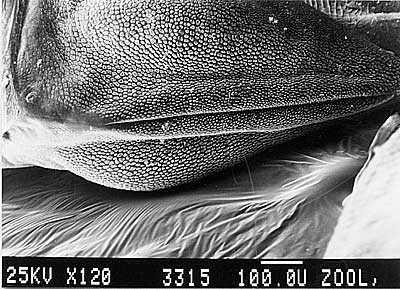 |
Bild 62; Simocephalus exspinosus;
Ephippium in toto. |
Bild 63; Simocephalus exspinosus;
Ephippium in Dorso-lateral-Ansicht. |
Fundorte
Die Art kommt in Ostösterreich sehr häufig vor. Massenvorkommen
gibt es vor allem in periodisch austrocknenden Kleingewässern.
Auch in stark sodahaltigen Lacken im burgenländischen Seewinkel
ist sie regelmäßig zu finden, wobei sie, sofern das
Gewässer nicht vorher austrocknet, im Laufe des Frühsommers
von den großen Daphnia?Arten verdrängt wird. Wenn
es das Gewässer erlaubt, ist die Art dizyklisch (Flössner,
1972).