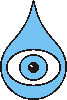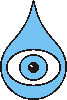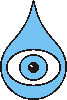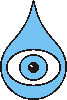Gartenteiche
sind anders
Obwohl man Gartenteiche
auf den ersten Blick mit natürlichen Tümpeln und Weihern
in der Umgebung vergleichen kann - und dies bei der Anlage auch
tun sollte - so unterscheiden sie sich doch in vielerlei Hinsicht
von natürlichen Gewässern. Leider ergeben sich daraus
auch viele Probleme mit den künstlichen Tümpeln und
Weihern im eigenen Garten.
1) Abflusslosigkeit
Da Gartenteiche heutzutage meist mit Folien
abgedichtet werden, sind sie abflusslos und haben nicht einmal
Kontakt zum Grundwasser. Das bedeutet, dass im Großen und
Ganzen nur destilliertes Wasser durch Verdunstung das Gewässer
verlässt. Stets mit Regen und Zulaufwasser eingeschwemmte
Stoffe reichern sich dagegen an, die Suppe wird gleichsam immer
dicker.
Ein Problem ist dabei vor allem der Phosphor.
Er ist eigentlich ein wichtiger Düngestoff, aber zu viel
davon bringt unliebsame Vorgänge, etwa Algenblüten.
Ein einmal in das abgedichtete Gewässern eingebrachtes Phosphormolekül
wird zwar zwischen den verschiedenen Akteuren - Mikroorganismen,
Tieren, Pflanzen - hin und her gereicht, bleibt aber im Kreislauf.
Da etwa über den Regen in vielen Gegenden Österreichs
nicht unerhebliche Mengen an Phosphor in ein Gewässer eingetragen
werden, wird der Gehalt immer höher. Das Gewässer eutrophiert
- so der Fachausdruck -, das heißt der Nährstoffgehalt
und damit die Neigung zu Algenblüten steigt.
Abhilfe können mehrere Maßnahmen schaffen. Am einfachsten
ist regelmäßiges Absaugen von Tiefenwasser
und/oder Schlamm. Eine weitere Möglichkeit ist der Schnitt
von Sumpf- oder Wasserpflanzen, da in den grünen
Pflanzengeweben viel Phosphor gespeichert wird. Natürlich
muss das Schnittmaterial aus dem Teich entfernt werden, da es
sonst verrottet und der Phosphor über die Bakterien wieder
in den Kreislauf geführt wird.
Daneben gibt es noch die Möglichkeit einer chemischen
Fällung von Phosphaten (wie in technischen Kläranlagen).
Für einen Gartenteich ist dies allerdings wenig empfehlenswert,
da damit die Biologie radikal gestört wird.
Nicht ganz so problematisch ist die Sache
übrigens beim landläufig meist mehr gefürchteten
Stickstoff (Nitrat ist ein wichtiges Stickstoffsalz).
Dieser kann etwa über Bakterien zu molekularem Stickstoff
(N2 - wie er auch in der Atmosphäre
vorkommt) verarbeitet werden und so aus dem Gewässer abgasen.
2) Fehlende Anbindung an vergleichbare
Lebensräume
Auch in natürlichen, durch den Menschen
unbelasteten Gewässern passieren Katastrophen. Verendet etwa
ein großes Säugetier in einem Tümpel oder relativ
kleinen Weiher, können nachfolgende bakterielle Abbauprozesse
den ganzen Sauerstoff verbrauchen, die natürliche Wasserfauna
und -flora geht zu Grunde. Sobald der Kadaver aber aufgearbeitet
ist, erholt sich das System. Etwa über Dauerstadien und Zuwanderung
aus der Umgebung stellt sich rasch die ursprüngliche Lebensgemeinschaft
wieder ein.
Anders bei Gartenteichen. Sie werden häufig in Gegenden errichtet,
wo weit und breit keine vergleichbaren Lebensräume vorhanden
sind. Passiert hier ein Massensterben - etwa durch Überdüngung
- geht die Wiederbesiedelung nur zögerlich vonstatten. Letztendlich
können sich einige wenige Arten mangels Konkurrenz massenhaft
vermehren. Und artenarme Lebensräume gelten generell als
anfälliger für weitere Störungen als artenreiche.
Das Problem gilt natürlich auch schon bei der Erstbesiedelung
eines künstlichen Gewässers, daher wäre ein Impfung
mit Wasser und Sediment aus einem vergleichbaren, natürlichen
Gewässer - oder wenigstens aus einem älteren Gartenteich
- zu überlegen. Auch wenn man sich damit vielleicht kurzfristig
Organismen einhandelt, die man nicht haben möchte. Aquarianer
schwören schon lange auf diese Technik, dass man bei der
Neueinrichtung eines Beckens Altwasser aus einem eingefahrenen
Aquarium hinzufügt.
3) Fehlende Dynamik
Etwa ein Autümpel sieht kaum zwei
Jahre gleich aus. Hochwässer und/oder schwankende Wasserstände
bringen Veränderungen mit sich. Und wie auch Ökologen
erst in den vergangenen Jahrzehnten gelernt haben, ist es oft
diese Dynamik, die einen Lebensraum auf lange Sicht Stabilität
gibt. So ist auch ein großflächiger Brand beileibe
nicht das Ende eines Waldes, sondern ein mitunter elementares
Ereignis für seine Verjüngung.
Das soll nun natürlich nicht heißen, dass man alle
zehn Jahre seinen Gartenteich abfackeln muss, um ihn im Gleichgewicht
zu halten. Aber ein bisschen Toleranz für Veränderungen
wäre einem Wassergärtner schon anzuraten. So wie der
Teich angelegt wurde, wird er nie wieder aussehen. Pflanzen werden
verschwinden, andere wuchern.
4) Speziell Schwimmteiche bieten
wenig Lebensraum für Bakterien
Was in gechlorten Pools Chemikalien erledigen,
nämlich Dreck, Bakterien und Algen minimieren, bewerkstelligen
in Schwimmteichen oder Schwimmbiotopen Mikroorganismen - vor allem
abbauende Bakterien und Pilze. Besonders aktiv sind solche Mikroben
in so genannten Biofilmen, nichts anderes als
die schleimigen Überzügen auf Steinen, Kies, Holz- oder
Betoneinfassungen. Biofilme gelten als die wichtigsten Bioreaktoren
in heimischen Gewässern.
Leider bieten gerade viele Schwimmbiotope relativ wenig Platz
für derartige Biofilme. Im Vergleich zu Schotter oder Steinen
weist nämlich die Folie im Schwimmbereich solcher Teiche
eine wesentlich geringere Oberfläche auf. Noch dazu wird
die Folie von vielen Teichbesitzern in guter Absicht regelmäßig
abgeschrubbt. Was zu mehr Sauberkeit beitragen soll, bewirkt das
Gegenteil, weil äußerst nützlich Mikroben zerstört
werden.
5) In unmittelbarer Umgebung
des Menschen hat es die Natur schwer
Ein letztes, wenngleich nicht unwichtiges
Argument, warum Garten- und Schwimmteiche relativ anfällig
für Störungen sind, ist die einfache Tatsache, dass
sie in der Nähe von Menschen, seinen Behausungen und sonstigen
Machenschaften angesiedelt sind. Regen und Grundwasser sind in
der Nähe von Landwirtschaft oder Siedlungen meist stärker
mit Nährstoffen aufgeladen, als in abgelegenen Gegenden.
Dem entsprechend heftiger ist die Aufdüngung des Gewässers.