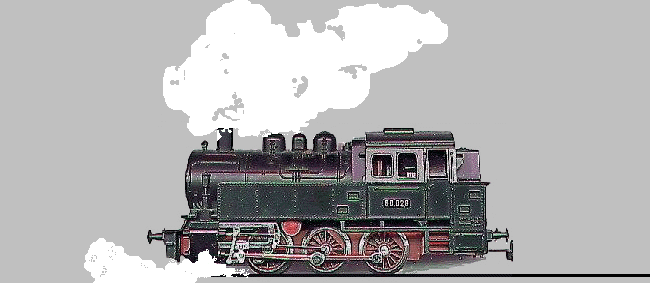
| HO
ist die Lösung für den Semmering- Basistunnel ! (Maßstab 1:87) In dieser Ausführung genügt ein kleines Loch mit den Maßen 70 mal 70 mm. Das darf dann auch nicht viel kosten. |
|
| zurück zur Seite über Gebrauchsanleitungen | |
| Gebrauchsanleitung zur Inbetriebnahme
einer Dampflokomotive Auszüge aus dem Buch "Bahnbetriebswerke in Deutschland" von Klaus D. Holzborn, 1993, Motorbuch Verlag Bevor eine kalte oder ausgewaschene Dampflokomotive wieder in Betrieb genommen werden kann, hat das Lok- bzw. Schuppen- Personal hier besondere Tätigkeiten vorzunehmen von denen nachfolgend die wichtigsten aufgeführt sind: |
|
| Reinigung der Feuerungsbereiche | |
| Das Anlegen des Feuers | |
| Anheizzeiten | |
| Überprüfen von Lokomotive und Tender | |
| Überprüfung der Speiseeinrichtungen | |
| Prüfen der Wasserstandsanzeiger | |
| Überprüfen der Bremseinrichtungen | |
| Abölen | |
| Feuerbehandlung | |
| Vorwärmen der Zylinder | |
| Inbetriebnahme des Turbo-Generators | |
| Ergänzen der Betriebsstoffe | |
| Fahrt an den Zug | |
| Reinigung der Feuerungsbereiche Bevor das Feuer in der
Feuerbüchse angelegt wird, muß allenfalls die Wasserstandsanzeige dahingehend
überprüft werden, ob eine ausreichende Menge Wasser im Kessel vorhanden ist (ggfs. durch
Betätigen der Prüfhähne). Selbstverständlich sollen Aschkasten, Rost, Feuerbüchswände, Feuerschirm, alle Heiz-, Rauch- und Überhitzerrohre, die Rauchkammer und der Funkenfänger sich in einwandfreiem, gereinigten und betriebssicheren Zustand befinden. Insbesondere ist darauf zu achten, daß auch die schlechter zugänglichen Rohrreiben durch gutes und ständiges Ausblasen offen gehalten werden, Blasrohrkopf und Funkenfänger fest sitzen und die Rauchkammer- Entwässerungsöffnung verschlossen ist. Beim Aschkasten sollen vor allem die Stellen gut gereinigt sein, die wegen der Lokomotivachsen eingebuchtet sind und somit wenig Raum unter dem Rost lassen. Wurde dies vergessen, wird der darüber befindliche Teil des Rostes nicht ausreichend gekühlt und verschmort. Die Aschkastenbodenklappen müssen geschlossen und verriegelt und die Rauchkammertür dicht geschlossen sein. Wird eine Dampflokomotive nach dem Auswaschen erstmalig angeheizt, so sind zusätzlich die Waschluken zu überprüfen und erforderlichenfalls durch Nachziehen der Schrauben zu dichten. |
|
| Das Anlegen des Feuers Das Anheizen des
Lokomotivkessels geschieht meist durch die Schuppenfeuerleute oder den Schuppenheizer.
Angeheizt wird mit zerkleinerten Altholz, Reisig, Torf oder durchgebrannter Kohle aus
einem besonderen Anheizofen. Große BW besitzen besondere Anheizvorrichtungen, die mit
einem Gebläse arbeiteten. Bedingt durch die geringere Wärmeleitung von Stahl im Verhältnis zu Kupfer reagieren Stahlfeuerbüchsen bei Temperaturschwankungen deutlich empfindlicher als solche aus Kupfer. Daher ist auch beim Anheizen von Stahlfeuerbüchsen die Rostfläche gleichmäßig mit Brennstoff zu bedecken, um eine gleichmäßige Erwärmung aller Teile der Feuerbüchse zu erreichen. Ein schnelles Anheizen unter Einbeziehung eines Hilfsbläsers ist daher bei stählernen Feuerbüchsen möglichst zu vermeiden. |
|
| Anheizzeiten Die Anheizzeit kann
beträchtlich durch eine niedrige Schichthöhe reduziert werden, dadurch breitet sich das
Feuer rascher aus. Dennoch werden als Anheizzeit bis zum
Erreichen eines Kesseldrucks von etwa 0,3-0,4
MPa *), wenn der Kessel mit heißem Wasser gefüllt wurde, meist 3-1/2bis 4 Stunden
benötigt. Bei mit kaltem Wasser gefülltem Kessel dauert es ca. 5 Stunden. |
|
| Überprüfen von Lokomotive und Tender Bei Dienstantritt muß
sich der Lokführer anhand des Übergabe - Buches davon überzeugen, daß die
Betriebsbereitschaft der Lokomotive und des Tenders bestätigt wurde und er muß anhand
der Ausbesserungszettel überprüfen, ob die darauf verzeichneten Reparaturen richtig
erledigt wurden. Alsdann wird der Wasserstand und Dampfdruck ebenso nachgesehen wie der
Zustand des Feuers in der Feuerbüchse kontrolliert wird. - die Zylinderventile geöffnet sind, - die Handbremse wirksam angelegt ist, - die Rauchkammer ordnungsgemäß dicht verschlossen ist, - die Wasserstand- und Speisevorrichtungen in einwandfreiem Zustand und durch den Heizer ordnungsgemäß geprüft sind, - an den, Prüfschrauben der Ölsperren Öl austritt, während der Heizer die Schmierpumpen durchkurbelt und - gezogene Schmierdochte durch den Heizer eingesetzt sind, - die Entwässerungshähne des Hauptluftbehälters, der Pumpen und andere offene Entwässerungen geschlossen, etwa noch geschlossene Kessel- und Tenderventile geöffnet sind, - die Schraubkupplungen aufgehängt und die Bremsschläuche eingehängt sind. |
|
| Überprüfung der Speiseeinrichtungen Jede Wasserstandsanzeigevorrichtung und jede Speise- Vorrichtung muß für sich besonders geprüft werden. Beim Prüfen der Speiseeinrichtung mit Wasser aus dem Oberflächenvorwärmer ist zuerst die Dampfstrahlpumpe kurzzeitig anzustellen. Erst später darf die Kolbenspeisepumpe angestellt werden, nach dem die Luftpumpe einige Zeit gelaufen ist, da sonst kaltes Wasser in den Kessel gespeist wird. (Der Pumpenabdampf wird zum Vorheizen des Kesselspeisewassers im Oberflächenvorwärmer benutzt.) Vor dem Anstellen der Speisepumpe muß festgestellt werden, ob das von Hand zu betätigende Kesselspeiseventil ganz geöffnet ist. Bei Kolbenpumpen würde sich sonst ein übermäßig hoher Druck im Wasserzylinder und im Vorwärmer aufbauen. Besonders Kolbenspeisepumpen müssen vorsichtig angestellt werden, bei den verschiedenen Pumpenarten sind besondere Vorgehensweisen zu beachten. Die zum Betrieb der Lokomotive notwendige Luft wird dem Hauptluftbehälter der Druckluftbremse entnommen. Sie strömt über einen Absperrhahn und das Belüftungsventil in den Stoßdämpfer. Unmittelbar davor sitzt ein doppeltes Rückschlagventil, damit keine Luft aus dem Stoßdämpfer entweichen kann. Das Belüftungsventil schließt selbsttätig, d. h. es gibt den Durchgang der Luft nur frei, wenn es betätigt wird. Nach dem Belüften ist selbstverständlich auch der Absperrhahn zum Hauptluftbehälter wieder zu schließen. Wird festgestellt, daß eine der beiden Speiseeinrichtungen oder die Luftpumpe nicht einwandfrei funktionieren, so darf die Lokomotive nicht in Betrieb genommen werden. Gelangt Feuchtigkeit in die Sandrohre, so kann es zu einer Verstopfung kommen. Daher muß der Sandstreuer vor jeder Fahrt betätigt werden, dabei muß aus allen Besandungsrohren ausreichend Sand auf die Schienen fallen. Werden Strecken mit unbewachten Bahnübergängen befahren, so muß die Lokomotive mit einem Läutewerk ausgerüstet sein oder es muß eine tragbare Läutevorrichtung mitgeführt werden. Beide sind vor Fahrt- Beginn zu überprüfen. |
|
| Prüfen der Wasserstandsanzeiger Als besonders wichtig betrachtete man bei der DB nach dem tragischen Unfall der Lokmannschaft einer 42er durch Kesselzerknall aufgrund von Wassermangel die Kontrolle beider Wasserstandsanzeiger; diese müssen auf einwandfreies Arbeiten hin überprüft werden. Dazu werden sämtliche Hähne geöffnet und dann geschlossen, sowohl die Prüfhähne der zweiten Wasserstandsvorrichtung wie auch die Hähne des Wasserstandsanzeiger. Zum sicheren Erkennen des sichtbaren Wasserstandes ist die Sauberkeit der hinter dem Glas befindlichen schwarz-weiß gestrichelten Fläche und eine richtige ausreichende Beleuchtung wichtig, wobei es weniger auf die absolute Helligkeit sondern mehr auf den richtigen Lichteinfallswinkel ankommt (wegen der besseren Reflexion). Besteht die zweite Wasserstandsanzeigevorrichtung aus Prüfhähnen, so sind diese nacheinander in der Reihenfolge von unten nach oben vorsichtig zu öffnen und wieder zu schließen, um sicherzustellen, daß sie gut beweglich und nicht verstopft sind. Am unteren Prüfhahn muß stets Wasser, am oberen stets Dampf austreten. Dem mittleren soll ein Dampf- Wasser- Gemisch austreten. Bei jedem Dienstbeginn und bei jedem Dienstende sind die Wasserstandsanzeigevorrichtungen vom Heizer unter Aufsicht des Lokomotivführers durchzuprüfen. |
|
| Überprüfen der Bremseinrichtungen Ebenso ist dem Funktionieren der Bremseinrichtungen eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. So sind die verschiedenen Bremseinrichtungen, wie Handbremse, selbsttätige Druckluftbremse, Zusatzbremse (und evtl. auch Saugluft- und Dampfbremse) einzeln auf ihr betriebssicheres Wirken hin zu prüfen. Die Handbremse muß so eingestellt sein, daß die Bremsklötze fest anliegen, ohne daß der Wurfhebel seine unterste Lage bereits erreicht hat, er muß aber dennoch sicher diese unterste Lage einnehmen können. Bevor die anderen Bremsen geprüft werden, muß die Handbremse wieder gelöst werden. Bei der selbsttätigen Luftdruckbremse ist darauf zu achten, daß sie sich von alleine abstellt, sobald der Druck im Hauptluftbehälter 0,8 MPa *) erreicht hat. Der Lokführer muß dann die Schnellbremseinrichtung ebenso überprüfen wie die Stellung der Umstellhähne, wobei nach Art der Bremseinrichtung und der zu bespannenden Züge andere Einstellungen erforderlich werden. |
|
| Abölen Wurde beim Ende der Dienstschicht die Lok nicht abgeölt, so ist dies im Rahmen des Vorbereitungsdienstes zu erledigen. Der Lokführer muß sich nach dem Abölen davon überzeugen, ob an den Prüfschrauben der Ölsperren Öl austritt. |
|
| Feuerbehandlung Je nach Art der Feuerbüchse wird das Ruhefeuer bei Stahlfeuerbüchsen auf ca. 0,8-1,0 MPa *) gehalten, bei Kupferfeuerbüchsen auf dem halben Wert. Um die Lokomotive in einen betriebsfähigen Zustand zu versetzen, muß nun hochgeheizt werden. Das muß langsam und sorgfältig geschehen, um Thermospannungen an den feuerberührten Teilen sicher zu vermeiden. Es muß ein Grundfeuer angelegt werden, das muldenförmig aufgebaut ist. Vor der Rohrwand muß es niedrig gehalten werden und hell brennen, an den Seitenwänden und in den hinteren Ecken wird es dagegen etwas höher gehalten. Hat der Kesseldruck 0,8 MPa erreicht, wird der Bläser abgestellt, so daß nun das Feuer mit dem natürlich vorhandenen Zug weiterbrennen kann, damit exakt zur Abfahrtszeit des Zuges der volle Kesseldruck bei gut durchgebranntem Feuer erreicht sein wird. |
|
| Vorwärmen der Zylinder Vor dem ersten Anfahren, bei kälterer Jahreszeit auch nach längerem Halten, sind die Dampfzylinder vorzuwärmen. Wird nämlich mit kalten Zylindern angefahren, so können Zylinder- und Triebwerksschäden durch Wasserschlag entstehen, da sich der eintretende Dampf an den kalten Zylinderwänden niederschlägt und zwar um so schneller, je kälter die Zylinderwände sind. Um ein unbeabsichtigtes Anfahren zu verhindern, müssen die Zylinderventile und der Druckausgleichsschieber geöffnet und die Bremsen angezogen sein. |
|
| Inbetriebnahme des Turbo-Generators Für die elektrische Beleuchtung der Lokomotive (und in Sonderfällen auch der Wagen) besitzen moderne Dampflokomotiven einen Turbo-Generator, der durch einen Fliehkraftregler gesteuert wird und bei Dampfdrücken zwischen 0,5 und 2,0 MPa seine Drehzahl konstant hält. Auch hier muß sich eventuell abgesetztes Kondenswasser aus der Frischdampfzuleitung entfernt werden, bevor die Turbine vorsichtig angelassen wird. |
|
| Ergänzen der Betriebsstoffe Beim Ergänzen der Brennstoffvorräte sind die am Tender angeschriebenen Gewichtsmengen zu beachten und nicht zu überschreiten. Die Kohlen auf dem Tender sind bei Bedarf zu nässen, einmal, um die Belästigung des Lokpersonals bei Rückwärtsfahrt oder durch Luftzug zu reduzieren und um andererseits eine gute Verbrennung des Staubes zu erzielen. |
|
| Fahrt an den Zug Bevor die Fahrt aus dem Schuppen zur Drehscheibe (oder Schiebebühne etc.) angetreten wird, muß sich der Lokführer davon überzeugen, daß die Hallentore weit geöffnet und richtig eingeklinkt sind, daß der Rauchfang hochgezogen ist und die Drehscheibe richtig steht. Erst nach dem Signal des Drehscheibenwärters darf diese befahren werden. Dort wo keine besondere »Lokübergabestelle« vorhanden ist, wird die Lok mit dem Verlassen der Drehscheibe dem Bahnhof übergeben. Der Drehscheibenwärter bietet fernmündlich dem Bahnhof bzw. dem zuständigen Stellwerk die Lok an und trägt gleichzeitig Lok-Nr., Zug-Nr. und Uhrzeit (und bei fremden Lok das Heimat-BW) in das »Ein und Ausgangsbuch für Triebfahrzeuge« ein. Ist dagegen eine Lokübergabestelle vorhanden, so findet die Übergabe an den Bahnhof erst an dieser Stelle statt. Für den Lokführer ist das rechtzeitige Erreichen dieser Stelle besonders wichtig; denn hier erst endet der technische und beginnt der betriebliche Vorbereitungsdienst. Von hier aus fährt die Lok mit mäßiger Geschwindigkeit auf den durch die Lokomotivfahrordnung besonders vorgeschriebenen Gleisen zum Zug. In größeren Bahnhöfen kann ein Rangierer mitfahren. |
|