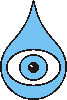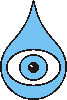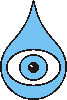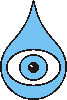Beurteilungskriterien
für Garten- und Schwimmteiche
Da Garten- und Schwimmteiche von
der Wissenschaft (etwa Limnologie – Ökologie der Binnengewässer)
sehr stiefmütterlich behandelt wurden, liegen auch kaum Beurteilungskriterien
vor. Etwa wie viel des wichtigen Nährstoffs Phosphor ein
großer See, ein Schotterteich oder ein Stausee verträgt,
ist bestens bekannt, bei Gartenteichen sieht die Sache schon wieder
anders aus.
Auch wenn bei einem abflusslosen, von Brunnen- oder Leitungswasser
gespeisten, flachen Gartenteich alles ähnlich abläuft,
ergeben sich doch deutlich Unterschiede >>
siehe "Gartenteich sind anders <<. Die gängigen
Kriterien – etwa Normen für Badegewässer - sind
daher auch nur bedingt anwendbar. Noch weniger zu gebrauchen sind
Trinkwassergrenzen, so erlaubt diese Norm etwa für Phosphor
oder Nitrat Werte, die für ein stehendes Gewässer ein
Katastrophe bedeuten würde.
Hier soll deshalb auf Basis der Erfahrungen des Biologischen Labors
Wien-Ost versucht werden, eine Einteilung von Garten- und Schwimmteichen
nach ihrem Nährstoffgehalt – oder anders ausgedrückt
nach ihrer Düngung – vorzunehmen. Die Beschreibungen
beziehen sich auf den durchschnittlichen Zustand während
der wärmeren Jahreszeit und gelten für mäßig
bis stark kalkhältige Wässer. Nicht ins Schema passen
extreme Lebensräume, etwa Moorwasser.
1) "STARK ÜBERDÜNGT"
Beschreibung:
Das Gewässer ist während der warmen Jahreszeit grünlich
oder bräunlich trübe, die Sichttiefe ist unter 70 cm.
An den tiefsten Stellen bildet sich eine merkbar zunehmende Schlammschicht,
die unterhalb einiger Zentimeter schwarz verfärbt ist und
stinkt (sog. Faulschlamm). Besonders an nach heißen, windstillen
Wetterphasen, entwickelt sich übler Geruch im Bereich des
Gewässers. Stellenweise können sich an der Schlammoberfläche
Bakterienrasen als weiße oder leuchtend orange-rote Flecken
entwickeln.
Biologie: Im freien Wasser
dominieren Schwebealgen, die mit freiem Auge nicht sichtbar sind,
aber das Wasser deutlich trüben. Im Schlamm sind häufig
auch rote Zuckmücken und Borstenwürmer (etwa Tubifex)
zu finden. Grüne Fadenalgen in Form von Watten am Gewässergrund
oder an der Oberfläche finden sich kaum, es kann aber zur
Entwicklung von Blaualgen (blau-grüne Farbe) kommen. Positiv:
Pflanzen im Flachwasser gedeihen üppig.
Chemie/Physik: Totalphosphor
jedenfalls über 60 µg/l (P), je mehr, desto deutlicher
sind die oben beschriebenen Symptome. pH-Wert und Sauerstoff schwanken
im Tagesverlauf stark, pH kann nach einem sonnigen Tag über
9 ansteigen. Tagsüber herrscht im Freiwasser Sauerstoffübersättigung,
nachts bzw. gegen Morgen Sauerstoffarmut. Sind Fische im Gewässer,
kann es zu Fischsterben kommen, meist ist dann eine Ammoniak-Vergiftung
die Ursache. Das bei niedrigem pH ungiftige Ammonium geht bei
steigenden Werten in giftigen Ammoniak über.
2) "MÄSSIG GEDÜNGT"
Beschreibung: Wasser trübt
sich nur während längerer Schönwetter oder Hitzeperioden
sichtbar, sonst ist es weitgehend klar mit Sichttiefen bis zu
zwei Metern. Das Umschlagen von Klarwasser und Trübung kann
sehr schnell, innerhalb von ein, zwei Tagen vor sich gehen. Schlammbildung
nur mäßig, nach Absaugen ist Wochen- bis Monate lang
Ruhe. Faulschlamm entsteht nur unterhalb einer mehrere Zentimeter
dicken Schicht.
Biologie: Während
wechselnder Wetterverhältnisse dominieren Fadenalgen aus
der Gruppe der Grünalgen, die einen festen Untergrund zum
Anwachsen brauchen. Rote Zuckmücken oder Tubifex sind bestenfalls
vereinzelt zu finden. Wasser- und Sumpfpflanzen im Flachwasserbereich
wuchern nicht gerade, wachsen aber gut.
Chemie/Physik:
Totalphosphor zwischen 30 und 60µg/l. pH steigt selten über
9, Schwankung (je nach Härte) im Tagesgang meist zwischen
8 und 9. Ammoniak wird nur bei extremen Ammonium-Werten (starker
Fischbesatz) zum Problem. Sauerstoffprobleme bestenfalls im Winter
unter Eis.
3) "NÄHRSTOFFARM"
Beschreibung: Wasser ganzjährig
klar. Während langer Sonnenperioden (Hitze ist nicht nötig)
und wenn das Gewässer praktisch schattenlos ist, bilden sich
bisweilen dichte Watten von fädigen Jochalgen. Am Gewässergrund
anwachsend, treiben die Watten dann als unschöne, blasige,
hellgrün-braune Fladen an die Oberfläche. Die Schlammbildung
ist sehr gering, Faulschlamm tritt praktisch nicht auf. Das Gewässer
riecht stets neutral.
Biologie: Es
domonieren meist Jochalgen der Gruppen Mougeotia, Spirogyra und/oder
Zygnema. Diese brauchen durchwegs sehr viel Licht, wenigstens
einige Stunden pralle Sonne pro Tag. Dafür benötigen
sie nur sehr wenig Nährstoffe in Form von Phosphor- oder
Stickstoffsalzen. Am Gewässergrund finden sich keine roten
Formen, es dominieren oft farblose Zuckmückenlarven –
sie ähneln winzigen Schmetterlingsraupen – die in Gespinsten
leben. Wasser- und Sumpfpflanzen in Flachwasser bleiben kümmerlich.
Chemie/Physik:
Totalphosphor unter 20-30 µg/l, teilweise sogar unter 10
µg/l. pH-Werte können im Tagesgang bei Massenentwicklungen
von Jochalgen doch erheblich schwanken (7 bis 8,5). Sauerstoff
ist stets genügend vorhanden, auch höhere Ammonium-Werte
kein Problem.
4) MISCHFORMEN
Da Pflanzen und Tiere nicht nur Symptom einer herrschenden
Wasserqualität sind, sondern diese auch entscheidend beeinflussen,
können sich Scheineinstufungen oder Mischformen ergeben.
Kommt es etwa im Frühjahr in einem "mäßig
gedüngten" Gewässer durch bestimme Wetterverhältnisse
(viel Sonne aber relativ kühl) zur Massenentwicklung von
fädigen Jochalgen, so binden die Watten eine Menge Nährstoffe,
dass Wasser selbst wird "nährstoffarm" und bleibt
beständig klar. Durch diese Klarheit gelangt aber in Folge
ständig sehr viel Licht zu den bodenlebenden Jochalgen, sie
gedeihen weiter prächtig. Da das Gewässer aber im Ganzen
relativ viel Düngesalze enthält, können sich die
Watten besonders üppig ausbreiten und als auftreibende Klumpen
bald die ganze Wasseroberfläche bedecken. Auch in diesem
Fall werden Sumpfpflanzen eher hungern und kaum gedeihen. Eine
besonders lästige Entwicklung für den Wassergärnter.
Übergänge von "stark überdüngt"
zu anderen Stadien sind durch die rasch einsetzende Schwebealtenentwicklung
im Frühling meist nicht möglich.