Breidenstein Georg, Kelle Helga: Geschlechteralltag
in der Schulklasse – Etnographische Studien zur Gleichaltrigenkultur.
287 Seiten, Juventa Verlag, Weinheim/ München 1998 EUR
23,70
 Beforscht
wurde die peer culture von 9-12jährigen Mädchen
und Buben zweier Klassen der Laborschule in Bielefeld.
Beforscht
wurde die peer culture von 9-12jährigen Mädchen
und Buben zweier Klassen der Laborschule in Bielefeld.
Ziel war es, anstatt die Bedeutsamkeit der Geschlechtsunterschiede
vorauszusetzen, sie als empirische Frage zu behandeln. Es sollten Situationen
erfaßt werden, in der die Geschlechterunterscheidung
Bedeutung hat.
Besonderes Augenmerk wird auf die
Ordnung der Schulklasse (durch Gruppenbildung bei Spielen, Verteilungen
auf Tische oder Zimmer, bei der Frage der Beliebtheit und bei Freundschaftsinszinierungen)
und Szenerien der Geschlechterunterscheidung (beim Thema Sexualität,
Verliebtheit, Paarbildung, Ärgern, Lästern, Verkleiden,...)
gerichtet.
Die Mädchen und Buben kommen
z.T. selbst zu Wort, breiten Raum nehmen die Beobachtungen von Autorin
und Autor der Studie sowie deren Interpretationen des Geschehens ein,
wobei sich die Forschenden der Schwierigkeit bewußt sind, eine
Balance zwischen dem Eintauchen in die Alltagswirklichkeit der Kinder
und der Notwendigkeit einer analytischen Distanzierung zu finden.
Das Buch ist vor allem jenen zu
empfehlen, die Situationen, in denen Geschlechterunterscheidungen deutlich
zu Tage treten, bewußter wahrnehmen wollen. Wer sich durch das
Lesen des Buches erhofft, Anregungen zu bekommen, wie im Schulalltag
auf geschlechtstypisches Verhalten von Mädchen und Burschen eingegangen
werden könnte, kommt nicht auf ihre Rechnung.
(Renate Tanzberger)
Faulstich-Wieland, Hannelore / Weber, Martina / Willems, Katharina; unter Mitarbeit von Budde Jürgen: Doing Gender im heutigen Schulalltag. Empirische Studien zur sozialen Konstruktion von Geschlecht in schulischen Interaktionen.
252 Seiten, Juventa Verlag, Weinheim und München 2004, EURO 20,10
1998 begann eine vier Jahre dauernde Länstschnittstudie mit der Fragestellung "wie Lehrkräfte und Jugendliche in der Adoleszenz in unterschiedlich zssammengesetzten Schulklassen durch Interaktionen in verschiedenen Schulfächern Geschlecht als soziale Kategorie konstruieren und welche Interaktionen zur 'Neutralisation' beitragen." Dazu wurden drei Gymnasialklassen in Deutschland beobachtet: eine mit mehr Mädchen, eine mit mehr Burschen und eine mit gleich viel Mädchen wie Burschen. Die Studie war sehr umfangreich. Sowohl die Methoden (Fragebögen, Unterrichtsprotokolle, Tonband- und Videoaufnahmen, Interviews, Erstellen von Interaktionsnetzen,...) als auch die Fragestellungen betreffend. Schließlich ging es um das doing gender (also die Frage, wie Geschlecht hergestellt wird) der SchülerInnen, aber auch um das undoing gender und die Frage, welche Bedeutung doing student und doing adult in diesem Zusammenhang haben.
Insgesamt eine sehr spannende Lektüre (bei der es - um nur ein paar Highlights zu nennen - um die Bedeutung von Räumen, von Kleidung und Haarpraktiken, um Selbstwert, Aggressionen etc. geht). Die Protokollniederschriften und die anschließenden Interpretationen waren stellenweise etwas mühsam zu lesen und manchmal hatte ich den Eindruck, dass die AutorInnen ein undoing gender wahrnahmen, wo ich ein deutliches doing gender herauslas. Insgesamt aber auf jeden Fall eine Lektüre, die zum Diskutieren und durchaus auch zum kritischen Hinterfragen anregt.
(Renate Tanzberger)
Heiliger Anita: Mädchenarbeit im Gendermainstream.
158 Seiten, Verlag Frauenoffensive,München 2002 EUR 14,90
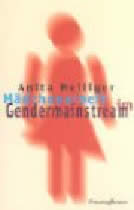 Dieses
Buch von Anita Heiliger, einer Expertin im Bereich der Gewaltprävention,
die am Deutschen Jugendinstitut in München arbeitet und u.a. maßgeblich
an der Münchner Kampagne gegen Männergewalt an Frauen und
Mädchen/Jungen beteiligt war, bietet einen gut leserlichen Überblick
über mädchenspezifische Ansätze in der Jugendarbeit in
Deutschland.
Dieses
Buch von Anita Heiliger, einer Expertin im Bereich der Gewaltprävention,
die am Deutschen Jugendinstitut in München arbeitet und u.a. maßgeblich
an der Münchner Kampagne gegen Männergewalt an Frauen und
Mädchen/Jungen beteiligt war, bietet einen gut leserlichen Überblick
über mädchenspezifische Ansätze in der Jugendarbeit in
Deutschland.
Sie bezieht kritisch Stellungnahme zur scheinbaren
Gleichberechtigung von Mädchen und Burschen. „Eine vorherrschende
'Gleichheitsrhetorik' produziere ’Gleichheitsmythen’
und verhindere, dass die real bestehenden Ungleichheiten thematisiert
und bearbeitet werden.“ zitiert sie Öchsle/Geissler.
Sie zeigt auf, wo das Konzept des Gendermain-streamings
genutzt werden kann, aber auch, welche Gefahren es birgt (z.B. das finanzielle
Aushungern von mädchenspezifischen Angeboten mit dem Hinweis, dass
diese durch das GM obsolet seien).
Sie reagiert sensibel darauf, Mädchen vermehrt zu Täterinnen
und Buben zu opfern zu stilisieren. Und sie zeigt auf, in welchen Bereichen
Mädchenarbeit nach wie vor notwendig ist und welche Mädchengruppen
speziell angesprochen werden sollten (Mädchen mit Behinderungen,
Migrantinnen, lesbische Mädchen).
Heiliger ist eine, die Stellung bezieht und damit
sicher auch polarisiert. Beim Lesen tat mir diese Klarheit gut („ja,
genau so ist es“), zeitweise tat sie aber auch weh („so
schlimm darf es doch nicht sein, was Mädchen immer noch an Gewalt
erleben müssen!“).
(Renate Tanzberger)
Kessels Ursula: Undoing Gender in der Schule.
Eine empirische Studie über Koedukation und Geschlechtsidentität
im Physikunterricht.
256 Seiten, Juventa Verlag, Weinheim/ München 2002 EUR 23,70
Zu Beginn steht eine Zusammenfassung über
Geschlechtsunterschiede in Bezug auf die mathematisch-naturwissenschaftlichen
Fächer.
Weiter geht es mit einem sozialpsychologischen Kapitel, in dem ein Identitätsmodell
vorgestellt wird, das das Selbst als multiple und flexible Struktur
auffasst.
Nachdem die Kategorie „Geschlecht“ von
verschiedenen Seiten beleuchtet wird, werden Forschungsergebnisse zitiert,
die belegen, dass es für das Interesse eines Mädchen an den
Naturwissenschaften ungünstig ist, wenn sie sich als Mädchen
und den naturwissenschaftlichen Bereich als maskulin wahrnimmt –
es sei denn sie hat ein hohes „maskulines Selbstwissen“.
[In dem Buch erfährt frau auch, wie dieses gemessen wird!]
Der zweite Teil geht der Frage nach, wie sich ein
monoedukativer Anfangsunterricht in Physik auf die Leistung
und das Interesse auswirkt – bei Mädchen und bei Buben.
Die These dahinter: für Mädchen wirkt er
sich positiv aus, weil es durch den geschlechthomogenen Unterricht zu
einer „geschlechtlichen Entspannung“ kommt. Trotz der –
oder genauer gerade durch die – Trennung aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit
(also einem institutionellen genderism) kommt es anschließend
zu einem „undoing gender“, da das Geschlecht in homogenen
Gruppen weniger im Vordergrund steht als in geschlechtsheterogenen Gruppen.
Im dritten Teil wird der Frage nachgegegangen, ob
sich Jugendliche in koedukativem Gruppen stärker geschlechstypisiert
beschreiben und ihnen geschlechtsbezogenes Wissen zugänglicher
ist als in geschlechtshomogenen Gruppen.
Insgesamt ein spannendes Buch, das zu Diskussionen
anregt!
(Renate Tanzberger)
Koch-Priewe Barbara (Hgin): Schulprogramme zur Mädchen- und Jungenförderung.
Die geschlechterbewusste Schule.
203 Seiten, Beltz Verlag, Weinheim/ Basel 2002 EUR 20,50
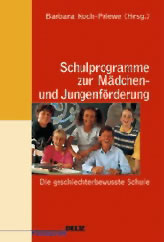 In
Österreich werden allerorts Schulprogramme und –profile erarbeitet
als zielorientierte Handlungskonzepte für die Verwirklichung einer
„guten Schule“.
In
Österreich werden allerorts Schulprogramme und –profile erarbeitet
als zielorientierte Handlungskonzepte für die Verwirklichung einer
„guten Schule“.
Dabei wird die Geschlechtszugehörigkeit der SchülerInnen,
der Lehrpersonen, aber auch die Wirkmächtigkeit von Strukturen,
Rahmenbedingungen und Curricula auf die Geschlechter-verhältnisse
oft ignoriert. Demokratische Schulentwicklungsprozesse kommen jedoch
ohne Gender-Bewusstsein nicht aus.
Der Band versammelt Beispiele für Schulprogramme
aus neun Schulen in der Bundesrepublik Deutschland (Grund-, Real-, Gesamtschulen
und Gymnasien) und einem Gynmasium in Österreich (Rahlgasse, Wien),
in denen die Mädchen- und Jungenarbeit explizit berücksichtigt
wird.
Dabei werden weniger theoretische Abhandlungen über
Gender-Theorien geliefert, als viel mehr konkrete subjektive
Erfahrungsberichte und Rekonstruktionen der einzelnen AutorInnen (meist
LehrerInnen), wie sich die schuleigenen Entwicklungsprozesse vollzogen
haben: z.B. von Selbstbehauptungskursen für Schülerinnen,
Konzepten zu Lebensplanung und Berufswahlorientierung für Mädchen
und Jungen, Konzepten der Jungenförderung, Methoden der Einbeziehung
der Eltern, Erfahrungen mit Frauenfortbildungen an der eigenen Schule
bis zu den Schwierigkeiten, das Gender-Thema in der Schulprogrammarbeit
zu verankern.
Die LeserIn erhält eine Fülle von Anregungen,
wie es im Sinne der eingangs erwähnten „Schulqualität“
gelingen kann, eine geschlechterbewusste Praxis in den Schulalltag zu
implementieren.
(Claudia Schneider)
Lauggas Meike: Mädchenbildung bildet Mädchen.
Eine Geschichte des Begriffs und der Konstruktionen.
240 Seiten, Milena Verlag, Wien 2000 EUR 17,90
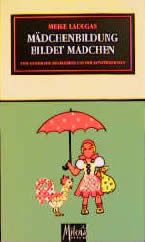 In
ihrer überarbeiteten und erweiterten Diplomarbeit, für die
sie den “Gabriele Possanner-Förderpreis” des Wissenschaftsministeriums
verliehen bekam, geht Meike Lauggas der Wortentstehungsgeschichte
des Begriffs Mädchen sowie dessen, was und wer
damit gemeint sein sollte, nach.
In
ihrer überarbeiteten und erweiterten Diplomarbeit, für die
sie den “Gabriele Possanner-Förderpreis” des Wissenschaftsministeriums
verliehen bekam, geht Meike Lauggas der Wortentstehungsgeschichte
des Begriffs Mädchen sowie dessen, was und wer
damit gemeint sein sollte, nach.
Ausgangspunkt ihrer spannenden diskursanalytischen,
mentalitätsgeschichtlichen und sprachwissenschaftlichen Untersuchung
ist historisches Aktenmaterial: Im Quellenstudium der Akten der Studienhofkommision
(Vorläuferin des heutigen Bildungsministeriums) zur Zeit der Einführung
der allgemeinen Schulpflicht in der Habsburgermonarchie im Jahr 1774
kristallisierte sich die Frage heraus, warum in den Akten das Wort Mädchen
so unterschiedlich geschrieben wurde (z.B. Mägdchen, Magdgen..),
und welches die Worte waren für jene, für die diese Schulen
eingerichtet wurden (z.B. künftige Kindsmütter). Warum wurde
für weibliche Kinder der Diminuitiv-Begriff, d.h. die Verkleinerungsform
Mädchen – und damit das grammatikalisch sächliche Geschlecht
– durchgesetzt?
Die Autorin unterstreicht die Relevanz des
Ortes Schule, über den Mädchen als Mädchen erst
– öffentliche – Wahrnehmung zuteil wurde; sie stellt
die Frage, ob durch die Herausbildung des Wortes Mädchen die Adressatinnen
dieser Bezeichnung überhaupt erst ins allgemeine Bewusstsein drangen.
Meike Lauggas entwickelt eine Bildungsgeschichte von
Mädchen im doppelten Sinn des Wortes. Sie spannt den Bogen bis
zu heutigen riot grrrls-, görl-, girlie-Bewegungen und verdeutlicht
damit die Aktualität der Fragen: Was soll eigentlich Mädchen-Kindheit
sein? Gibt es die Mädchen? Und schließlich: wie präsentieren
Mädchen sich selbst?
(Claudia Schneider)
Lemmermöhle Doris, Fischer Dietlind, Klika Dorle, Schlüter
Anne (Hginnen): Lesarten des Geschlechts. Zur De-Konstruktionsdebatte
in der erziehungs-wissenschaftlichen Geschlechterforschung.
279 Seiten, Leske + Budrich, Opladen 2000 EUR 20,60
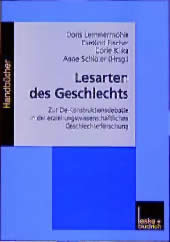 Ein
Sammelband, den frau am besten nicht nur für sich
liest, sondern gemeinsam mit anderen durchdiskutiert.
Ein
Sammelband, den frau am besten nicht nur für sich
liest, sondern gemeinsam mit anderen durchdiskutiert.
Vor allem der erste Teil, der sich
mit theoretischen Ansätzen der Konstruktion und Dekonstruktion
beschäftigt, erfordert ein mehrmaliges Durchlesen: Begriffe wie
Differenz, Gleichheit, Verschiedenheit, Unterschiedlichkeit, sex, gender,...
werden im Sinne eines historischen, philosophischen und sozialwissenschaftlichen
Diskurses beleuchtet.
Im zweiten Teil werden Methoden und
methodologische Aspekte (z.B. Biografieforschung, Interview-situationen)
aus de-konstruktivistischer Perspektive beleuchtet.
Im dritten Teil „Forschungs-
und Handlungsfelder“ stehen schulische Interaktionen im Vordergrund
und widmet sich je ein Kapitel dem Thema „interkulturelle Pädagogik“,
„Behinderung“, „Lebensformen“.
Wer Sätze der Art „Die dekonstruktivistische
Kritik im Feminismus richtet sich gegen die sex-gender-Trennung und
essentialistische Weiblichkeitsvorstellungen, die das biologische Geschlecht
naturalisieren, weil es als unhinterfragbare Grundlage des sozialen
Geschlechts angenommen wird.“ gerne liest, hält hiermit das
richtige Buch über den Einzug der höchst spannenden De/Konstruktions-Debatte
in die Erziehungswissenschaften in den Händen.
(Renate Tanzberger)
Markert Dorothee: Momo, Pippi, Rote Zora ... was
dann? Leseerziehung, weibliche Autorität und Geschlechterdemokratie.
342 Seiten, Ulrike Helmer Verlag, Königstein/Taunus 1998 EUR 21,00
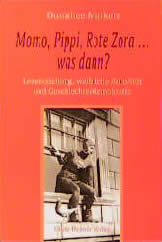 Dieser
Text stellt eine gelungene Mischung zwischen Theorie und Praxis dar.
Die Autorin analysiert Begriffe wie Mädchenliteratur, Vorbild,
Leser/in,..., beleuchtet die Bedeutung des Lesens für Mädchen
und für Burschen, thematisiert pädagogisches Handeln im Spannungsfeld
zwischen Gleichheit und Differenz, Bindung und Freiheit und, stellt
eine Befragung von Hauptschüler/innen über deren Vorbilder
in der Kinder- und Jugendliteratur vor.
Dieser
Text stellt eine gelungene Mischung zwischen Theorie und Praxis dar.
Die Autorin analysiert Begriffe wie Mädchenliteratur, Vorbild,
Leser/in,..., beleuchtet die Bedeutung des Lesens für Mädchen
und für Burschen, thematisiert pädagogisches Handeln im Spannungsfeld
zwischen Gleichheit und Differenz, Bindung und Freiheit und, stellt
eine Befragung von Hauptschüler/innen über deren Vorbilder
in der Kinder- und Jugendliteratur vor.
Ein Herzstück des Buches stellt jenes Kapitel
dar, in dem sieben Kriterien für die Auswahl von Kinder-
und Jugendbüchern, die eine Demokratisierung der Geschlechterverhältnisse
unterstützen können, vorgestellt werden.
Schlüsselelemente sind dabei die Begriffe "Bindung",
"Respekt", und "weibliche Autorität".
Mit 18 positiven Beispielen aus der Literatur werden
die Kategorien (Bindung in einer Beziehung zwischen zwei männlichen
Personen, weibliche Autorität in einer Beziehung zwischen einer
weiblichen und männlichen Person, Respekt in einer Beziehung zwischen
zwei weiblichen Personen,...) anschaulich präsentiert.
Am Ende wird in einer Liste von 270 analysierten Kinder-
und Jugendbücher angeführt, welche der Kategorien in dem jeweiligen
Buch vorkommen. Unbedingt empfehlenswert für Deutschlehrer/innen
und Personen, die gerne Kinder- und Jugendbücher an Mädchen/Buben
verschenken (oder selber lesen)! Und eine gute Anregung, über die
eigenen Lesevorbilder nachzudenken!
(Renate Tanzberger)
Nissen Ursula: Kindheit, Geschlecht und Raum. Sozialisationstheoretische
Zusammenhänge geschlechtsspezifischer Raumaneignung.
259 Seiten, Juventa Verlag, Weinheim/ München 1998 EUR 20,10
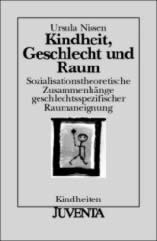 Wie
erfolgt im Zuge des Sozialisationsprozesses die Verbindung von Aneignung
der sozialräumlichen Bedingungen mit der Entfaltung der individuellen
Persönlichkeit?
Wie
erfolgt im Zuge des Sozialisationsprozesses die Verbindung von Aneignung
der sozialräumlichen Bedingungen mit der Entfaltung der individuellen
Persönlichkeit?
Auf der Grundlage der ausführlichen Präsentation
von Konzepten zur (geschlechtsspezifischen) (politischen) Sozialisation
versucht die Autorin die Frage nach der Mitwirkung des eigenaktiven
autonomen Subjekts an seiner eigenen Sozialisation
zu klären.
Nach einer geschlechterdiffenzierenden Analyse der
Begriffe Raum, Öffentlichkeit und politische Partizipation von
Mädchen und Frauen folgert Ursula Nissen: Sozialisationsprozesse
im Sinne positiver Aneignung der öffentlichen Freiräume sind
für Mädchen grundsätzlich erst dann möglich, wenn
die sich im öffentlichen Freiraum ausdrückende sexuelle Mißachtung
von Mädchen (und Frauen), ihre Degradierung zum Objekt durch Belästigung,
Anmache und Gewalt verschwunden ist und Mädchen sich ungehindert,
unbeaufsichtigt und ohne Bedrohung in diesen Räumen bewegen können.
Wer daran interessiert ist, sich (wieder) intensiver
mit Sozialisationstheorien und daraus abgeleitet den
Bedingungen und Voraussetzungen für die Beteiligung
von Mädchen und Frauen in öffentlichen Räumen auseinanderzusetzen,
um für die eigenen Arbeitsbereiche Anregungen zum Weiterdenken
zu erhalten, derjenigen ist dieses Buch zu empfehlen - schnelle Rezepte
zur Umsetzung in der Praxis bietet es nicht.
(Claudia Schneider)
Pipher Mary: Pubertätskrisen junger Mädchen
und wie Eltern helfen können. Übersetzt von Bruni Röhm
und Almuth Carstens.
400 Seiten, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/M. 1999 EUR 9,80
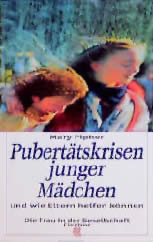 Die
Autorin, us-amerikanische Psychologin und Psychotherapeutin, behandelt
in ihrem Buch die Phase der Adoleszenz von Mädchen und damit einhergehende
Krisen wie Depressionen, Neurosen, Eßstörungen, Suchtverhalten,
aber auch ganz alltägliche Probleme von Mädchen in der Pubertät.
Die
Autorin, us-amerikanische Psychologin und Psychotherapeutin, behandelt
in ihrem Buch die Phase der Adoleszenz von Mädchen und damit einhergehende
Krisen wie Depressionen, Neurosen, Eßstörungen, Suchtverhalten,
aber auch ganz alltägliche Probleme von Mädchen in der Pubertät.
Die Ursachen dafür sieht sie in den widersprüchlichen
Rollenerwartungen, dem Druck der herrschenden gesellschaftlichen
Strukturen, unter dem die Mädchen “ihr authentisches
Selbst ablegen und nur einen kleinen Teil ihrer Fähigkeiten entfalten”.
Vor allem durch die Analyse von sexistischen, alltäglichen
Frauendarstellungen in Werbung, Film, Video-Clips oder Song-Texten -
der medialen Umwelt der Mädchen - macht sie diese und die Leserin
sensibel für mädchen- und frauenverachtende Kultur: ‘lookism’
(d.h. die Beurteilung einer Person einzig nach ihrem Äußerem)
wird ebenso problematisiert wie z.B. Diskriminierungserfahrungen von
Mädchen durch männerorientierte Lehrinhalte in den Schulen
und die herrschende Koedukationspraxis.
In den exemplarischen Fallgeschichten werden Mädchen
mit unterschiedlichsten Erfahrungen vorgestellt, z.B. ein Adoptivmädchen,
ein lesbisches Mädchen, Töchter alleinerziehender Mütter
oder Väter.
Es ist kein psychoanalytisch-theoretisches Buch. Für
die Leserin ist es allerdings in der Fülle von Einzelbiographien
schwierig, den roten Faden zu behalten.
Die Autorin vermittelt die Notwendigkeit der Empathie sowohl für
die Mädchen als auch für die Eltern, v.a. die Mütter,
um einen Prozeß begleiten zu können, in dem Mädchen
sich “ihr wahres Selbst erhalten” und eine “Identität,
die auf ihren Talenten oder Interessen basiert und nicht auf ihrem Aussehen,
ihrer Beliebtheit oder ihrer Sexualität”.
(Claudia Schneider)
Rendtorff Barbara, Moser Vera (Hginnen): Geschlecht
und Geschlechterverhältnisse in der Erziehungswissenschaft.
327 Seiten, Leske + Budrich, Opladen 1999 EUR 25,60
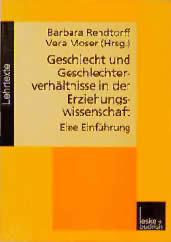 Geschlecht
war in der Pädagogik immer schon ein relevantes Thema. Liest frau
z.B. die Schriften von Rousseau und Pestalozzi, finden sich dort unterschiedliche
Erziehungsideale für Mädchen und Burschen.
Geschlecht
war in der Pädagogik immer schon ein relevantes Thema. Liest frau
z.B. die Schriften von Rousseau und Pestalozzi, finden sich dort unterschiedliche
Erziehungsideale für Mädchen und Burschen.
Das Geschlechterverhältnis ist von Natur aus ein
hierarchisches und die Geschlechtscharaktere von Frau und Mann sind
als polare zu denken - und danach wird auch die Erziehung ausgerichtet.
Dem stehen die Forderungen der 1. Frauenbewegung nach Gleichstellung
und Zugang zu "höherer" Bildung gegenüber - wobei
manche Richtungen auf die wesenhaften Unterschiedlich-keiten von Frau
und Mann beharrten.
Heute ist dieses Thema nach wie vor aktuell, neue Sichtweisen
sind hinzugekommen: sind Frauen und Männer gleich oder different,
sind Mädchen/Frauen defizitär oder die besseren Menschen,
wie/lassen sich Gleichheit und Differenz zusammendenken, sollte die
Zweigeschlechtlichkeit nicht prinzipiell als konstruiert entlarvt werden,...?
Der Sammelband bietet - für an
Theorie Interessierte - eine gute Einführung zu "Geschlecht
als Kategorie", er bemängelt, wie wenig sich die
moderne Erziehungswissenschaft dem Thema bis jetzt gestellt hat und
zeigt, wie Geschlechterforschung in verschiedene Teildisziplinen Eingang
finden könnte.
(Renate Tanzberger)

