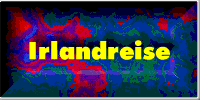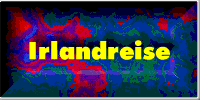| |
Doe
Castle, Dunfanaghy Workhouse, Bloody Foreland, Letterkenny
12. Juni 1999
Frühstück um 8 - früher gibt´s nix, leider. Sonst gibt´s auch nix in
Letterkenny, auch keine Zeitungen, die Geschäfte öffnen erst um 8. Dann
wären zwar die Zeitungen da, aber am Samstag besteht eine jede aus mehreren
Einlagen und die müssen erst eingeordnet werden. Frühstück ist kümmerlich,
das Geschirr zwar Steingut in bunten Farben, aber auf dem schwarzen Teller
liegen nur zwei Scheiben Frühstücksspeck (Rashers), klein wie von einem
Ferkel (bestenfalls) und das in Fett schwimmende Spiegelei muß von einer
Taube sein. Außer mir speisen noch 3 Gäste fein.
Im Letterkenny Shopping Center am Rand der Innenstadt kaufe ich danach
Verpflegung. Vor dem Supermarkt macht ein Fotograf routiniert Fotos von
kleinen Kindern, die ihm die stolzen Mütter hinhalten. Ein passender
Hintergrund wird von der Rolle gezogen, Teddybären und Spielzeugautos
hingelegt, der Junior oder die Juniorin, je nach dem, lächelt verzückt, der
Fotograf rasselt mit einer Rassel, JuniorIn blickt fasziniert auf die Rassel
- klick. Bild in einer Stunde fertig, JuniorIn entfernt, neue(r) JuniorIn
hingesetzt - das Geschäft läuft gut. Es lief auch schon voriges Jahr gut und
vor zwei Jahren, wie ich von früheren Urlauben weiß. Allmählich müssen doch
alle stolzen Mütter von Letterkenny und Umgebung ihre sämtlichen Kinder
vorbeigebracht haben. Offenbar gibt es aber noch immer welche - und immer
wieder neue - die noch nicht abgelichtet wurden.
Durch die Hauptstraße fahre ich sodann nach Westen, bei den Dunnes Stores
biege ich nach rechts ab, Richtung Churchhill. Der Weg ist ausgeschildert,
Richtung Glenveagh National Park und Glebe House. Ich will zu einer
dazugehörigen Attraktion, dem Colmcille Heritage Center, im Reiseführer
lebhaft gepriesen. Trotz der Hinweisschilder tue ich mir schwer, die
Ortsnamen sind auf irisch und die englischen Namen sind schwarz übersprüht.
Auf einem Güterweg fahre ich endlich zum Ufer des Lough Gartan, an dem die
Attraktion liegt. Ich finde den auf alt getrimmten und daher mit
Granitsteinen verblendeten Neubau völlig verlassen vor, kein Mensch, kein
Auto, die Vögel zwitschern. Als ich weiterfahren will, parken zwei
Holländerinnen ihr Auto und schon warten wir zu dritt, aber nicht lange,
denn ein weiteres Auto rauscht herbei. Ihm entsteigt ein zartes Burli, noch
halb schlafend, zerzaust, verspätet. Wir drei zahlen dem Jüngling je 1,5
Punt, danach dürfen wir die Ausstellung besichtigen.
Der heilige Columba hat auf der zu Schottland gehörigen Insel Iona ein
Kloster gegründet und ist ganz zweifellos eine bedeutende Persönlichkeit
gewesen, der einen wichtigen Beitrag zur Verbreitung des Christentums in
Irland und Schottland geleistet hat. Historisch ist er nicht leicht zu
fassen, es ist nämlich nichts von ihm erhalten, gar nichts, was man
herzeigen könnte. Wie erzeugt man in Irland eine Attraktion? Man macht einen
Plastikabguß eines Hochkreuzes, man produziert ferner die Wachsfigur eines
Menschen mit irischer Tonsur (Glatze mit Haarkranz ringsum) und kleidet sie
mit modernen Stoffen so ein, wie sich die Leute zu Columbas Zeiten angeblich
angezogen haben. Wieso man das weiß? In den Bilderhandschriften irischer
Mönche finden sich Abbildungen derselben und ihrer Kleider. Diese Figur
setzt man an eine Schreibtafel. Das ist es dann. So einfach. Damit kann man
kein Heritage Center mit Touristen füllen, auch nicht in Irland. Also zeigt
man die verschiedenen Arbeitsgänge zur Herstellung einer Handschrift,
nämlich: 1. Eselshaut, 2. Schwarzes Pulver (Ruß) für die Tusche, 3. Rotes
Pulver, 4. Blaues Pulver etc, für die Verzierungen, jedes Pulver in einer
eigenen Schale, klar. Dazu das Dia einer Seite einer solchen fertigen
Handschrift.
Jetzt also weiß der geneigte Besucher, wie man eine Handschrift erzeugt,
nicht? Ach ja, die Geisteshaltung, die einen Menschen, der extrem
kurzsichtig sein musste, um alle Details seiner Arbeit auch zu sehen (Lupen
gab es leider noch nicht), Monate und Jahre zur höheren Ehre Gottes bei
Regen und Kälte und mit klammen Fingern einen beschaulichen Text
abzuschreiben, bei wenig Schlaf, bescheidenem Essen und vielen heiligen
Messen zwischendurch, ach ja, die Geisteshaltung eines solchen Menschen kann
sich der geneigte Besucher dazudenken, wenn er will. Die kann man ja in
einer Schale oder einem Dia nicht zeigen. Aber dafür bekommt er Kaffee und
Tee und Sandwichs, sollte er nach den Anforderungen der Ausstellung ein
Bedürfnis dazu haben - heute leider geschlossen.
Um diese Attraktion sollte man einen Umweg machen.
Den Wegweisern zu des Heiligen Geburtsstätte folge ich nach dieser
Ausstellung lieber nicht. Im übrigen ist Columba mangels Wundern und mangels
Martyrium kein Heiliger, er heißt nur so. Von Kultur habe ich jetzt genug,
daher folge ich auch den Wegweisern zum Glebe House nicht. Bilder von
Picasso gäbe es dort, sagt jeder Reiseführer. Den Glenveagh National Park
erspare ich mir überhaupt, da bin ich eigen. Ein gotisches Schloss aus dem
Jahre 1870 liegt mir nicht und ein Alpengarten auch nicht. Ebenso wenig
Bäume aus Neuseeland etc., die der Schöpfer des ganzen hier eingepflanzt
hat. Dazu allerdings mußte Herr John Adair 200 Bauernfamilien von seinem
Grund und Boden vertreiben, den sie bis dahin bewirtschaftet hatten. Sonst
hätte er seine famosen ausländischen Bäume nicht anpflanzen können. Die 200
Familien, sofern sie die Überfahrt überlebten, durften dann in Amerika oder
sonst wo eine neue Existenz gründen. Der Tüchtigste setzt sich eben durch im
Leben. Wie nennt man eigentlich einen Menschen, der Bäume mehr liebt als
Menschen? Philanthrop jedenfalls nicht. Und wenn Sie das nächste Mal
Tabasco-Sauce verwenden, denken Sie an Glenveagh. Dessen Erzeuger kaufte das
Ganze von Adairs Witwe und schenkte es Jahrzehnte später dem irischen Staat,
als es den Tabascospross nicht mehr freute, jährlich von Amerika ins feuchte
Irland zu reisen.
Auf vielen Seitenstraßen fahre ich bis zur Hauptstraße (N56) und fahre
Richtung Creeslough und auf einer Seitenstraße zum interessanten Doe-Castle,
das nichts mit Hirschen zu tun hat, sondern sich von einem irischen Wort
ableitet, das etwas ganz anderes bedeutet. Was, habe ich mir nicht gemerkt,
aber falls Sie hinkommen, vor demselben steht eine Tafel, auf der das alles
erläutert wird. Im wesentlichen besteht die Burg aus einem Wehr(Wohn-)turm,
an den um 1830 ein Wohntrakt angefügt wurde, ehe der Bau Mitte des 19.
Jahrhunderts aufgegeben wurde. Von diesen Anbauten stehen nur mehr die
Außenmauern, der Turm ist besser beisammen und wird eben restauriert.
Häßliche Baugerüste verunzieren ihn, zuhause werde ich die Bilder am PC
nachbearbeiten müssen. Das Betreten des Geländes ist verboten, ich
überklettere Mäuerchen, Gittertore etc. und mache schließlich von der Bucht
aus die erwünschten Bilder. Der Rückweg ließe sich abkürzen, der Zaun ist
nicht unübersteigbar, aber der Grundeigentümer hat alle 10 Meter ein Schild
angebracht: Beware of Bull. Zwar liegen die Rindviecher allesamt friedlich
im Gras, aber wer weiß, vielleicht lauert doch irgendwo ein Stier und wartet
auf den rechtsbrechenden Österreicher.
Auf dem Picknickplatz vor der Burg gibt es Mittagessen, wenn auch nicht so
vornehm wie bei Engländers nebenan. Stilecht wird aus einem Weidenkorb das
Essen ausgepackt und auf dem Tisch ausgebreitet. In so einem Korb
transportiere ich höchstens meine Katze zum Tierarzt.
Nach dem Essen fahre ich nach Dunfananghy weiter mit hübschem Sandstrand,
aber leider, in Dunfananghy regnet es. Keine Strandwanderung daher.
Am Ortsende sehe ich ein Hinweisschild: The Workhouse. Hundert Meter weiter
sehe ich rechts zwei abschreckend wirkende Häuser aus grauem Granit mit
Ruinengelände dahinter und Parkplatz davor.
Die hässlichen Häuser sind Mahnmale für eines der dunkelsten Kapitel der an
solchen wahrhaft nicht armen Geschichte Irlands unter britischer Herrschaft.
Errichtet wurden sie 1830 als Unterbringungsstätte für die Armen. Die aber
sollten sich dort durchaus nicht wohl fühlen, sonst wären sie am Ende gar
übermütig geworden. Daher wurden diese Arbeitshäuser mit Absicht kärglich
ausgestattet, unbequem, mit Absicht hässlich. Wer dort unterkam, musste
arbeiten. Wer nicht arbeitete, bekam kein Essen. Brot gab es ohnehin nicht,,
pro Tag statt dessen mehrfach einen (kleinen) Teller Hafergrütze, zum
Frühstück eine kleine Schale Buttermilch und mittags ein halbes Kilo
gekochter Kartoffel (Kinder jeweils die Hälfte). Dafür mußten die Männer 16
Stunden am Tag arbeiten, das heißt, Steine klopfen (zu Schotter), oder alte
Seile aufspleißen (zu Dichtmaterial für Segelschiffe mit hölzernen Rümpfen),
die Frauen spinnen und weben. Die Kinder mußten nur 4 Stunden täglich
arbeiten, dafür aber lesen und schreiben lernen, nicht viel, aber doch,
damit sie es im späteren Leben zu nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft
brachten (als Dienstboten und Mägde etc.). Ähnliches hatten ja wohl auch
Hitler & Himmler mit den russischen Untermenschen vor, nach dem Endsieg,
oder?
Während der großen Hungersnot zwischen 1845 und 1850 beherbergte dieses
Arbeitshaus zeitweilig bis zu 600 Insassen, in einem teilweise erhaltenen
Hintertrakt geschlichtet wie die Sardinen in mehreren Schichten (Etagen).
Dabei durften die drinnen sich noch glücklich schätzen, denn die draußen
hatten - gar nichts. Während über eine Million Iren verhungerte, wurden
ganze Schiffsladungen voll Getreide und Schlachtvieh nach England
exportiert, gleichzeitig aber auch ganze Schiffsladungen halb verhungerter
Iren in den so genannten Coffin Ships nach Kanada verschickt. Aber das ist
eine andere Geschichte. Die Toten werden nicht wieder lebendig, wenngleich
schon nach 150 Jahren ein englischer Premierminister (Blair) den Anstand
hatte, sich für die begangenen Fehler bei der Bekämpfung der Hungersnot in
Irland zu entschuldigen.
Das ist der historische Hintergrund der Ausstellung. Was sie so
eindrucksvoll macht, ist meiner Meinung nach die Idee, die Verhältnisse an
Hand von Situationen aus dem Leben von "Wee Hanna" zu schildern, einer der
einstigen Insassen. Wäre nicht ein Nachbar gewesen, der die Erzählungen der
alten Frau vor ihrem Tod in den 20-er Jahren niederzuschrieb, sie wäre
ebenso vergessen wie all die anderen, die nichts mehr sind als -
Statistiken.
Auf der Weiterfahrt entscheide ich mich für Strecke zum Bloody Foreland. Das
ist weit weniger dramatisch als es klingt, die Sonnenuntergänge sollen dort
besonders schön anzusehen sein. Das Meer auch, füge ich hinzu, aber wohnen
möchte ich dort bei Gott nicht. Das ist im übrigen auch das Land der
Pappendeckelschachteln von Wohnwagengröße, in denen dort die Armen wohnen.
Natürlich ist das auch ein Teil der Gaeltacht, in der die Leute angeblich
untereinander gälisch reden. Die Aufschriften sind es jedenfalls. Erst als
ich den Parkplatz eines hübschen, strohgedeckten Cottages verlassen habe,
entdecke ich an Hand einer Abbildung, daß es sich um ein Teehaus gehandelt
haben dürfte.
Nach Letterkenny zurückgekehrt, gerate ich in samstägliche Betriebsamkeit.
Einen Wettlauf behinderter Kinder und Jugendlicher habe ich versäumt, aber
sie sind noch unterwegs mit Eltern und Verwandten und ich wundere mich über
ihre Fröhlichkeit. Mir ist nicht sehr fröhlich zumute.
Gegen Abend dann Hupkonzerte und die dröhnenden Lautsprecherstimmen aus
ganzen Wagenkolonnen. Gemeinde- und Bezirksratswahlen hat es gegeben, Wahlen
zum Europäischen Parlament. Im Fersehen am Abend sagen sie dann alle, ohne
Ausnahme, sie hätten gewonnen.
Kann ja wohl nicht sein, oder?
|