
- M -
Maastricht
ist ein kleines Nest in Südholland nahe der deutschen Grenze bei Aachen. Nicht daß dort was besonderes wäre - dort betrat ich, als ich in Aachen war, zum ersten Mal niederländischen Boden.
Das hätte ich mir damals, in den ersten 70er Jahren auch nicht in Traum ausmalen können, welche Bedeutung die kleine Stadt 20 Jahre später durch die EU-Verträge erreichen sollte.
war lange Zeit die asiatische Perle in der portugiesischen Krone, sogar die wertvollste. Dort wurde jedes Jahr das Schwarze Schiff beladen, das unermeßliche Reichtümer ins Heimatland der Seefahrer brachte (nachzulesen in Shogun).
Heute ist Macau der Stiefzwilling Hong Kongs, eine heruntergekommene Stadt, die nur von ihren laxen Gesetzen leben kann, die viel mehr Glücksspiele als im Duftenden Hafen erlauben. Abblätternde Häuser, Rikschafahrer, die keine Kunden finden, Antiquitätenläden, unglaublich viele Zahnärzte und manchmal ein Autorennen in der Stadt. Bis heute wundere ich mich, wo das wohl stattfinden könnte, dort gibts noch viel weniger Platz für ein Rennen als in Monte Carlo.
Von der portugiesischen Vergangenheit ist nicht viel mehr geblieben als viele Namen und das leere Portal der ehemaligen Kathedrale, das auf einem Hügel über einer Freitreppe thront, als sei noch was dahinter.
Als kulinarische Köstlichkeit probierten wir ein Mittagessen in einem Dim Sum Lokal.
gehört zur Standardausrüstung,
wen man in Lateinamerika irgendwo in die Landschaft geht, sei es als Minero,
Landwirt oder Spezialtourist (wie wir).
Der richtige Mann in ländlichen Gegenden fühlt sich sozusagen nackt,
wenn er keine Machete bei sich hat. Das geht dann so weit, daß die Mitnahme
auf einem Inlandsflug in Guatemala - von Guatemala
City nach Tikal - nicht einmal ein Augenbrauenheben wert war; das
gehört einfach zur Tagesordnung
die kleine Stadt östlich des Gunung Lawu, die außer durch ein Eisenbahnmuseum durch einen 1948 veranstalteten kommunistischen Putsch bekannt ist, durchquerten wir umsteigenderweise auf unserer Reise nach Probolinggo über Kertosono, Mojokerto und Gempol.
1979 - Eine fast leere Boeing 707, noch dazu mit normaler Sitzweite, trägt uns von Colombo nach Norden. Unter uns endlos scheinende Kokosplantagen, gesprenkelt mit gewundenen Flüßchen, Reisfeldmosaike und unzählige "Tanks". Dieses Tamilwort für ein Wasserreservoir ging über die britische Kolonialverwaltung in den modernen Wortschatz ein. Höher und höher steigt die Maschine, die blendendweißen Kumulustürme, die vom bengalischen Golf nach Norden ziehen, verhüllen die Landschaft mehr und mehr. Nach 45 Minuten Flug taucht das Festland im Dunst auf, Indien in allen nur vorstellbaren Schattierungen von Braun und Ocker. Graubraune Regenwolken über Äckern in Siena, mit ockerfarbenen Teichen und Bächen, die Geometrie der Wege und Straßen hin und wieder von einer zerzausten Palme unterbrochen.
Wir landen im Sprühregen und reihen uns in die Schlangen vor Paß- und Zollkontrolle ein. Die Enkel der britischen Kolonial-Administration schwelgen in riesigen Formularen in Hindi und Englisch, auf eine Art Klopapier gedruckt und kaum lesbar. Wir müssen eine komplizierte Devisendeklaration ausfüllen und jede Art technischer Geräte oder Schmuck, die wir mit uns führen, angeben. Dieter kann sich erfolgreich davor drücken, sein Tonbandgerät, das er verkaufen will, zu deklarieren.
Ein erster Hauch des Subkontinents weht uns an, als der Beamte plötzlich zwei Schritt zurücktritt, sich herzhaft mit den Fingern schneuzt und dann wieder zur Tagesordnung und den Formularen zurückkehrt...
Gewitzt durch die Erfahrungen in Colombo und aufbauend auf einem neuen Reiseplan, den wir uns während des Fluges überlegten, buchen wir sofort den Rückflug Trivandrum-Colombo. Es wird viel telefoniert, unsere Namen und Paßnummern werden in Formulare, Bücher und Ordner eingetragen, noch einmal telefoniert, dann können wir uns verwirrt, doch mit der ernsthaften Versicherung, es werde allsogleich alles mittels Telex geregelt werden, der Weiterreise widmen.
Der dritte Taxifahrer läßt sich auf Verhandlungen über den Fahrpreis ein und bald rollen wir gemächlich, wie üblich mit dezentem Motorklingeln im höchsten Gang, durch die drittgrößte Stadt des Landes in Richtung Busstation. Viele Gebäude stammen noch aus der Kolonialzeit, mit vergammelten Veranden und Arkaden; Menschenschlangen drängen sich vor Regierungsbüros, gelangweilt von Polizisten mit meterlangen Schlagstöcken beobachtet. Immer wieder sind die Straßen von haushohen Kinoreklamen eingesäumt - farbenprächtige und sentimentale Ungeheuerlichkeiten.
Die Busstation (wir wollen nach Mahabhallipuram) liegt in einer Art Hinterhof - Feuermauern umgeben eine Schlammwüste, in der die Busse wirr durcheinanderstehen. Noch im Aussteigen umringt uns eine Horde zerlumpter Buben. "Hello, Rupeeeee, How are you, Rupeeeee, Whats your name, Rupeeeee....". Alle wollen einen Rucksack tragen, alle wollen eine Rupee. Ratlos fragen wir nach dem Bus nach Mahabhallipuram. Die Zielorte der Autobusse sind natürlich nur in Tamil, der Hauptsprache des Bundesstaates Tamil Nadu, angeschrieben.
Des Tamil unkundig werden wir von einem kleinen Buben zu einem Bus geführt, der sich gerade auf die Reise machen will. Kopfwackelnde Bestätigung vom Fahrer, "jaja, es geht nach Mamallapuram", wir sollen uns nur hineinzwicken. Platz finden wir nur mehr stehend im Gang, der Autobus ist nach europäischen Verhältnissen brechend voll. Auf den Bänken, die unserer Empfindung nach für zwei Personen berechnet sind, sitzen vier Menschen. Mit Motordröhnen und Getriebeknirschen verlassen wir die Busstation und die einheimischen Ausflügler schlafen fast auf der Stelle ein, schaukeln kollektiv bei jedem Schlagloch.
erlebte ich nur einen Aband bei einem Stopover nach Guatemala. Da waren die Leute von IBERIA noch freundlich und kompetent, organisierten unser Hotel und die zu- und Abfahrt. Später ließ dann stark nach.
So war nicht viel zu erleben, außer einem kurzen abendlichen Spaziergang im Regen und diverse Aussichten auf Stadtautobahnen.
Um 8:30 Uhr fährt der Expreßbus nach Madurai ab. Ilona war so ungeschickt, ihre Malariatabletten vor dem Frühstück zu schlucken und jetzt wird ihr bei der Schaukelei entsetzlich schlecht. Die Fahrt geht vor allem über Nebenstraßen, die sich durch Reisfelder winden. Das enge, holprige Aphaltband veranlaßt die Fahrer der abenteuerlich hoch angepackten Lastwagen, die gemütlich durch die Felder zockeln, zu noch größerer Sturheit, wenn es ums Platzmachen geht. Der Fahrer des Autobusses greift dann zum einzigen Mittel, das ihm noch bleibt und versucht, die Konkurrenz von der Straße zu hupen...
Das Governement Resthouse in Madurai ist eine weitere nostalgische Ausgabe britischer Tropenarchitektur mit offenen Veranden und Moskitonetzen. Nach einem späten Mittagessen mit Chicken Biryani und Schokoladepudding wandern wir zum großen Meenakshi-Tempel. Eigentlich ist es ein Zwillingstempel, Shiva und seiner Frau Parvati geweiht.
Die Gründung dieser Tempelstadt wird schon in den Puranas (Legenden aus prähistorischer Zeit) erwähnt. Im Urwald fand ein gewisser Indran einen Shiva-Lingam göttlichen Ursprungs. Er baute einen Kultraum und einen Turm über dem steinernen Phallus. Durch einen Händler namens Dhananjayan erfuhr der südindische König Kulasekhara Pamdyan um 1600 v.Chr. davon. Er ließ den Wald roden und baute rings um das Heiligtum die Stadt Madurai. Erst zwischen dem 12. und dem 16. Jahrhundert n.Chr. erhielt die Tempelstadt durch immer neue Erweiterungen ihre heutige Gestalt.
In der Mitte des 20. Jahrhunderts renovierte man die verfallenen Anlagen. Die Ausgaben beliefen sich auf 2.5 Millionen Rupees (2.5 Mio US$). Die Frage, ob man die Gopurams (Tortürme) in jenen leuchtenden Farben anstreichen sollte, von denen in den Inschriften über den ursprünglichen Zustand die Rede ist, wurde durch einen Volksentscheid bejaht.
Die beiden Cellen des innersten Tempelbezirkes sind dem Gott Shiva, unter dem Namen Sundareshvara und der Göttin Meenakshi, einer Inkarnation von Shivas Gefährtin Parvati, die er in Madurai heiratete, geweiht.
Schon in den engen Gassen, in denen der riesenhafte Süd-Gopuram über den Dächern sichtbar wird, begegnen wir immer wieder malerisch dekorierten Sadhus. Männer, die ihr Leben ganz oder zeitweilig der Ausübung ihrer religiösen Pflichten widmen und nur das wenige, das mit sich tragen, besitzen. Zwei oder drei Baumwolltücher als Kleidung, eine kleine Stofftasche und prächtige Ketten aus heiligen Nüssen. Dazu bemalen sie sich mit den Farben und Symbolen des Gottes, den sie verehren.

Zwar sind die Tempeltore der Nachmittagsruhe wegen geschlossen, Touristen dürfen jedoch, nach Tributleistung von 5/= Rupees, auch zu dieser Zeit hinein. Zusätzlich wird uns von den Türhütern versichert, daß zu den normalen Öffnungszeiten Fotografieren im Inneren verboten sei - ein ganz biederer Trick, um die Geschäfte zu beleben. Der große Zwillingstempel hier in Madurai, Shiva und seiner Frau Parvati geweiht, ist mit Sicherheit einer der eindruckvollsten im ganzen Süden, wenn nicht im ganzen Land. Shiva und Parvati werden hier unter den Namen Sri Meenakhshi und Sri Sundareshwara verehrt.
Nirgends wurde die Ausbildung der Gopurams, der Tortürme, die den Zugang zu den konzentrischen Bereichen bewachen, so weit getrieben wie hier und nirgends dürfte die Ausstattung der Bauwerke so manieristisch sein wie hier. Hunderte von Stuckskulpturen bedecken die Außenwände der Türme, Götter und Dämonen in all ihren Erscheinungsformen mit allen ihren Attributen der Macht sind dargestellt. Wie sehr die Religion und ihre Ausübung in der Bevölkerung lebendig und verankert ist, kann man daran messen, daß die letzte Generalrenovierung des Tempels vor einigen Jahrzehnten allein aus einer öffentlich Sammlung finanziert werden konnte.
Durch einen kleinen Einschlupf ist die Treppe erreichbar, die immer steiler werdend, durch alle neun Stockwerke des Turmes bis zum Dachhelm führt. In den Zwischengeschoßen brüten überall Schwalben, die Nester sind an die Wände und die Decke geklebt. Erst hier oben kann ich erkennen, wie viele es hier gibt. Der Himmel über dem Tempelareal wimmelt nur so von ihnen. Mit voller Geschwindigkeit fliegen sie ihre Heimstätten durch die Fensterschlitze an, Kollisionen mit den ungebeten Gästen mit Mühe vermeidend. Aus der Finsternis des letzten Stockwerkes führt eine Hühnerleiter direkt ins Sonnenlicht, durch eine Luke auf den Dachhelm 30 Meter über der Straße. Kein Geländer, nur Wind und Sonne und ein atemberaubendes Panorama über Tempel, Stadt und Umland.
Die Tempelanlage ist ein Labyrinth aus Hallen, Wandelgängen, Tanks, kleinen Schreinen, Devotionalienläden, organisch im Laufe vieler Jahre gewachsen und ab 16:00 Uhr von Gläubigen durchströmt. Viele Menschen kommen hier auf einen Abstecher von ihren täglichen Geschäften herein, stellen ihren Einkaufskorb in die Ecke und widmen sich mit Inbrunst ihrer Andacht, die oft mit merkwürdig aussehenden Gymnastikübungen verbunden ist. Die Hände fassen kreuzweise die Ohrläppchen, in dieser Haltung einige Kniebeugen, dann werden die Fingerknöchel an die Stirn geschlagen, dann wirft sich der Gläubige lang auf den Boden und murmelt Gebetsformeln. Unvermittelt ist die Andacht zu Ende, der Gläubige springt auf, schnappt seinen Einkaufskorb und verschwindet.
Einer der herumlungernden Hilfspriester, vor allem an seiner Schnur zu erkennen, spricht uns an, während wir uns das exotische Treiben ansehen. Er erzählt uns von der abendlichen Prozession, bei der das Bild der Göttin Meenakhshi, eine der Erscheinungen Parvatis zu ihrem Gatten - Shiva - getragen wird. Er stellt uns die Sache so dar, daß wir in seiner Begleitung das Schauspiel viel besser und sicherer erleben könnten. Wir gehen auf seine Ratschläge, "Bakschisch" steht ihm auf der Stirn geschrieben, schon allein der Ruhe wegen nach und verabreden uns für 19:00 Uhr. Dann wandern wir durch die Reihen der Devotionalienhändler in die auf der anderen Straßenseite gelegen "1000-Säulen-Halle", die "Tirumala Chaultry" heißt.
Hier wimmelt es vor allem von Schneidern, einer neben dem anderen, all das unter drohenden Ungeheuern, die fratzenschneidend aus den Säulen zu springen scheinen. Der Gegensatz der kunstvollen Bildhauerarbeiten mit dem geschäftigen Treiben ergibt ein merkwürdiges Bild. Vom hochmütigen Seidenhändler, der gelangweilt auf zahlungskräftige Kundschaft wartet, bis zum Flickschneider, der mit seiner tragbaren Nähmaschine in einem Winkel hockt und Dhotis flickt, ist alles zu sehen. Als wir zurück zum Resthouse wandern, ist es bereits Nacht geworden; Ströme von Radfahrern, Rikschas, Pferdewagen und Fußgängern wälzen sich durch die Finsternis, die nur hin und wieder von einzelnen Glühbirnen oder Öllampen markiert wird. Die Gehsteige entlang sitzen Straßenhändler, die Obst, Gemüse, Plastikarmreifen, Devoltionalien, Haushaltgeräte und Messinggegenstände feilbieten. Sogar Nepalis mit dicken Pullovern und Wollhauben sind da und verkaufen Stricksachen.
Wir sind schon neugierig, ob der Kellner aus dem Resthouse sein heute morgen gegebenes Versprechen halten kann, uns Bahntickets nach Rameeshwaram, natürlich gegen Spesenersatz, zu besorgen. Wir haben noch immer Schwierigkeiten damit, uns Dienstleistungen gegen Bezahlung abwickeln zu lassen. Ticketbesorgen, Rikschafahren, Rucksacktragen und was da sonst noch möglich ist. Die egalitären Ideale westlicher Prägung reiben sich an der scheinbaren Unterwürfigkeit, mit der viele dieser Vorschläge an uns herangetragen werden. Das andere Extrem sind die Priester, die herumlungernd von allen mit der größten Selbstverständlichkeit Tribut fordern und auch bekommen.
Nach einem fürstlichen Abendessen mit Gemüsesuppe, Chickencurry, scharf gebratenem Fisch und Schokoladepudding schlendern wir wieder in den Tempel, zur abendlichen Prozession. Der Priester versucht uns mit Beschlag zu belegen, als wären wir sein Eigentum. Es kann keine Rede davon sein, daß wir seinen Beistand nötig haben könnten. Die abendliche Prozession ist ein täglich stattfindendes öffentliches Ereignis, zu dem sich viele Gläubige und Schaulustige einfinden. Vor dem Eingang zum Meenakhshi-Schrein wurde ein Teppich ausgebreitet und eine kleine Musikkapelle wartet auf das Erscheinen der Göttin. Tempelmusiker mit einer Violine, diversen Trommeln und Tschinellen und Schalmeien. Als die kleine, aus Silber getriebene Sänfte mit dem Bild der Göttin herausgetragen wird, beginnt die Kapelle ganz dezent mit der Musik - leiser Gesang mit Trommel- und Streicherbegleitung. Priester mit Dreizackfackeln umringen die Sänfte und warten, bis sich die Teilnehmer der Prozession gesammelt haben. Durch die Gläubigen, die sich zu Boden warfen, als sie die Sänfte zu Gesicht bekamen, bewegt sich der Zug etwa 30 Meter weiter zu einem Nebenaltar an der Außenmauer des Allerheiligsten. Dort werden Öllampen entzündet, die Musik spielt eine weitere Strophe aus ihrem nicht endenwollenden Lied, Gebete werden gemurmelt, die Statue auf dem Altar angeräuchert. So bewegt sich die Prozession gemächlich von einem Schrein zum anderen in Richtung Eingang des Sundareshwara-Schreins. Dort wird die Sänfte abgestellt und dann legen die Musiker richtig los. Die tolle, synkopierte Musik würde bei jedem europäischen Jazzfestival Eindruck machen. Priester und Gläubige umwandern die Sänfte, werfen sich zu Boden, fächeln Weihrauch. Dann ist ganz unvermittelt alles zu Ende, die Musik bricht ab, die Sänftenträger rennen in den Schrein, die Versammlung löst sich auf.
Bei der Rückfahrt ins Resthouse schüttet es wie aus Schaffeln. Wenn das so weitergeht, ist bald der ganze Landstrich so unter Wasser gesetzt, wie die Gassen hier in der Stadt. Ein beinamputierter Bettler kriecht durch eine der überfluteten Gassen, alte Lastwagenschläuche über Kopf und unter dem Rücken als Nässeschutz. Uns wird bewußt, wie sehr wir uns schon an die hier weit verbreitete gleichgültige Mentalität Bettlern gegenüber angepaßt haben. Durch die vielen Begegnungen mit offensichtlichen Simulanten und vor allem durch den Anblick bettelnder Frauen, die ihre Säuglinge oft brutal zwicken, um mit dem weinenden Kind mehr Eindruck zu machen, beschränken wir uns jetzt darauf, nur mehr Kranken oder Invaliden etwas zu geben.
Wir verbringen den größten Teil des Tagen mit Spazierengehen, wandern durch die Stadt und verschiedene Läden, betrachten Stoffe und Goldschmiedearbeiten. Da die Ticketbeschaffung durch den Kellner doch nicht geklappt hat, gehen wir auf gut Glück zum Bahnhof, um die Verbindungen zu erkunden und wenn möglich Tickets zu kaufen.
Da uns mindestens fünf Menschen schon während des Aussteigens ein Zimmer vermieten wollen, natürlich äußerst billig und sauber, steigt Widerwillen in uns auf und so wandern wir in der Mittagshitze mit Rucksack zum "Governement Resthouse". Der Zimmerpreis von Rp 130/= (ca. 300 S) und die Rückwanderung lähmen uns so, daß wir uns widerstandslos im ersten "Hotel" einquartieren lassen. An einer kleinen Ziege, die in der Veranda Zweige abknabbert, vorbei klettern wir in den ersten Stock. Die Zimmer würden zwar den Ansprüchen mitteleuropäischer Waschmittelwerbung nicht genügen, sind jedoch recht ordentlich und kosten nur 20/= für ein Doppelzimmer.
Nach wenigen Minuten treibt uns die Neugier wieder auf den Hauptplatz. Wie in jedem Dorf ist der Platz auch hier gesellschaftliches und geschäftliches Zentrum. In der Mitte ein kleiner, mauerumrandeter Tempel, alle Autobusse und Kühe stehen hier herum, auch die meisten Läden und Lokale sind hier zu finden. Nachdem wir in einer Teebude eine gute halbe Stunde mit Plaudern, Zuschauen und Warten verbrachten, ohne daß das Teewasser gekocht hätte, wandern wir weiter in ein vegetarisches Restaurant. In Unkenntnis der Usancen lassen wir uns vom Chef des zahlreichen Personals je ein "meal", also eine komplette vegetarische Mahlzeit bringen. Das beginnt mit einem frischen Bananenblatt, das von einem kleinen Buben gebracht wird. Dann bringt ein anderer Bursche den Reis, der aufs Blatt geklatscht und mit diversen Gemüsegerichten und Chutneys ergänzt wird. Gegessen wird natürlich mit den Fingern - ein Besteck zum Bananenblatt wäre ein Stilbruch. Am Nebentisch ißt eine Familie mit weithin hörbarem Appetit, die Frau mischt das Joghurt, das als Nachspeise serviert wird, mit voller Hand unter den Reis, wie Kinder, wenn sie Schlammkuchen anrühren... Zufrieden und satt beobachten wir dann noch den Personalüberfluß im Lokal - natürlich nur durch unsere Vorurteile gesehen. Menschen sind eines der wenigen Dingen, die dieses Land im Überfluß aufzuweisen hat.
Nach jeder dritten Wegbiegung sieht man hier Tempelanlagen, monolithisch aus dem gewachsenen Fels gehauen, an den Strand gebaut oder auf die runden Granitkuppeln, die hier überall die Landschaft dominieren, hingestellt. Mit uns spazieren Sonntagsausflügler aus Madras, in westlicher Kleidung, Einheimische im Dhoti und Pilger in weißen Baumwolltüchern, die Köpfe bis auf einen kleinen Schwanz am Hinterkopf kahlrasiert. Die Pilger klettern aus hoffnungslos überfüllten klapprigen Bussen, bestaunen nur kurz die Tempelchen und das berühmte Elefantenfries, dann wandern sie zum Tank, um sich und ihre Kleider zu waschen. In der buckeligen Granitlandschaft, Rohmaterial für neue Tempel und andere Steinmetzarbeiten, turnen kleine Affen und Papageien, Schmetterlinge in jeder Form und Farbe gaukeln überall herum, ein Idyll.
Später sehen wir im Ort, daß die Steinmetzkunst offenbar noch immer in Blüte steht, denn allerorten sind die Handwerker dabei, aus dem grünen Granit die verschiedensten Dinge zu verfertigen, vom Toustristenkitsch bis zu stockhohen, mit traditionellen Motiven verzierten Säulen und Fensterverblendungen. Später werden wir diese Arbeiten noch oft in Tempeln und sogar Hotelneubauten sehen können.
Für 5/= Rupees pro Tag kann man hier ein Fahrrad mieten und so erforschen wir uns mit unseren Drahteseln in die nähere Umgebung des Dorfes. Als ungeduldige, in einer Industriegesellschaft aufgewachsene Menschen stehen wir nicht begreifend vor den Steinmetzarbeiten, die hier überall in den Wiesen zu finden sind und noch mehr vor dem Faktum, daß die meisten der Arbeiten hier nur als Übungs- oder Lehrstücke ausgeführt wurden. In einer Phase der religiösen Architektur, in der die Bauherren von Holz- zu Steinbauten übergingen.
Die Wurzeln des südindischen Drawida-Stils (Zitate aus A. Volwahsen - INDIEN I) gehen bis ins 7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung zurück.Im Pallava-Reich, an der Südspitze des Subkontinents begann König Mahendravarman I., im Tempelbau steinerner Säulen zu verwenden. Sein Sohn, Narasimhavarman I. lernte bei der Eroberung des Chalukya-Reiches die ersten steinernen Tempel kennen. In seine Residenz in Kanchipuram zurückgekehrt, beschloß er, die neue Technik ebenfalls anzuwenden, und auch in seinem Reich den Chalukyas ebenbürtige Tempel zu errichten. Als Bauplatz wählte er Mahabhallipuram, vielleicht wegen der dort so reichlich vorhandenen Granitrücken. In einer Art Wettbewerb ließ er seine Architekten mit Handwerkern aus dem unterworfenen Chalukya-Reich wetteifern. Präzise Form und Maßstab schienen bei diesem architektonischen Experiment im Hintergrund zu stehen, denn viele der Details an den Tempelchen sind den Gegebenheiten der Felsen angepaßt. Die Formen orientierten sich vorwiegend an Holz- Bambus und Schilfbauten - tragbaren Holzschreinen und buddhistischen Klosteranlagen. Ob diese Modelltempel nach ihrer (nie erfolgten) Fertigstellung auch geweiht und benützt werden sollten, ist ungewiß. Die krönenden Schlußsteine, die erst bei der Weihe eines Hindutempels im Scheitelpunkt der Kuppel versetzt werden, stehen bis heute fertig bearbeitet neben den Schreinen.
Lassen die Nachbildungen von strohgedeckten Schreindächern und buddhistischer Tonnengewölbe die überkommenen Formen unnötig plump erscheinen und zeigten den Architekten die ungeheuren technologischen Probleme bei einem Bauvorhaben im erträumten Maßstab, war die im "Dharmaraja-Ratha" gefundene Form ideal für die Vorstellungswelt der Hindus. Die pyramidenförmige Ausbildung entspricht dem Weltberg Meru, der im hinduistischen Kosmos das Zentrum allen Seins bildet. Schon vor mehr als 12 Jahrhunderten begannen die Hindu-Architekten, ihre magischen Diagramme, die Mandalas in Bauwerke zu übersetzen. Alle architektonischen Details strahlen vom zentralen Kultraum, der in der Pyramide verborgen bleibt aus, alle formalen Ornamente ordnen sich den kosmologischen Schemata unter, die von der Ordnung im Kosmos erzählen.
Bis nach der Jahrtausendwende blieb das Grundschema der kosmischen Pyramide in Kraft und gab Wunderwerken wie dem Brihadeeshvara-Schrein in Tanjavore ihre Form. Dann vollzog sich eine eigenartige und bis heute nicht verstandene Wandlung. Die zentralen Pyramiden, die das Allerheiligste bergen, wurden kleiner und kleiner , bis sie im Gewirr der um sie errichteten Ringmauern, Tortürme und Wandelhallen kaum mehr auszunehmen sind. Vielleicht hängt das mit uns nicht bekannten Veränderungen in den Riten zusammen, mit denen die Anhänger des Gottes Shiva seine unzähligen Erscheinungsformen verehren.
Nicht nur in Strandnähe sind die aus dem gewachsenen Fels gearbeiteten Tempel und Skulpturen zu sehen, auch in den landeinwärts liegenden Wasserreisfeldern sind sie überall verstreut. Der junge Reis ist gut kniehoch und von einem Grün, das fast in den Augen schmerzt. Die einzelnen Felder sind durch kleine Lehmdeiche getrennt, auf denen man sich auch durch die Felder wandern kann, wenn man sich traut. Immer wieder Teiche mit braunem Wasser zwischen den Felder, im Wasser dösende Büffel, von braunen Menschen bewacht, die unbehelligt von unserem Zeitbegriff, wie Statuen auf Felsen sitzen und ihren Büffeln zusehen, wie sie sich suhlen.
Nach einem vegetarischen Mittagessen geben wir der Versuchung des "Governement Resthouse" nach und dürfen nach 5/= Rupees Eintritt zum Swimmingpool, unter einem Sonnenschirm sitzen und den Strand betrachten. Offenbar spielt hier der bengalische Golf manchmal verrückt, denn 5 Pavillons des Resthouses sind so unterspült, daß sie am Zerfallen sind. Aus ähnlichen Gründen dürfte die betonverstärkte Uferbefestigung rund um den Strandtempel gebaut werden. Der Name des Ortes läßt vermuten, daß es einst sieben Tempel waren, heute sind davon nur noch zwei zu finden. Im Zeitalter des Massentourismus und der finanzkräftigen Touristen ist die Erhaltung der Wahrzeichen Mahabhallipurams sogar dem finanzschwachen Tamil Nadu einen Bagger wert.
In einem längeren Gespräch mit dem Manager des örtlichen Fremdenverkehrsbüros versuchen wir herauszubekommen, wann Autobusse in Richtung Kanchipuram abgehen. Nach Überwindung seiner Enttäuschung, daß wir uns wirklich nur für Autobusse interessieren und nicht für die Möglichkeiten, uns durch ihn ein Alcohol-Permit verschaffen zu lassen, können wir doch noch Informationen über die Busse bekommen. Tamil Nadu ist einer der "trockenen" Bundesstaaten der Indischen Union. Alkohol bekommt man hier nur als Tourist über die Büros oder mit ärztlicher Verschreibung. Die Enttäuschung ist verständlich; er hatte sicher gehofft, sich ein kleines Nebengeschäft verschaffen zu können und so sein Gehalt von 400/= Rupees im Monat aufzubessern. Von diesem Gehalt muß er seine Familie mit zwei Kindern und seine Eltern erhalten - sagt er.
In einem Lokal kann man sich um 3 Rupees satt essen. Andererseits kostet ein Liter Reis 15/= Rupees. Alle bisherigen Versuche, Anhaltspunkte über den Lebensstandard zu erfragen scheitern an Kommunikationsproblemen und dem variablen Touristenzuschlag, der immer im Spiel ist, wenn wir etwas kaufen.
ist wie das Ramayana eine der ältesten Dichtungen unserer Welt und in ganz Südostasien verbreitet. Das beginnt bei indischen Comic-Strips und endet möglicherweise beim javanischen Wayang Orang.
Als Mahabharata schon vor über 2000 Jahren erwähnt, wurde das Epos etwa im 4. Jahrhundert in seiner heute überlieferten Form aufgezeichnet. Den historischen Hintergrund bilden die vernichtenden Kämpfe um die Vormachtstellung zwischen zwei Zweigen der indischen Bharata-Dynastie etwa im 9. Jahrhundert v.d.Z.
Die Kauravas sind die Nachkommen des blinden Königs Dhastarashtra. Dieser übergab jedoch die Regierungsgewalt seinem Bruder Pandu. Dessen Söhnen - Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula und Sadeva kommt die legale und sittliche Priorität zu, da ihr Vater zum Thronfolger ernannt wurde. Die Kauravas bestreiten diese Priorität und so kommt es zum Kampf um die Macht, an dem der sechste Sohn Pandus (gezeugt vom Sonnengott Surya), nichts von seiner Abstammung wissend auf der Seite der Kauravas teilnimmt.
Die wichtigsten Etappen der Handlung sind
Die Brautwerbung Arjunas, durch die er den König Drupada zum Verbündeten gewinnt; er heiratet Sumbadra, eine Schwester Krishnas.
So in ihrer Position geschwächt, greifen die Kauravas zu einer List und verführen Yudistira zum Spiel, in dem er sein Reich, seine Freiheit und die seiner Brüder verliert.
Es folgen zwölf Jahre Exil und ein Jahr als Diener des Königs Virata. Damit sind die Bedingungen der Spielschuld erfüllt, doch die Kauravas wollen ihr Machtposition nicht aus der Hand geben.
Nach Beratung mit Krshna entscheiden sich die Pandavas für den offenen Krieg, den sie nach 18 Tagen der Schlacht gewinnen. Yudistira wird König, das Gute hat gesiegt.
Die Beratung Arjunas mit Krishna - der hier vordergründig als Wagenlenker auftritt, sich jedoch im Verlauf des Gesprächs zuerst als Krishna offenbart, transzendent aber als Inkarnation Vishnus klar erkennbar ist - wird in der Bhagavadgita, einem der anmutigsten und tiefreligiösen Gedichte Indiens geschildert.
Wie auch das Ramayana ist die Mahabharata ein vielschichtiges Werk, in dessen vordergründigem Gesellschafts- und Schlachtgetümmel religiöse Botschaften und die Legitimierung des Königtums auf göttlicher Basis verborgen ist. Beide Dichtungen sind im ganzen hinterindischen Raum weit verbreitet und Basis vieler Theateraufführungen und plastischen Schmucks an Profan- und Kultbauten.
Der große Schwarze, tib. Nag po chen
po; in der tibetisch-tantrischen Mythologie existieren 75 verschiedene Erscheinungsformen
des Mahakala, die sich alle auf die hinduistische Gottheit Shiva zurückführen
lassen.
In Thangka-Motiven erscheint Mahakala imemr als Patron der Wissenschaften
und Bechützer des Zeltes.
Wandmalerei aus dem Kloster Hemis
liegt im Weinviertel, ander
Straße, die in weiterer Folge nach Prag führen
kann. Kurz oberhalb der Parabolica, die über dem Ort den Berg erklimmt,
kann man eine der besten Spezialitätengärtnereien Ostösterreichs
besuchen, von Hr. Ing. Maly begründet, wo das Herz des Sukkulenten-, Bromelien-
und Orchideenfreundes nicht nur einen Spung tun kann.
1999 - seit geraumer Zeit in andere Hände übergegangen, obwohl Maly
noch immer hin und weider sein Wesen dort treibt, hat sich der Erbauungswert
für Pflanzenfreaks leider gemindert.
ist ein merkwürdiges Produkt überwundenen Kolonialismus. Die kleinen Fürstentümer der malayischen Halbinsel südlich von Thailand etablierten sich nach dem 2. Weltkrieg in einer merkwürdigen Mischung aus Feudalismus, Föderalismus und Kapitalismus neu.
Hatten die Briten nach der Kapitulation der japanischen Besatzungsmächte noch geglaubt, sie könnten wie gehabt in ihre alten Kolonien zurückkehren, hatten sie sich geschnitten. Die neuen Herrscher schafften es binnen weniger Jahrzehnte, das einst rückständige Agrarland, das nur Gummiplantagen und Zinnminen zu bieten hatte, zu einer modernen Industrienation zu machen.
So kann man im ausgehenden 20. Jahrhundert im Norden noch immer endlos scheinenden Djungel erleben, während weiter im Süden Kuala Lumpur den höchsten Wolkenkratzer der Welt baut.
Den östlichen Teil Malaysias, das einen Teil der Insel Borneo sein eigen nennt, hab ich auf meine Liste gestellt. Dort gibts den ältesten Regenwald dieser Erde - ich kann nur hoffen, daß er noch nicht zu japanischen Zahnstochern verarbeitet wurde, bis ich einmal dort hinkomme.
Baba
Nyonya
Butterworth
Fraser
Hill
Kota Bahru
Kuala
Lumpur
Melakka
Nennen die Cubaner die Straßen, die an der Meeresfront von Küstenstädten angelegt sind.
Der Malecon von Habana war einst ein prachtvoller Straßenzug, auf dem sicher so was wie ein Corso der Schönen, Reichen und Berühmten paradierte. Heute sind die meisten Häuser bis zur Unkenntlichkeit verwittert - allerdings wird wieder aufgebaut und renoviert.
heißt die Mariahilferstraße von Solo. Außer einer fast unübersehbaren Auswahl an allen Dingen des täglichen Lebens gibts dort noch kilometerlang unter Arkaden stehende Standeln, die außer den vorstellbaren noch einige hundert unvorstellbare Arten Touristenkitsch anbieten. Abends öffnen unter den Arkaden dutzende tragbare Restaurants, die Konditoreien bieten verwirrende Vielfalt an Naschereien, die Märkte Obst und Gemüse, das Touristenamt Busfahrten zum Borobudur und aufs Dieng-Plateau.
ist, wenn zum Beispiel zwei
Autos zusammenfahren.
Fritz hat uns das in Sta. Elena
relativ genau erklärt, wie das mit dem Malör ist. Haftpflichtversicherungen
und andere Zivilisationskrankheiten sind in Venezuela
unbekannt - wer auf sein Auto aufpasst, wird es versichern, wer auf seine Gesundheit
heikel ist, wird diese versichern.
Die Gesundheitsversorgung ist zwar landesweit gratis, aber man kann natürlich alles versichern.
hieß unser Fahrer in Kamerun. Eigentlich hieß er El-Hadji Mamoudou Bouba, ein erfolgreicher Commerciant, der nicht nur zwei Frauen mit fast einem Dutzend Kinder hatte, sondern auf sehr unauffällige Weise sehr gute Geschäfte machte. In der Touristensaison fährt er mit Kleingruppen mit seinem Peugot über die grauenhaften Naturstraßen des Nordens, in den Nebensaisonen - oder wenn sich eine Gelegenheit ergibt, reist er illegal nach New York zu Freunden, Bekannten oder Verwandten (so genau war das nicht herauszufinden) und arbeitet dort einige Wochen schwarz als Taxifahrer. Mit dem so verdienten Geld importiert er unter anderen japanisches Elektronik-Gerümpel und war sogar schon in Japan als erfolgreicher Distributor.
Die Reisen in die USA werden auf ganz gefinkelte Weise durchgeführt. Da die Devisenbestimmungen in Kamerun restriktiv sind, reist man illegal nach Nigeria; hier gibt es genug Beamte, die gegen einen entsprechenden Bakschisch Arbeitsgenehmigungen ausstellen. Mit dieser kriegt man dann ein Touristenvisum in die USA, außerdem sind aus Lagos die Flüge billiger. Mit dem Touristenvisum gehts nach New York, wo die lokalen Freunde für einen Job als Taxifahrer oder sonst was sorgen. Mit irgendwas muß sich der Mensch ja über Wasser halten.
Da könnte sich unsereins schon ein Vorbild nehmen an Initiative und Tüchtigkeit.
liegt an der Bahnstrecke, die von Madurai nach Rameeshwaram an der Küste des bengalischen Golfes führt. Ich lernte nur den Bahnhof kennen - auf dem Rückweg von Rameeshwaram - als sintflutartige Regenfälle alle Straßen und Bahnlinien zu blockieren drohten und wir mehrere Stunden warten mußten und uns überlegten, ob wir nun überhaupt weiterfahren könnten, die Route ändern oder gar nichts tun sollten.
Es ist ganz erstaunlich wie gut man auf einer harten Eisenbahnbank schlafen kann, wenn die Müdigkeit groß genug wird.
Mandala
der Begriff
begegnet einem so häufig in so vielfältiger Form in Kunst und Alltag
Asiens, daß eine genauere Erläuterung am Platze scheint.
Das Wort Mandala leitet sich vom Sanskritwort für Kreis ab und bezeichnet, zunächst im alleinigen Sinn der Form, eine geometrische Figur, die mit Hilfe von Kreis und Quadrat konstruiert, nach außen mit einem Ring abgeschlossen und in sich abgeschlossen wird. Der indische Philosoph Saraha aus dem 7. Jahrhundert definiert das Mandala durch Zerlegen des Wortes in manda- und -la in bezug auf dessen psychologische Implikationen für den Meditierenden mit folgenden Worten: "Manda bedeutet 'Essenz'; la bedeutet 'diese ergreifen' somit bedeutet Mandala das Ergreifen der Essenz, insoferne als das Mandala in vollkommen reiner Form ein Mandala ist, weil umschlossen im Kreis des Weisheitswissens; oder: das Mandala mit dem Herrn in der Mitte ist ein Mandala, weil der Herr der Familie umringt ist von seinem Gefolge. Zu diesen Zwecken kann man je nachdem (d.h. der Zentralgottheit im Mandala) zahlreiche und wenige Aspekte, Formen und Farben haben.
Das Mandala, spätestens seit C.G.Jungs Auseinandersetzung mit seinen formalen Elementen und seiner Symbolik sowie der Formulierung seiner epochemachenden Archetypenlehre auch im Westen bekannt geworden ist, als weltweit in allen Kulturbereichen auftauchendes psychokosmisches Symbol, steckt eine sakrale, rituell von jeder Unreinheit befreite Fläche an, die nach außen durch einen Ring vor dem gewaltsamen Eindringen profaner Kräfte geschützt ist. ...
Die Symbolkraft schöpft das Mandala indessen nicht allein aus seiner Funktion als Meditations- und Initiationshilfe, die in gleichem Maße auch bildlichen Darstellungen von Gottheiten innewohnt. Erst aufgrund seiner Grundstruktur, die ähnlich einer Landkarte des Kosmos in seinem steten Prozeß des Werdens und Vergehens, des Aggregierens und Desaggregierens widerspiegelt, erlangt es die Dimension eines unergründlichen Mysteriums, in dem sich die menschliche Psyche, der Mikrokosmos, und das Weltgeschehen, der Makrokosmos, im AUgenblick einer höchsten Bewußtwerdung beim symbolischen Eindringen ins Mandalazentrum berühren und ein harmonischen Ineinandergreifen erfahren. Denn dieses Zentrum ist zugleich der innerste Kern der Psyche und die axis mundi, die Himmelssphären, Welt und Unterwelten miteinander verbindet, ein Ruhepol also, um den sich der Mikro- und der Makrokosmos in Ewigkeit drehen. ...
In bezug auf die Verwendung des Mandalas bei Meditationsübungen und Initiationsriten werden vier Typen von Mandala unterschieden, von denen die beider ersten als bildliche Darstellungen in unseren Interessenkreis fallen: es sind Mandalas, die mit Farbstaub auf den Boden gemalt werden; Mandalas auf Leinwänden(Thangkas); Mandalas, die meditativ geschaut werden und schließlich Mandalas im Körper, die für das Yoga von Belang sind....
In seiner Grundform setzt sich das Mandala aus einem in vier gleichschenklige Dreiecke unterteilten Quadrat und mehrere es umschließende konzentrischen Kreisringen zusammen. Die einzelnen Strukturelemente von außen nach innen sind:
äußerste Kreisumrandung - der Feuerkranz oder Feuerberg in den fünf Regenbogenfarben symbolisiert das höchste Bewußtsein, in dem der Initiand bei Anbeginn der Meditation seine Unwissenheit verbrennt, und das mit seinem Licht die Dunkelheit seines Irrtums vertreibt, um ihm den Weg zur Transzendenten Weisheit freizulegen. Dieser Feuerberg, der gegen außen als unbegrenzt zu denken ist, übernimmt also nicht, wie oft irrtümlich angenommen wird, eine verteidigende Funktion als Schutzwall gegen unbefugtes Eindringen fremder Kräfte.
die zweite Kreisumrandung: ein schmaler, meist indigoblauer oder schwarzbrauner Ring, in den mit Silber- oder Goldfarbe ein Gürtel von fünf- oder dreistegigen Diamantzeptern oder Diamantzepterkreuzen eingezeichnet ist, setzt als undurchdringliche Mauer die Grenzen der äußeren Welt.
die dritte Kreisumrandung - meist nur bei Mandalas von zornvollen Gottheiten: der Kreis der acht Leichenäcker Indiens, in den sich die Tantriker wie Padmasambhava u.a. zur Meditation zurückzuziehen pflegen, weist die acht Kartuschen in den vier Haupt- und vier Nebenhimmelsrichtungen auf, die Friedhofsszenen darstellen und je einen eigenen Fluß, Baum, Reliquienturm und menschliche Gebeine aufweisen. Diese Äcker symbolisieren die acht Bewußtseinsarten, die den Menschen an den leidvollen Geburtenkreislauf binden und zur Erlangung eines höheren Bewußtseins überwunden und zurückgelassen werden müssen; die fünf Sinne, das Denken, das Bewußtsein und das 'Schatzkammerbewußtsein'.
die vierte Kreisumrandung: ein Lotoskranz versinnbildlicht im Anschluß an die Überwindung der acht Bewußtseinsarten die geistige Wiedergeburt des Initianden auf einer höheren Erkenntnisstufe sowie das sich nach außen entfaltende Bewußtsein.
im inneren Kreislauf figuriert nun das eigentliche Mandala in der Form eine Diamantzepterkreuzes, dessen Spitzen aus einem Quadrat durch vier Tore angedeutet ist. Das Quadrat wird in Anlehnung an die altiranischen Königspaläste als architektonische Spiegelung der himmlischen Sphären angesehen. Das Zentrum des Quadrats am Schnittpunkt der Diagonalen enthält die wichtigste Schutzgottheit des Mandalas. Die vier Ecken des Quadrates veranschaulichen bildhaft die harmonische Gleichmäßigkeit der Welt und seine vier Abgrenzungslinien die sog. Unermeßlichkeit des Yogins, nämlich Güte, Mitleid, Freudigkeit und Gleichmut.
Die weiteren Details uns symbolischen Bedeutungen sind in diesem Rahmen leider nicht darzulegen.
(vereinfacht nach Thangkas
- Rollbilder aus dem Himalaya; Kunst und mystische Bedeutung
Alexandra Lavizzari - verlegt bei Raeuber DuMont 150)
1985 - Noch mehr als in Rangoon komme ich mir in Indien vor. Alle Menschen tragen Sarongs, nur Militär und Beamte scheinen westlich geschnittene Kleidung zu tragen. Müde und verschwitzt wanken wir aus dem Bahnhof und über einen Fußgängersteg in die Stadt, unserem Führer nach, der ein Hotel weiß.
Das Hotel ist ein einstöckiger Holzbau - wie die meisten Gebäuder in Mandalay, von einem kleinen Garten umgeben, der mit allerlei Gartenmöbel und Gerümpel vollgeräumt ist. Viele Touristen werden wohl nicht hierher verschlagen, denn unsere Karavane erweckt einiges Interesse bei den Passanten. Unser Führer verhandelt mit der Hotelbesitzerin, ich bin einfach zu müde, um mich zu interessieren, was da verhandelt wird. Es sit ein guter Tag, alle kriegen wir Unterkünfte in diesem Hotel - Zimmer kann man sie nicht so ohneweiteres nennen. Es sind mit Sperrholz abgetrennte Verschläge, die das Innenleben des Hauses in verwinkelte Wohnhöhlen verwandeln. Aber mit Moskitonetz und Ventilator.
Immerhin, es gibt im Hof eine Ecke, in der alles zu finden ist, was mit Wasser zu tun hat - Waschküche, Klos und Duschen. Erstaunlich, wie das die Lebensgeister wieder erweckt.
Mittagessen beim Chinesen, das stärkt deren Aktivität noch mehr.
Schräg gegenüber dem Hotel bietet ein Schild Fahrräder zur Vermietung an. Kaum durchs Tor gekommen, sind wir mit einem vifen jungen Mann im Gespräch, der nicht nur seine Drahtesel vermieten, sondern darüberhinaus Geschäfte jeder Art machen will. Stolz zeigt er uns ein Regal mit angebrochenen Kosmetikas westlicher Provenienz, die er hier zum Wiederverkauf ausgestellt hat. Und er selbst trägt natürlich eines der thailandischen (gefälschten) Lacoste-Leiberln, keines der einheimischen Hemden. Über all dem Handeln, wie viel Geld und/oder Lippenstifte wir für die Fahrradmiete zu berappen haben, verlieren wir die anderen und fahren anschließend allein zum Mandalay Hill.
Der Hügel, der die Stadt überragt, wurde zum Berg Meru umgebaut, mit überdachten Aufgängen in den Himmelsrichtungen. An die 209 Tempel sind über den Hügel verstreut, alle durch Stiegen verbunden.
Vom Gipfel des Berges schweift der Blick weit in die Irrawaddy-Ebene. Obwohl die eigentliche Mosoon-Zeit schon vorüber ist, sind noch überall Überschwemmungen zu sehen, zwischen den Reisfelder am Fuße des Hügels stehen weiße Dagobas zwischen Palmen.
Nach dem Abstieg nach Süden treffen wir den größten Teil unserer Reisegruppe wieder. Da es schon dunkel wird und bedrohliche Regenwolken heranziehen, wollen wir mit einem Pferdewagen in die Stadt zurückfahren. Das erweist sich als schwer durchführbares Unternehmen; nachdem schon einige in der Kutsche sitzen, wird die etwas fülliger Edith mit einem Steig ein Mausl ermuntert, worauf das Gefährt zu kippen droht und fast das Pferd in die Luft hebt. Also fahren die Restlichen mit den hier üblichen Beiwagenfahrradrikschas.
Auf den Weg in die Stadt bricht das Gewitter mit aller Macht los. Der Rikschafahrer verpackt uns so gut es geht, in die Plastikplanen, die er mit hat, aber das schützt nur vor dem Regen, nicht davor, klatschnass zu werden. Gewitter im Fahrradrikscha
Das Abendessen beim Chinesen konfroniert uns mit der klassischen indochinesischen Küche - rotgefärbte fette Schweinhaxen, an denen noch die Borsten herausstehen, ich habe in Erinnerung an Chieng Mai Frosch bestellt und schaue nicht schlecht, als ich einen Teller frittierte, kaum fingerlanger Frösche kriege. Natürlich hab ich sie gegessen (wäre doch gelacht, man denke an die Humboldt-Medaille).
Zur Herberge wieder zurückzufinden, war gar nicht so leicht; was heißt, ohne Visitenkarte, hätten wir es kaum geschafft.
"Wieder in einem Bett zu schlafen, mit Moskitonetz und Ventilator ist die reine Labsal"
Die anderen fahren um 5:30 mit Jeeps nach Maymyo, zu einem Markt. Die bisherigen Reibereien waren genug, wir fahren heute nicht mit der Masse mit. Ohropax heilt den Wirbel des Aufbruches.
Vor dem Hotel werden wir wieder angequatscht wegen Tauschen. Wir einigen uns : 2 Fahrräder für den ganzen Tag gegen 1 Lippenstift, leicht gebraucht, 1 Shampoo, angefangen. Außerdem 1 Feuerzeug 10 Kyat, 1 Kuli 3/-. Der Schwarzhändler hat eine ganze Galerie angebrochener Kosmetika, Parfüm, Leiberln, unglaublich.
Zum Mandaly Hill.
Überall lachen uns die Menschen an, vielleicht sehen sie selten Touristen auf Rädern, fahren die anderen alle mit Rikscha oder Tonga ?
In einem der vielen Tempel auf dem Mandalay-Hill können wir einer Geisterbeschwörung zusehen. Zur Musik eines Gamelan-Orchester tanzen vor einem Auditorium festtäglich gekeideter Menschen zwei junge Männer, geschminkt und wie Frauen angezogen. Immer wieder kosten sie Speisen und Getränke von den Tischen, ziehen an Zigaretten, die ihnen gereicht werden - offenbar, um die Kraft der Geister einzufangen und dann an die anderen Teilnehmer weiterzugeben.
Auch andere esotherische Künste kann man hier auf dem Tempelberg in Anspruch nehmen. Ein Spezialist für Handlesen nimmt es auf sich, aus unseren Handlinien Chancen und Gefahren der Zukunft zu lesen. Was er uns weissagte, hab ich vergessen - und damit nicht aufgeschrieben - es war auf jeden Fall interessant und vielversprechend.
Der Versuch, ein Mittagessen zu ergattern, bleibt vorerst erfolglos. Der Wirt einer Budenküche unter einem weitausladenden Baum werkt zwar energisch vor sich hin, aber alle Versuche, ihn auf eine Mahlzeit anzusprechen, werden nicht einmal ignoriert. Schließlich erbarmt sich dann doch andernorts eine Frau.
Das Leben auf dem Land kann man hier noch beobachten, sofern mansich der Muße der Betrachtung hingibt und unsre tief eingepflanzte Ungeduld aufgibt. Der meiste Verkehr wird nach wie vor mit Ochsenkarren mit riesigen Rädern abgewickelt, es sind aber auch einige brititsche Militärlastwagen unterwegs, die aussehen, als ob sie noch vom letzten Krieg übergeblieben wären. Die Zeitlosigkeit, die all die Menschen hier ausstrahlen, ist für uns völlig ungewohnt. Wir Touristen werden noch immer mit Interesse betrachtet, nicht aufdringlich, aber mit Muße, minutenlang.
Ein wenig außerhalb Mandalays,
in Sichtweite des Tempelberges stehen blendendweiß gekalkte Anlagen, die
im Inneren einer Umfassungsmauer regelrechte Pagodenwälder enthalten; in
Reih und Glied errichtete kleine Dagobas, die sich um eine
zentrale Dagoba gruppieren. Jede ist hohl und birgt eine gravierte Marmortafel,
auf der der Pali-Kanon aufgezeichnet ist, die Überlieferungen der Predigten
und Weisheiten des historischen Buddha Shakyamuni.
Diese Aufzeichnungen sind die Ergebnisse buddhistischer Konzile, die nach der
Reinheit der Überlieferungen trachteten und die jeweils endgültige
Version der heiligen Schriften fast unzerstörbar niederlegten.
Abends, nach 19:00 fahren wir alle mit einem kleinen Bus zur Anlagestelle der Irrawaddy-Boote. Erich, so präpotent und überheblich er auch ist, hat das alles bestens organisiert.
In schwärzester Nacht blizeln Glühstrumpflampen aus dem hölzernen Bauch eines riesenhaft erscheinenden Schiffes. Wie groß es wirklich war, kann ich nicht sagen, in dieser Finsternis erschien es wie eine riesige hölzerne Höhle, in der sich eine unabsehbare Menge brauner Menschen regte.Sitzend, schlafend, Körbe transportierend, gestikulierend, neugierig uns betrachtend ... Nach drei oder vier dieser Holhöhlen erreichten wir schließlich die Fähre, die uns flußabwärts, nach Pagan bringen sollte.
Mandalay 2
Die Stadt, die ich von 1985 in Erinnerung hatte, war natürlich 1995 nicht mehr vorhanden. Vielleicht hat sich Mandalay so stark verändert, vielleicht ist meine Erinnerung lückenhaft und idealisierend, wahrscheinlich ist das ein Effekt, den man heute in der ganzen Welt erwarten muß - ich erlebte im wesentlichen den gleichen Effekt auch in Sri Lanka und Phuket.
In den 90er Jahren ist Mandalay das eigentliche Zentrum von Myanmar, Yangon gibt sich zwar als weltoffene Stadt und Regierungssitz, aber die wahren Geschäfte, legale wie illegale werden hier im Mandalay abgeschlossen.
Außer einem desillusionierenden Besuch auf dem Mandalay Hill, einigen Sitzungen in einem chinesischen Restaurant, Ausflügen nach Mingun zur berühmten Pagode und zu einem nahegelegenen berühmten Kloster sind nur noch die Erzeugung von Bambuspapier und der Besuch bei der Blattgoldproduktion zu erwähnen.
Bei Tag ist die Stadt laut und mit Autoabgasen erfüllt, bei Nacht so schwach beleuchtet, daß man nicht sehen kann, wohin man geht.
Mandalay Hill
1995 - kurz zusammengefaßt : Wie man einen heiligen Ort ruinieren kann.
War der Hill vor 10 Jahren
noch eine beschauliche und meditative Stätte, wo man den heiligen Schauer,
der die Buddhisten Burmas umweht, auch als Tourist empfinden konnte, hat sich
in diesem Zeitraum zum Erbrechen viel geändert.
Die vielen Nebenschreine - an einem konnten wir 1985 stundenlang einem Geistertanz
zusehen - sind verlassen und unbeachtet, wenn auch restauriert, die Standeln
verkaufen viel Plastikschrott und Spielzeug. Es gibt zwar überall Getränke
zu kaufen, aber die heilige Beschaulichkeit ist gelangweiltem Kommerz gewichen.
Die große Anlage am Fuß des Hügels, in der das Tripitaka
aus Marmor untergebracht ist, ist auch bis zur Unkenntlichkeit verändert;
alles mit dicken Eisenstangen vergittert. Wahrscheinlich wollten zu viele Menschen
ein Andenken mitnehmen ...
Am Gipfel in keinem der vier Schreine auch nur eine Möglichkeit, gekaufte Blumen in eine Vase zu stellen, Kerzen oder Räucherstäbchen anzuzünden. Alles verkachelt und mit kitschigen Spiegeln ausgestattet, dazu Plastikblumen und Neonröhren.
Dafür gibts eine Terrasse mit besonderen Stühlen, wo der Tourist den Sonnenuntergang hinter dem Ayeyarwady - der beeindruckend war - zu betrachten. Fehlt nur noch der Kellner, der einen Cocktail serviert; aber das wird auch noch kommen.
Damit die Touristen ihre Gehwarzen
ja nicht anstrengen müssen, wurde eine Straße auf der Nordseite den
Berg hinaufgebaut, der auf einem von Andenkenläden und Freßbuden
gesäumten Parkplatz endet. Die letzten 30 Höhenmeter muß man
mittlerweile auch nicht mehr über Treppen erklimmen, es wurde ein riesiger
Betonturm mit Rolltreppen errichtet - neonbeleuchtet, wie in einem Warenhaus.
Gebaut haben den Zwangsarbeiter, Häftlinge, die hierher verschickt wurden,
um zu arbeiten.
Wenn man da nicht einen klugen Guide hat, erfährt man
solche Sachen nicht und denkt sich nichts dabei, daß die Bauarbeiter,
die hier beschäftigt sind, alle ungewöhnliche weiße Lunghis
anhaben. Gerade das ist das Zeichen, daß es Zwangsarbeiter sind.
AM Fuß des Hill hat ein französisches Unternehmen ein Tourotel hingestellt, damit man ja sieht, daß die neue Zeit angebrochen ist.
Als wir auf der Suche nach dem Autobus nach Kanniyakumari warten, riet uns ein netter Mensch, daß wir uns eine andere Variante überlegen sollten: die Regenfälle der letzten Tage haben derartige Überschwemmungen verursacht, daß die Küstenstraßen mindestens 2 Wochen außer Betrieb sein würden.
Zum ersten Mal sind wir über die langen Aufenthalte der Züge nicht ungehalten, wir können ohne Probleme Tickets kaufen und wieder in den Zug nach Madurai klettern. Die Route durchs Land ist die einzige, die uns jetzt noch offenbleibt. Von Madurai weiter nach Quilon, dort in die Schmalspurbahn umsteigen und weiter nach Trivandrum. Schließlich wollen wir den Flieger zurück nach Colombo nicht versäumen, sonst würde die Heimreise ernsthaft kompliziert.
Die Regenfälle und Überschwemmungen haben offenbar auch den Bahnverkehr beeinträchtigt. In einer kleinen, namenlosen Station mußten wir geschlagene fünfviertel Stunden warten, bis der erwartete Gegenzug passiert hatte. Zu guter Letzt zockeln wir doch noch in der Station von Madurai ein - 4 Stunden für eine Strecke von 35 Kilometer. Der Abendzug nach Quilon ist in allen reservierbaren Klassen bis zur Warteliste voll belegt, aber was will Gott ? Unser Bekannter, der schnurrbärtige Tourist-Officer, taucht auf und verspricht, alles zu managen; gegen eine kleine Erschwerniszulage natürlich.
heißt baden oder waschen und benennt auch das wichtigste Utensil, das man dafür in einem Losmén braucht, das gemauerte, oft auch gekachelte Becken, in dem der Wasservorrat für die Pritschlerei untergebracht ist. Das Becken ist ein Reservoir, KEINE Badewanne - auf keinen Fall darf man dort untertauchen (oder sich erwischen lassen). Meist stehen auf dem Rand des Mandis zwei Kunststoffschöpfer in schreienden Farben, einer zum Übergießen, der andere zur Bedienung des Zielscheibenklos und für Menschen, die nicht an Klopapier glauben.
es ist schon erstaunlich, wenn man durch eine Stadt fährt, die so eng mit dem eigenen Vornamen verbunden ist.
Sonst kann ich von der recht großen Stadt an der südlichen Adria nichts viel berichten. Weit hingestreckt liegt sie wie der Traum eines baukastenbesessenen Kindes an einer geschwungenen Bucht, eine Betonksite neben der anderen. Und mit unzähligen Autoreparaturwerkstätten an der Peripherie, wo schwarzlockige Süditaliener in ebenso ölschwarzen Overalls am Straßenrand diverses Autogerümpel reparierten.
Das war nach meiner ersten Reise nach Griechenland, als uns die Autofähre von Patras nach Brindisi ausgeladen hatte und ich mit meiner waidwunden Giulia eine seriöse Alfa Romeo Werkstätte suchte, um sie reparieren zu lassen. Verständlich, daß ich nicht viele Gedanken an unschöne Städte verschwendete.
Die Werkstätte fand ich dann in Térmoli, an der Nordseite des Gargano, des italienischen Sporns.
heißt der zweite Palast in Solo, wo der "Prinz" residiert. Irgendwie berührte uns die Situation, daß in einer so jungen Republik, die noch heute mit dem Aufbau eines Nationalbewußtseins sehr beschäftigt ist, so viele feudale Reste, noch dazu in lebendiger, persönlicher Form weiterleben.
Wie alle anderen Paläste ist auch der Mangkunegaran mit einer hohen, abweisenden Mauer umgeben. Nur ein großes Tor mit geschwungenem Dach führt ins Innere. Dort liegt, umgeben von Wirtschaftsgebäuden und einem weiten, gepflegten Garten der eigentliche Palast. Nur die offiziellen Gebäude sind zu besichtigen, im restlichen Teil liegt die Privatresidenz des Prinzen.
Wir bekommen eine junge Dame als Führerin zugeteilt, die ausgezeichnet Englisch spricht und dürfen in ihrer Begleitung die obligate Tanzhalle, die Empfangssalons und ein pompöses Speisezimmer besichtigen. In Glasvitrinen sind die gesammelten Orden der Familie, Speise- und Teeservices, alte Krise und die tolle Sammlung alter Tanzmasken ausgestellt. Durch ein offenes Fenster können wir sogar Einblick in die Privatwohnung des Herrn Prinzen nehmen. Wohnt nicht schlecht - in einer weitläufigen offenen Veranda stehen Schreibtisch und Sitzgarnitur, dazu ein schöner Garten, in dem nur einige silberbronzierte Statuen in einer Art Makart-Stil ein wenig deplaciert wirken. Ein wenig später treffen wir unverhofft auf den Prinzen selber, der mit einem Freund im Garten eine Kamera ausprobiert. Offenbar sind die alten Hierarchien noch immer lebendig, denn eine der Hausangestellten, die mit dem Prinzen spricht, geht devot in die Knie, so lange sie mit ihm spricht.
Als Prinz kann man leicht locker sein, eine tolle Autonummer hat er auch - AB9A - die Normalverbraucher müssen mit neun- und zehnstelligen Nummern durch die Gegend fahren.
ist der Kern von New York City, der Inbegriff der Stadt. We das nicht gesehen hat, kann sich das - trotz aller Medienwirksamheit - einfach nicht vorstellen.
Von den Straßenkreuzungen im Inneren Manhattans kann man in alle vier Himmelsrichtungen die Straßenschluchten entlangsehen, bis zum verschwimmenden Horizont, die Häuser werden kaum niedriger, die Fahrbahn verschwimmt in den Fluchtpunkten.
Man kann all das fotografieren, man kann versuchen, das gesehene zu beschreiben, wirklich fassen kann mein Verstand das nicht. Nach wenigen Tagen setzt sich die Kulisse im Kopf fest, das Erstaunen schwingt sich nicht mehr von Minute zu Minute, aber wirklich begreifen kann das keiner.
Manimauer
sind im tibetischen Kulturraum vielleicht so etwas wie füher bei uns ein Marterl; an wichtigen Wegstücken oder in Blickweite einer Ortschaft sind Natursteine zu niedrigen Mauern aufgeschichtet, oft auch weiß gekalkt und die frommen Wanderer legen nun auf diesen Mauern in Stein gravierte Gebete oder andere Memorabilien, etwa Steibockgehörne, nieder. Oft sind neben den Mani-Mauern auch Gebetsmühlen angebracht, damit man schnell ein paar tausend Om Mani Padma Hum in Bewegung setzen kann.
ist ein nicht sehr ansehnlicher Strauch, bis ca. 3 m hoch, mit gefiederten Blättern. Das wichtige sind seine Wurzelknollen, die in vielen Ländern des Tropengürtels eine wichtige Stärkequelle darstellen. Wie die Wurzel genau zubereitet wird, hab ich nie herausgefunden, das Endprodukt ist entweder ein geschmckloses Mehl, das gekocht, gebraten, gebacken usw. wird (Arepa) oder eine Art dicker Tapetenkleister, der in Blätter gewickelt und aufs Feuer gelegt wird. Dadurch geliert der Kleister und wird zu einer transparenten Masse, die bestenfalls nach Tapetenkleister schmeckt - jedenfalls stelle ich mir das so vor.
Aus Höflichkeit haben wir immer ein wenig gegessen, aber das muß man offenbar von Kind auf gewohnt sein oder echten Hunger haben.
sind die Fahrer aller javanischen Überlandbusse.
Als unser Bus bei der Rückfahrt vom Dieng-Plateau in einer engen Kurve einer Kollision mit einem bergwärts fahrenden LKW nur um Zentimeter entging, drehte sich der Meister des Lenkrades nur um und lachte seinem Beifahrer begeistert zu.
Die Rückfahrt nach Yogya wurde dann zu einem nächtlichen Rennen durch regenüberströmte Landstraßen und Wasserfontänen. Auch ein Tropenregen kann hierzulande einen Fahrer nicht dazu anhalten, langsamer zu fahren.
ist eine sehr ordentliche Stadt am Rhein. Dort sind die Straßen der Innenstadt mit Buchstaben bezeichnet, je nach Planquadrat, was mich sehr erstaunte, als ich zum ersten Mal davon erfuhr.
der große Steurmann des roten China war schon damals, als ich das Reich der Mitte bereiste 1984 zu einer Ikone erstarrt, die alle irgendwie verehrten, aber nicht mehr ernst nahmen.
So kann es großen Führern geschehen; er war, ist und wird nicht der einzige bleiben. Wie sagte Jahre Später Gorbi, noch auf dem Zenit seiner Macht und Popularität - "wer zu spät kommt, den bestraft die Geschichte...".
Wie es dann weiterging, düfte bekannt sein.
ist ein kleines Fischerdorf südlich von Kuala Terengganu, das gerade anfängt, am Tourismus Malaysias mitzunaschen. Schon gibt es Bootsfahrten, man kann sich Tauchgerät ausleihen und in den zwei Restaurant des Ortes kriegt man ordentliches Essen und Batikstoffe.
Obwohl ich schon einmal dort war, ist mir nichts von diesem Zentrum österreichischen Wallfahrens im Gedächtnis geblieben. Allerdings besitze ich eine ansehnliche Sammlung von Erinnerungsfotos lang verblichener Wallfahrer - erworben auf Flohmärkten - die die eindrucksvolle Basilika auf einem gemalten Hintergrundprospekt zeigen.
1991 - Heißt auch Marienbad. Auch dieses ehemalige Nobelbad der Monarchie (seltsam, daß wir immer an diese langvergangene Zeit denken und nie an die kurzlebige tschechoslovakische Republik) bemüht sich nun sehr, wieder den Anschluß an die einstige Größe und Berühmtheit zu finden. Schon sind die lukrativsten Hotels in den Renovierungszyklus eingebunden, hat der Staat die wunderschönen Brunnenkollonaden aus der Zeit der Gußeisengotik mustergültig renoviert.
Die Stadt selbst, nur einen Häuserblock von den schönen Hauptstraßen in die Tiefe, wird noch vom vergammelten Grau des seinerzeit existierenden Sozialismus beherrscht. Bis zu den noch immer verstaubten Geschäften und dem Koksschaufler, der einen Keller anfüllt.
Im 6. Wiener Bezirk wohnte ich einige Jahre, bis ich wieder nach Meidling zurückzog, um dann einige Jahre später in der Leopoldstadt zu landen.
Marienbad
wurde einmal durch einen avantgardistischen Film - "Letztes Jahr in Marienbad", von Alain Resnais - einigermaßen berühmt. Im Film kam nur einmal dieser Satz und nicht eine Szene aus dem Ort vor; was soll's, heute heißt die kleine Stadt Mariánské Lázne.
liegt am Ufer des Lago Izabal. Hier gingen einst die Reisenden, die nach Ciudad Guatemala wollten, nach einer Seereise an Land und mühten sich dann mit Maultieren weiter. Heute ist das nette Dorf ein verschlafenes Fleckchen Erde, das vermutlich nur zu Wochenenden und Feiertagen aufwacht, wenn Leute aus den großen Städten hierher kommen, um es sich gut gehen zu lassen.
Immerhin warteten wir geraume Zeit auf ein Mittagessen, es dauert eben, bis alles an einem Wochentag anläuft. Aber auf einer Terrasse mit Seeblick ist das nicht so schlimm.
Die Hügel rings um Mariscos sind mit ordentlichen Gummiplantagen bedeckt, auf denen sogar Orchideen wachsen.
gibts es überall - man muß nur die Augen offenhalten.
ist ein nicht sehr großes,
aber wohlhabendes Dorf im oberen Kali Kandaki Tal, etwa zwei Wegstunden unterhalb
von Jomsom.
Im Umkreis des Dorfes gibts es offenbar ganzjährig ausreichend Wasser,
sodaß nicht nur die Gerstenfelder, sondern auch Apfel- und Marillenplantagen
gedeihen.
Die Häuser sind schon ganz in der tibetischen Tradition errichtet, weißgekalkte
Außenmauern aus geschichteten Steinen, Flächdächer und so gut
wie keine Fenster. Die Gassen eng und schön mit Steinplatten gepflastert.
Immer wieder hört man es in Marpha gurgeln, wenn man durch die Gassen geht
- die diversen Bäche, die von den Bergen kommen,w erden durch das Dorf
auf die weiter unten liegenden Felder geleitet.
Eine Gompa gibt es auch, passabel renoviert, von lustlosen Mönchen, die
offenbar zu Tempelwächtern abglitten, aufgesperrt. Bei dem Mischmasch an
Religionen in Nepal, wo viele Menschen nicht genau angeben können, welcher
Konfession sie anhängen und dem Ansturm von Touristen in den letzten Jahrzehnten
kann sich religiöses Empfinden und Tradition einfach nicht mehr halten.
Das "einfache Volk" gleitet in rituellen Traditionalismus ab und die
in der Touristenbranche beschäftigen huldigen der Verehrung von Produktmarken...
wird in Kamerun oft die Königin des Nordens genannt, zu Recht, denn diese weitläufige Stadt am Südrande der Sahelzone vermittelt eine einmalige, ausgeglichene Stimmung, in der unsereins als eiliger Tourist ein wenig vom Hauch der Jahrhunderte riechen kann, die hier gemächlich vergingen.
Breite, von Akakzien beschattete Straßen, überall vom Sand überweht, fensterlose Häuserfronten, viele Gärten, auch wenn sie ein wenig spratanisch wirken mit ihrem spärlichen Gras und einigen hohen Bäumen; ein weitläufiger Bazar, in dem wir amüsiert betrachtet wurden und nicht wußten, was wir vom Angebot zu halten hatten, weil es so fremd war.
Maroua war der Ausgangspunkt unserer kleinen Rundreise durch den Norden Kameruns. Der Herr Vizeminister, der im reichgestickten Boubou schon in der VIP-Lounge im Yaoundé huldvoll um sich geblickt hatte, wurde in Maroua von lokalen Größen und einer heißen Musiktruppe begrüßt. Sogar irgendwelche pittoreske Wilde, die trommelnd und speerschütteln in Lendenschurzen vor dem Minister tanzten, hatten sie aufgetrieben. Und dazu jede Menge politische Anhänger, die die Konterfeis wichtiger Politiker auf ihren Kleidern und Hemden in Stoff gedruckt zur Schau stellten.
ist der Schauplatz vieler Science
Fiction Geschichten.
siehe utopisch
ist einer der vielen Staudämme,
die der Colorado River auf seinem Langen Weg in den Golf con Californien
hinter sich bringen muß. Der Abstecher von der US 8 nach Norden wurde
eigentlich durch die kryptische Eintragung Petrified
Forest auf der Straßenkarte ausgelöst.
Hinterher - am Lake angekommen - fragten wir einige Leute nach dem Petrified
Forest und sahen nur verständnislos hervorgewälzte Augen als Antwort
...
Die Fahrt zum Lake ist allerdings nicht uninteressant. Vorbei am Haupttor eines Army Camps (Yuma Proving Ground), das mit energisch erigierten Kanonen verziert ist, geht die Fahrt durch eine trostlose Wüste, die Straßenränder allerdings mitt allerlei launigen Bemerkungen verziert; Danger, Laser Wapons; Anhalten und Aussteigen strengstens verboten, an Fotografieren nicht einmal denken, überall wird vor Wachen gewarnt, die ohne Warnung schießen, ein Schild, das streng verbiete, das Camp mit Alkoholika, Marihuana oder pornografischem Material zu betreten, und einiges andere mehr.
Ist diese bizarre Strecke überwunden, taucht ein US-Idyll am Ufer des Stausees auf, das man nicht für möglich halten würde. Herden von gigantischen Wohnmobilen, mit Dusche und Satellitenantenne, Huckepackmotorrad und Zweitauto. Die Amis fahren hier übers Wochenende her, um sich dann in der Wüste zu benehmen, als wären sie zu Hause geblieben. Sie sitzen vor der Glotze und trinken Bier oder grillen mit ihren Nachbarn.
Der Vergleich mit den Wiener Kaffeehaus-Literaten drängt sich auf - nicht zu Hause und doch nicht an der frischen Luft.
dürfte es in Kolumbien häufig geben; in Tachira fanden wir keine, in Mérida auch nur an den Abhängen der Sierra Nevada.
dieses persisch-arabische Wort hat auch in die Bahasa Indonesia Eingang gefunden - es bedeutet Moschee.
In Zentraljava sind die vielen Moscheen nur an den kleinen Zwiebeltürmchen aus Zinkblech zu erkennen, die die sonst unauffälligen Häuser krönen. Natürlich flankiert von rostigen Lautsprechern, die die Muezzins bei ihren täglichen Singduellen unterstützen. Minaretts sind sehr selten, nur in Ostjava konnten wir einige im Vorbeifahren sehen. Vielleicht ist das auch eine Geldfrage.
In Malaysia ist der Islam offizielle Staatsreligion, was sich bei der Ansammlung von Sultanaten und Königreichen, in lokalen Übertreibungen auswirkt. Jeder Teilstaat muß natürlich eine eigene Staatsmoschee haben, in der dann der jeweilige Sultan als religiöses Oberhaupt an wichtigen Zeremonien teilnimmt. Die Übertreibungen finden auf architektonischem Gebiet statt und so haben nicht wenige der Sultanate Moscheen, durch die Exporte finanziert, die wie aus einer TV-Dekoration zu 1000 und 1 Nacht wirken.
Massa e Cozzile
Die Doppelortschaft liegt an den Hängen der Hügel oberhalb von Montecatini Terme in der Toskana.
Umgeben von Weingärten und Olivenhainen liegt dort der Sommersitz eines bekannten österreichischen Journalisten, der diverse zeitgeschichtliche TV-Serien herstellte und bis vor wenigen Jahren als (hautatmender) Kommentator auftrat.
In diese Gegend kommt man nur durch Zufall oder wenn man jemanden besucht, der in der Sommerzeit auf das Haus und Hund und Katz aufpaßt.
Das ehemalige Bauernhaus - in den 60er Jahren als Ruine sicher wohlfeil erworben - wurde schön renoviert und blickt vom Hügelhang der Apennin-Ausläufer in die Ebene des Arno hinab. Ringsum Olivenbäume, Weinstöcke, Wiesenblumen, Bambus und Pampasgras.
Hier kann man den Tag angenehm vertrödeln oder auch eine der umliegenden Städte besuchen, wie Montecatini, Vinci, Lucca, Pistoia, Pescia, Carrara oder sogar Florenz.
ist ein Provinzstadt in Sri Lanka, südlich von Colombo. Außer einer Provinzstadt ist dort im Werabena-Tempel der größte Buddha der Welt zu sehen, technolgisch beeindruckend, 39 Meter hoch und in Stahlebtonbauweise errichtet.
In den Gängen unter dem Tempelfundament ist die buddhistische Heilsgeschichte in Form eine Comic-Strips in Essig und Öl und 1000 und 1 Bild dargestellt. Dazu gibts dann auch noch Gips-Dioramen, die die Predigt im Hirschwald und andere wichtige Ereignisse im Leben Shakyamunis darstellen.
(Wan-li Chang Cheng) hieß die Große Chinesische Mauer bei ihren Erbauern. Im Verlauf meiner Reise durch die ehemalige Mitte der Welt sah ich dieses unbegreifliche Bauwerk an drei Stellen; an ihrem nordwestlichen Ende, in Yiayü Guan, einige hundert Kilometer weiter östlich (fast lächerlich nah, bei einer Gesamtlänge von 9.000 km) und dann beim Nan-kan-Paß nördlich von Peking, wo das Rennomierstück für die ausländischen Besucher renoviert wurde.
Die nördlichen und westlichen Teilstücke sind heute weitgehend zerfallen, kein Wunder, sind sie doch aus gestampftem Lehm gebaut und wurden seit Jahrhunderten nicht mehr gewartet. Nur die Bauphasen der Ming-Zeit (ca. 16. Jahrhundert) sind noch recht gut erhalten.
Im ersten Augenblick scheint die Idee, eine Mauer aus Lehm durch eine Landschaft zu ziehen, um damit marodierende Nomaden fernzuhalten, total hirnverbrannt zu sein. Stellt man sich jedoch die Art der Kriegführung dieser mongolischen Völkerscharen vor, ist das gar nicht so blöd. Mit ihren Pferden verwachsen, auf Pferde bei ihren Kriegszügen angewiesen, ist eine drei Meter hohe Lehmmauer ein beträchtliches Hindernis, das erst nach einigen Stunden Arbeit aufgebrochen ist. In dieser Zeit können die Wachmannschaften auf den vielen Wachttürmen Alarm geben, um so die Garnisonen an der Mauer zu alarmieren. Und gar so leicht ist so eine Lehmmauer, die in einer Wüste aus feuchtem Lehm mit Stroh- und Steinarmierung aufgebaut ist, gar nicht zu durchbrechen. Der Lehm wird in der Sonne hart wie Beton.

Weiter südlich wurden die Mauern von den Kaisern der Ming-Dynastie in großartiger Weise ausgebaut; wie ein unendlicher Drache schlingt sie sich durch die bergige Landschaft, hügelauf und hügelab. Bis zu Horizont läßt sich der Mauerschatten als blauer Faden auf den Bergrücken verfolgen. Dabei ist die Mauer massiv aus Steinen mit Ziegelbekrönung gebaut, so breit, daß ein Wagen auf der Krone fahren könnte, wären nicht die verrückten Steigungen, Biegungen und Verschlingungen und die vielen Türme.
Genützt hat sie leider nicht viel. Nicht einmal die parallelen Mauerzüge an neuralgischen Stellen - bis zu einem Dutzend hintereinander - konnten die Barbaren zurückhalten. Nicht daß die die Mauer so erfolgreich erstürmt, überstiegen oder zerstört hätten. Die bestachen einfach motivierbare Ortskommandanten und ritten durch die Tore.
einer der kleinen Orte in Myanmar, die
von den Briten in der Kolonialzeit als Hill Resort
eingerichtet wurden. Bis heute sind diese Ortschaften ein wenig so geblieben,
wie sie damals von den Landschaftsarchitekten eingerichtet wurden.
Gepflegter Rasen, wo immer es geht, auch entlang der Straßen, Häuser
in englischem Stil und Hotels, die aussehen, als wären sie aus Schottland
herübergebeamt worden.
Maymyo ist der Heimatort von David Nyan Win, der in Myanmar 1995 unser Guide war.
liegt südlich von Yaoundé und ist ein kleines Nest mitten im Wald. Hier beginnen die noch immer bemerkenswerten Reste von Regenwald, die Kamerun noch besitzt. Touristisch ist die Gegend nicht sehr bemerkenswert, allerdings könnte man von hier aus Pflanzen zu sammeln beginnen, wenn man einen Führer und/oder Beziehungen zu den großen Holzkonzernen hat, die versuchen, den Wald in Zahnstocher oder ähnlich wichtige Dinge zu verwandeln.
McDonalds
ist auch so ein atopischer Ort, der total verwechselbar geworden ist.
Ich kann ja noch - mit ein wenig Mühe - verstehen, daß die Moskauer Bürger 1990 bereit waren, Schwarzmarktpreise zu bezahlen, um auch einmal den so lange sagenhaft gewesenen Genuß eines amerikanischen Fleischlaberls kennenzulernen. Daß aber jemand in den USA in dieses merkwürdige schottische Restaurant (Zitat aus einem Zeitreisefilm) geht, um die Einheits-Burger zu essen, ist mir schleierhaft. Jeder, wirklich jeder andere Burger-Joint bietet da mehr.
liegt im flämischen Teil von Belgien, gar nicht weit von Brüssel. Dort hat Pauwels Trafo, eine Fabrik, das ist einer der wichtigen ELDESIGN-Kunden in Belgien.
Der Sprachenstreit in Belgien hat eine so lange Geschichte, daß kaum mehr einer weiß, wie das alles zustande kam. Natürlich geht das bis ins Mittelalter zurück, all die verfeindeten und konkurrenzierenden Herzogtümer, dazu die freien Niederlande und nun sind die Flamen und Vallonen in einen Staat zusammengespannt. Das geht manchmal so weit, daß mit einem französisch sprechender Belgier im flämischen Teil partout nur flämisch gesprochen wird, auch wenn der Flame gut Französisch kann; und wahrscheinlich auch umgekehrt. Jean-Louis hat da gottseidank weniger Probleme, da er glaubhaft machen kann, daß er Franzose ist und da fällt er nicht unter die sprachliche Diskriminierung.
An sich sind ja die Belgier, ihrer zentralen Lage wegen, sehr sprachgewandt. Wir hatten einmal einen Interessenten zu Besuch in Wien, der fließend Französisch, Flämisch, Deutsch und Englisch sprach und bei Notwendigkeit sozusagen mitten im Satz umschalten konnte. Beneidenswert. Das sollte man nachmachen.
spielte in meinem Leben eine wichtige Rolle. Beide Eltern wuchsen dort auf, in meiner Kindheit wohnten wir zwar in Favoriten, waren aber oftmals in Meidling zu Besuch, da alle meine Großeltern dort lebten. Ab der vierten Klasse der Volksschule wohnte ich dann bei meiner Großmutter in der Ruckergasse.
Oft auch Malakka genannt, war
diese Stadt an der Ostküste der malayischen Halbinsel einst berühmter
Umschlaghafen für die Gewürze des Orients.
Das ausgehende 20. Jahrhundert sieht die Stadt eher am Rande des Geschehens,
gerne von Touristen besucht, weil hier noch malerische Stadtviertel zu finden
sind, traditionelle chinesische Stadthäuser, angefüllt mit pittoresken
Möbeln und Bildwerken und anderes orientalisches, das im modernen Malaysia als
nicht mehr aktuell gilt.
Am frühen Abend einw enig spazierendgehend und in eines der chinesischen
Häuser spähend, wurden wir spontan vom Sohn der Hausherrin - sehr
zu deren Mißvergnügen - zu einer Besichtigung des Hauses eingeladen.
Leider existieren davon keine Bilder; so weit ging ich denn doch nicht, ein
privates Wohnhaus zu fotografieren...
heißt einer der unzähligen Völkerschaften, die quer durch Indochina, von Burma bis Nordvietnam leben.
Schon 1976 gab es in der Umgebung von Chieng Mai Meo-Dörfer, die fest im Griff der lokalen Reisebüros den Touristen ihr döfliches Leben vorspielten.
es gibt zwei Merapis in Java, einen
nördlich von Yogya, den anderen am östlichen Ende der Insel.
Allgemein bekannt, und oft als der Grausame apostrophiert ist allerdings nur der in Zentraljava.
Vor einigen hundert Jahren verschüttete er im Verlauf eines Ausbruchs den
Borobudur so mit Asche, daß das Bauwerk erst hunderte
Jahre später wiedergefunden wurde. Einsam ragt er aus den Reisebenen, ein
perfekter Vulkankegel, der nur in einer vielstündigen Strapaze zu besteigen
ist. Gedanken daran ließen uns sehr müde werden und von Urlaub und
so reden ...
Der andere Merapi liegt auf dem Ijen-Plateau gegenüber von Bali. Das Plateau ist eine der alten Calderas, wie es sie in Indonesien viele gibt. Im Inneren des alten Kraters befinden sich ausgedehnte Kaffeeplantagen. Der noch recht lebhafte Merapi hat durch seine Vorkommen an Naturschwefel recht fragwürdige Bekanntheit erreicht. Der Schwefel wird von Tagelöhnern abgebaut, die zu Fuß in die giftigen Dämpfe steigen und den Schwefel in Körben herausschaffen, solang sie es schaffen, das zu überleben ...
Bundestaat Venezuelas im Südwesten, grenzt an Kolumbien. Recht gebirgig - hier steht der Pico Bolivar und viele andere steile Berge.
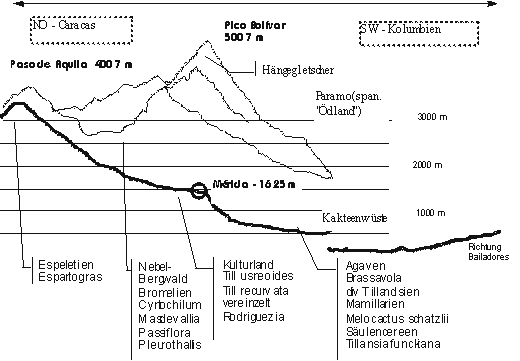
Mérida 2
Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates. Liegt auf 1625 m Seehöhe, das heißt hier kann es in der Nacht schon recht frisch werden und die Venezolaner meinen auch, daß Mérida eine kalte Stadt sei. Wir fanden das Klima weitgehend angenehm.
Mérida ist eine eher kleine Stadt mit ca. 220.000 Einwohnern, einer Universität und einem Flughafen mitten in der Stadt. Das Zentrum liegt auf einer Art Tafelberg in der Mitte des Chama-Tales, rechts und links von Flüssen begleitet, die neueren Stadtteile breiten sich bis an die Talhänge und in die Seitentäler aus.
Eine ideale Ausgangsbasis für Touren in die unliegenden Berge und Paramos, wenn man will, sogar für Hochgebirgstouren auf den Pico.
der Berg Meru ist in der hinduistischen Mythologie der Weltberg, der Sitz der Götter.
Brahma erschuf die materielle Welt, indem er den Berg Meru vom Rücken der ihn tragenden Schildkröte hob und damit den kosmischen Milchozean quirlte. Durch diese Aktion verdichtete sich der Milchozean zu faßbarer Materie und der Kosmos, wie wir ihn heute erkennen, war geschaffen. Wie in jedem indischen Tempel die Form des Heiligtums ein Abbild des Meru ist, ist auch in jedem balinesischen Tempel das Bild des Berges zu finden. In Bali wird der Meru durch eine Serie übereinandergestülpter Schreindächer, mit Kokosfaser gedeckt, dargestellt; die Anzahl der Dächer richtet sich nach der Wichtigkeit des Gottes. Shiva allein sind 11 Dächer vorbehalten, Brahma und Vishnu dürfen sich auf 9 Dächern ausrasten.
Budapest hat kein sehr ausgedehntes Metronetz; dafür eine der ältsten in Europa. Fahrt habe ich keine unternommen, nur einen kurzen Ausflug in die Unterwelt. Erinnerungen an die Sparherde aus dem Maskenspiel der Genien werden wach.
London : vielleicht das umfangreichste und eindruckvollste Netz überhaupt. Die vielstöckigen Stationen, die sich wie Maulwurfsbauten mit ihren gekachelten Röhren dahinziehen; die alten alten Linien mit ihren Liftschächten und den Aufzügen mit Scherengitter, alles zentimeterdick mit uralten Staub zugedeckt. dem nicht si ortskundigen Touristen bietet die Underground, wie sie hierorts heißt, das logistische Rückgrad der Riesenstadt. Wo man mit der Underground nicht hinkommt, gibts nicht viele Touristen
Moskau : das war ein Erlebnis der anderen Art. Spät am Abend, lange nach Sonnenuntergang, waren noch Menschenmassen unterwegs, die wir nur mit fassungslosen Augen betrachteten.
Nach der Abfahrt einer Garnitur begann über dem Tunnelloch, in dem die Waggons verschwanden, eine Digitaluhr zu laufen, damit die Wartenden kontrollieren konnten, daß der nächste Zug wirklich nach längstens 90 Sekunden daherkommt. Das funktionierte wirklich !
Einige der Stationen auf der Ringlinie stammen noch aus der Zeit des Jugendstil und Väterchen Stalins Konditorwaren-Architektur. Ganz so schlimm wie die berüchtigte Lomonossow-Universität sind sie nicht, einige sind sogar mit sehr interessanten architektonischen Details ausgestattet.
Paris : das ist das Pendent zur Londoner Underground und Namensgeberin des Stichwortes - Metro als Abkürzung für Metropolitain.
Nur noch an wenigen Stationen findet man die verschnörkelten Jugendstilgeländer, die einst an so vielen Linien zu finden waren. Hier hat sich ein ähnliches Schicksal erfüllt wie in Wien, wo die Stadtbahn Otto Wagners zu tode modernisiert wurde.
Eine witzige und möglicherweise einmalige Konstruktion sind die Linien, die als Gummiradler fahren, die Waggons haben normale Spurkranzräder, um damit auf Geleisen zu fahren, allerdings auch dickbauchige Gummiräder, die auf Holzbahnen laufen, lautlos und mit extremen Bremskräften.
Auch hier gilt das über London gesagte mit dem logistischen Rückgrat.
Toronto : ist ein eigenes Kapitel, was öffentliche Verkehrsmittel angeht. In für den nordamerikanischen Kontinent unüblicher Art gibts hier recht gute Verkehrsmittel. Von dort, wo ich wohnte zu dem Bürohaus, in dem ich einige Tage zu tun hatte, war es mit dem Auto eine gute halbe Stunde, also etwa von Wien Ost nach Baden oder so. Die ganze Strecke konnte man auch mit Bus und U-Bahn zurücklegen, nicht ganz so schnell aber problemlos. Durch den freigiebigen Umgang mit Flächen konnten die Verkehrsplaner hier etwas ganz eigenes schaffen, U-Bahnstationen, die direkt mit den Endstationen der Autobusse integriert sind, sodaß die Fahrgäste gleich Andocken können. Allein eine der Stationen benötigt so viel Platz wie eine der Wiener U-Bahn-Endstellen, hier im kleinen Europa geht das so einfach nicht.
war die Zwischenstation auf
dem Flug nach Guatemala.
Die Iberia macht das leider etwas umständlich. Nach einer
Übernachtung in Madrid kommt man in Miami an, muß so etwa eine Stunde
warten und wird dann einem kleineren Flieger zugeteilt, der dann nach Guatemala,
Costa Rica, El Salvador und so weiterfliegt.
Das ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, Gepäck zu verschlampen und Iberia ließ diese Gelegenheit auch nicht aus. Von Sonntag abend, da kamen wir an, dauerte es bis Freitag, bis mein Gepäck wieder auftauchte; unversehrt. Erklärungen oder Entschuldigungen wurden offenbar als unnötige Verzierung angesehen und wegrationalisiert.
Mietautos
Sri Lanka 1977
Einen Wagen ohne Fahrer zu mieten, kann schon in ein Abenteuer ausarten. Der in Wien lebende Ceylonese, der uns in sein Heimatland begleitete, versprach schon in Wien, das es No Problem sein, einer in seiner großen Verwandtschaft werde schon eines auftreiben, hervorgen, organisieren ... Der eine Onkel hatte seine Schüssel verkauft und noch kein neues, die Lehrerin des Neffen, die es so gerne vermietet hätte, hat Schwierigkeiten mit den Behörden, die anderen hätten ihn im Stich gelassen, er werde sich natürlich bemühen, wenn wir nur noch einen weiteren Tag Geduld hätten, dann werde er ganz bestimmt ...
Wir fuhren dann mit einem Chauffeur los, in einem uralten australischen Geschwür, nur drei Gänge, die selten gewechselt werden, kein Scheibenwischermotor, aber es fährt.
Gefahren zu werden, war für uns ein seltsames Erlebnis, so kapitalistisch; ganz zu schweigen von den brutalen Umgangsformen, die viele Asiaten mit ihren Maschinen pflegen. Einmal, als wir die steile Einfahr zu einem Resthouse fast nicht mehr erklimmen konnten, vier Personen samt Gepäck bei 30 km/h bergauf im höchsten Gang, der Motor klingelte wie ein Ministrant, wie schlugen zaghaft einen Schaltvorgang vor, meinte unser Fahrer, über ganze Gesicht strahlend "Six-Cylinder Engine - verrrry strrrong ..."
In Bali hatten wir 1988 einen japanischen Suzuki-Jeep mit etwas ausgewergelter Lenkung, mit einer Hupe, die nach einer Viertelstunde ihren Geist aufgab. Das war besonders fatal, da man im asiatischen Verkehr ohne Hupe sozusagen unsichtbar ist. Zu guter Letzt riß auch noch der Auspuff ab, dadurch war dann das akustische Manko etwas kaschiert.
1992 bekam ich in Malaysia einen Proton Saga.
Ist eine Ruinenstadt etwa 8 km von Anuradhapura.
Über eine riesige Stiegenanlage erklimmt man einen Hügel, auf dessen Gipfel dann die Tempelanlagen mit einigen heiligen Felsen liegen, auf die alle hinaufkrabbeln, Einheimische wie Touristen.
In der Ferne kann man von dort die riesigen Dagobas von Anuradhapura über den Baumkronen der umliegenden Wälder sehen.
sah mich zwar einige Male - zumeist beruflich von der GE eingeteilt, aber von der Stadt selber hab ich nicht viel in Erinnerung.
Da ist einmal der Dom, der immer wie aus Seidenpapier geschnitten aussieht, die eindrucksvolle Passage Vittorio Emmanuele II, eine der schönsten Einkaufsgalerien der Welt - da muß sich der Mörtel Lugner noch lange anstrengen - und dann die Ringautobahn. Das ist auch ein Erlebnis der anderen Art, wenn man im Abendrot drei viertel des Weges um die Metropole herumfährt, eingekeilt zwischen LKWs und Alfas, die nicht so schnell fahren können, wie sie wollen. Der Ausgleich dazu war dann der folgende Abend, als wir von der Peripherie mit der Straßenbahn gemütlich bis zum Dom hinein fuhren und dann wieder zurück.
Mimaland
ist eine synthetische Erholungslandschaft ca. 12 km nördlich von Kuala Lumpur. Es gibt einen künstlichen See, in dem man bootfahren kann, ein Schwimmbad mit Wasserrutsche und diverse Picknickplätze. So wasserscheu die Malayen und Chinesen sind, an kaum einem der vielen schönen Strände sieht man einen Einheimischen im Wasser, hier gehen sie doch baden.
Die Orchideenfarm, die die Reiseführer versprechen, gibts nicht mehr, dafür muß man für all das Eintritt bezahlen.
ist das Zauberwort, das den Nahverkehr in Indonesien realisiert. Fast ausschließlich japanische Fabrikate, die außen in großer Schablonenschrift verkünden, daß sie behördlich für "9 Orang" zugelassen seien. Fast jedes Mal legten wir den größten Teil der Strecke, die wir einen Minibus benutzten, als Teil einer kompakten Masse von 20 Leibern zurück, die in das Blechschachterl gepreßt wurden. Mehr wären nur noch in horizontaler Lage hineingegangen und das wollten sie sich offenbar doch nicht antun. Der Begleiter, der mit jedem Minibus mitfährt und als Ausrufer, Schlichter und Kassier fungiert, quetscht sich immer als Letzter hinein und krümmt sich dann so lange, bis er auf seinem kleinen Holzschemel doch noch sitzen kann. Wenns ganz arg wird, läßt er eben die Tür offen und hält sie mit der Hand fest.
Wer je das Geheimnis japanischer Qualitätssicherung in der Autoproduktion ergründen will, braucht nur nach Asien zu fahren. Die japanischen Hersteller brauchen keine aufwendigen Marterstrecken oder Testlabors. Die brauchen nur jedes Jahr einige Ingenieure in die Werkstätten zu entsenden, die die ausgebauten Ersatzteile oder die traurigen Überreste begutachten. Die Belastungen, die im täglichen Einsatz auftreten, lassen sich nicht simulieren.
Die schauderhaftesten Erinnerungen stammen vom Gunung Lawu, wo die Minibusse - in oben beschriebener Besetzung Steigungen hinauf- und wieder hinunterfuhren, die die wildesten Paßstraßen in Europa zu Spaziergängen reduzieren. Allein der Gedanke an einen Bremsversager ließ uns danken, daß wir aus Ungeduld einen Minibus charterten und somit nur zu sechst über diese interessanten Straßen gefahren waren.
Die Preisvorstellungen sind natürlich auch hier extrem flexibel. Für die Fahrt von Probolinggo nach Baluran, die mit einem Überlandbus 1.000 Rp kostet, wollte uns ein netter Mensch seinen Minibus um 40.000 verchartern.
Der Kassier des Fahrzeugs, mit dem wir von Baluran zur Fähre nach Bali fuhren, wollte uns standhaft zwei Sitze für unser Gepäck verrechnen - leider hatte er Pech, denn der Bus wurde während der ganzen Fahrt nicht so voll, daß er jemand hätte abweisen müssen; also mußten wir seine Forderungen ebenfalls abweisen.
auch Shi-san Ling = Dreizehn Gräber genannt, sind eine der Touristenattraktionen, die es in der Umgebung von Beijing gibt. Hierher werden alle Reisegruppen mit Autobuskaravanen geführt, in Verbindung mit der Besteigung des kleinen Stückes renovierter Chinesischer Mauer, die nicht weit von hier ist.
Die Lage der 13 Gräber wurde angeblich von Geomanten sorgfältig ausgesucht, die Gabstätten tief ins Erdreich versenkt und gesichert. Aus (vermutlicher) Pietät wurde nur eines der unterirdischen Mausoleen zur Besichtigung freigegeben - so wälzen sich Menschenmassen durch die Tonnengewölbe der (leeren) Grabkammern; zu sehen ist eigentlich nicht, außer beeindruckendem Mauerwerk und einen riesigen Sarkophag. Gehört eben zur Besichtigungstour.
Da sind die steinernen Wächter, die oen die Zufahrtsstraßen säumen, wesentlich interessanter. Kamele, Elefanten, Krieger und Generäle, lebens- bis überlebensgroß in Marmor gehauen, bewachen die Straßen, damit den Gräbern nichts passiert.
Und dann gibts noch die Geschichte von einem amerikanischen Diplomaten, der brav in Beijing Mandarin lernte und immer wieder Ausflüge in die Umgebung machte. Fuhr er doch eines Tages zu den Ming-Gräbern und fragte zwei Bauern nach dem Weg - auf einheimisch, selbstverständlich. Die Bauern glotzten blöd und antworteten nicht. Fuhr er also weiter.
Kaum war er verschwunden, soll einer der Bauern gesagt haben - "also diese Langnasen werden auch immer komischer. Was der da daherredete, das klang doch tatsächlich wie «wo geht´s denn da zu den 13 Gräbern ? » da soll sich noch einer auskennen ".
liegt einige km flußaufwärts
von Mandalay am anderen Ufer des Ayeyarwady.
Der Ort ist Zeugnis des Scheiterns eines wahrhaft königlichen Projektes,
das in seiner Hybris auch nur scheitern konnte. Der damals herrschende König
wollte die größte Dagoba der Welt bauen, ein
wahrhaftes Monster aus Ziegelsteinen, das laut Planung höher als der Nordturm
des Stephansdomes hätte werden sollen. Nach einem der vielen Erdbeben in
der burmesischen Geschichte senkten sich die Fundamente, die würfelförmige
Basis wurde von tiefen Sprüngen durchzogen und da auch die Staatsfinanzen
durch das Projekt total zerrüttet waren, wurde der Bau eingestellt. Die
Legenden behaupten, daß der eigentliche Grund für das Scheitern des
Baues ein ganz anderer war. Seit Menschengedenken hat jeder burmesische Tempel
ein Löwenpaar, das dessen Eingang bewacht.
Ganz gegen alle Regeln hatte der König den Bau so vorangetrieben, daß
mit der Dagoba bereits begonnen wurde, bevor die Wächterlöwen fertig
waren. Das hatte natürlich fatale Folgen - wer an die Kraft der Löwen
glaubt, ist felsenfest der Meinung, daß mit intakten Löwen das Erdbeben
zB nicht passiert wäre...
Über die Trümmer eines der eingestürzten Ecken kann man auf die Oberseite des Fragmentes klettern und den weiten Blick über den Ayeyawady genießen.
Außerdem gibts dort noch die zweitgrößte Glocke der Welt (nach der im Moskauer Kreml) bewundern und eine Reihe von Andenkengeschäften besuchen.
Laut Folklore gibt es hier 4 wunderbare Dinge zu bestaunen:
1.die Dagoba
2.die
Glocke
3.einen wunderbaren See - der ist leider verschwunden
4.das
vierte wunderbare Ding blieb geheim, ich weiß nicht warum
Schleusen auf der pazifischen Seite des Panamá-Kanals. Wenn man nicht nach Gatun fahren kann, sollte man sich die Miraflores-Schleusen ansehen.
ist ein Vorort von Toronto. Prime hatte dort eines ihrer Büros; und das lernte ich bei einer meiner Dienstreisen kennen.
Da der Flughafen von Toronto in Mississauga liegt, gibt das Anlaß zu hinterfotzigen Scherzen von Torontonians, etwa, daß einem bei Mißverhalten die Landeerlaubnis auf dem Mississauga-Airport verweigert würde...
ist eine der kleinen Städte im Weinviertel. Ein Wochenendausflug kann recht interessant sein, wenn man wie ich durch das Bundesheer dort viele Wochen lang festgehalten wird, kann auch die netteste Stadt zum öden Exil werden.
sind eines der schlimmsten Übel in den sogenannten Entwicklungsländern. Seit urdenklichen Zeiten verwendeten diese Völker nur verrottende Verpackungsmaterialien, jetzt müssen sie uns alles nachmachen, auch die Verpackungen und das landet dann alles auf der Straße oder im Wald.
Besonders schlimm war es in Yaoundé und Nuwara Elia, aber auch Kathmandu ist eindrucksvoll.
Das Tal der 1000 Grotten bei Dunhuang. Der chinesische Name sagt schon viel über die Wertschätzung dieser Grotten, bedeutet er doch "keine höher als diese Grotte"
Das Wünstental, in dem die Grotten zu finden sind, liegt nicht weit von Dunhuang entfernt, jenem Ort, wo sich einst die Seidenstraße gabelte. Der eine Ast ging nördlich durch die Hochebenen des Pamir in Richtung auf das Schwarze Meer, der andere durchquerte die tibetische Hochebene und zog Richtung Persion und Türkei.
So war Dunhuang die letzte große Siedlung bevor sich die Karavanen in die große EInöde aufmachten und wurde im Laufe der Jahrhunderte entsprechend reich.
Nahebei siedelten sich buddhistische und taoistische Mönche an, die begannen, ihre Klausen in die Konglomeratwände des Oasentales zu schlagen. Die Ausstattung der Höhlentempel wurde immer schönener, mehr und mehr Pilger kamen, ein religiöses Zentrum blühte Jahrhunderte lang, bis die Seidenstarße an Bedeutung verlor und zudem die Wüste übermächtig wurde. Die hunderte Grotten gerieten in Vergessenheit und wurden erst kurz vor der letzten Jahrhundertwende eher durch Zufall wiederentdeckt. Die abgelegene Örtlichkeit war auch während der Großen Kulturrevolution ein Segen, da keine der Roten Garden hierher in die Einöde kam, um die dekandenten religiösen Werke einzustampfen, wie das etwa in Lhasa passierte...
Hoffentlich werden die wunderbaren Stuckmalereien und Lehmplastiken, die in der trockenen Wüstenluft Jahrhunderte überdauerten, nicht wie die ägyptischen Gräber durch die Neugierde der Touristen zerstört.
Weil dort so viele Tage der
Wind blies, nannten besonders böse Menschen die Stadt das "Arschloch
von Österreich".
siehe auch Hinterbrühl.
Im Qur'an wird das Paradies als ein himmlischer Garten geschildert, in dem jeder erdenkliche Luxus den Gerechten umgibt. Wie in Arabien war in Persien, wo die Vorbilder der kaiserlichen Moghulgärten zu suchen sind, der größte Teil des Landes unfruchtbar und es bedurfte großen Aufwandes, um die Obsthaine und Gärten der Paläste zu bewässern.
im Gartenpavillon ...

Den Anstoß zur großen Entwicklung der Gartenarchitektur wurde im 16. Jahrhundert durch Babur, den ersten Moghulkaiser gegeben. Aus jener Zeit stammt die Beschreibung eines Gartens, die uns ein persischer Autor hinterließ: "Wenn immer möglich legen wir Perser unsere Gärten an einem flachen Hang an. Der Garten, den ich nun beschreibe, war so konstruiert, daß zwei Läufe von kristallklarem Wasser sich vor einem Gebäude trafen und dort einen weiten See bildeten, auf dem sich unzählige Schwäne, Gänse und Enten vergnügten. Unterhalb dieses Sees waren sieben Wasserfälle - so wie es auch sieben Planeten gibt. Und wieder unterhalb dieser Wasserfälle lag ein kleiner, zweiter See und ein herrliches Torgebäude, das mit blauen Kacheln verziert war ..... nicht nur aus den Seen, sondern auch zwischen den Wasserfällen hervor spritzten Wasserstrahlen so hoch in die Luft, daß der herabfallende Sprühregen einer Vielzahl von Diamanten glich. Wie oft rührte mich das Plätschern der Springbrunnen und das Murmeln des Baches, der, eingezwängt zwischen Rosenbüschen, Trauerweiden, Platanen, Akazien, Zypressen und anderen Bäumen, über die Terrassen des Gartens bergab eilte. Bei Allah ! Ich glaube in der Tat, daß die Schönheit dieses Gartens nicht einmal von jenem in Qur'an erwähnten Garten übertroffen wird, von dem es heißt : "Der Garten Iram ist mit hohen Pfeilern geschmückt. Nichts dergleichen wurde in dieser Welt geschaffen."
Als der afghanische Fürst Babur, der die Dynastie der Moghulkaiser begründete, das Reich Hindustan erobert hatte, stellte er unter Anderem enttäuscht fest : "Einer der größten Mängel dieses Landes ist der Mangel an Wasser ....." Der Garten, den er in Agra an den Ufern des Jumna anlegen ließ, sollte Vorbild für viele weitere Anlagen werden. Allein für den Antrieb der Wasserräder, die die Kanäle und Springbrunnen versorgten, waren 20 Ochsenpaare tätig.
In Europa sind viele Schloßgärten lediglich ein Stück aktivierter Natur, die mehr oder weniger architektonischen Zwängen unterworfen wird. Die indischen Gärten dagegen sind integraler Bestandteil des architektonischen und weltanschaulichen Konzeptes ihrer Erbauer. Aus der Notwendigkeit einer stetigen künstlichen Bewässerung resultiert die strenge geometrische Teilung des Geländes durch Kanalnetze und die Auflösung jedes Geländeabfalles in ein Terrassensystem.

Während der heißen Sommermonate pflegte sich die kaiserliche Familie ins kühle Hochtal von Kashmir zurückzuziehen. Nur wenigen hohen Adeligen war es erlaubt, den Großmoghul zu begleiten. Der Troß schlug seine Zelte am Fuß der Berge, in der Hitze der Ebene auf. In Kashmir stand Wasser genug zur Verfügung und das bergige Gelände eignete sich vorzüglich für die Anlage weitläufiger, terrassierter Gärten.
Ein Detail, das in den kashmirischen Moghulgärten immer wieder auffällt, sind die "Chadars", Wasserrutschen aus gerilltem Marmor, die die einzelnen Ebenen miteinander verbinden. Chadar heißt so viel wie Shawl, so genannt nach dem weiß schäumenden Wasser, das über die Rutschen strömt und Auge und Ohr der Wüstensöhne aus dem trockenen Afghanistan erfreute.
Die unterste Gartenterrasse, gleich hinter den Eingangstreppen, könnte man fast als Steingarten bezeichnen. Streng geometrische Kanäle und Teiche, wenige Blumenrabatten, einige Springbrunnen.
Eine Ebene höher führt der breite Kanal, der den ganzen Garten durchzieht - er symbolisiert den mythischen Fluß Nahr-i-Bihisht, der das Paradies durchfließt, zur Empfangshalle, die für offizielle Audienzen vorbehalten war. Bis hierher durften Außenstehende vordringen, der Rest des Gartens galt als Serail, das niemand außer dem Großkaiser, seinen Frauen und beider Diener betreten durfte. Der Kanal wird von einer Reihe Springbrunnen der Länge nach durchzogen, rechts und links von je einer Reihe großer Platanen flankiert.
Die dritte Ebene ist ganz dem Schatten der alten Platanen, die hier stehen, vorbehalten. Im saftigen Rasen unter den mächtigen Bäumen hat sich eine Gruppe von Sikhs zusammengefunden, die hier in freier Natur den Sonntag verbringen. Unter der Führung zweier älterer Männer mit eindrucksvollen weißen Bärten singen sie, deklamieren Gedichte und geben kleine Tanzeinlagen.
Leider führen sich viele der indischen Besucher weniger zurückhaltend auf. Vor allem in den unteren Teilen des Gartens ist der Rasen durch die vielen Picknicker schon arg zertrampelt. In jeden Kanal und jeden Teich müssen sie ihre Füße stecken und ihre Eßgeschirre waschen.
Moghuln
Als Einführung ein kurzer Abriß der Genealogie der Moghul-Dynastien, natürlich aus gescheiten Büchern abgeschrieben :
In der Nachfolge des Propheten Mohammed begannen die unter dem Islam zum ersten Mal vereinten arabischen Stämme Eroberungszüge mit der Überzeugung, die Heiden zu besiegen und zu bekehren. Im 10. Jahrhundert setzte sich im Verlauf der schrittweisen Expansionen nach Osten eine türkische Dynastie in der Gegend des heutigen Afghanistan fest. Vorerst beschränkten sich die islamischen FÜrsten mit Eroberungszügen in die fruchtbaren Ebenen Nordindiens, immer wieder mit Schätzen und Sklaven beladen heimkehrend. So drang Muhammed, Fürst von Gur Ende des 12. Jahrhunderts bis Delhi vor. Einer seiner Generäle, der avancierte Sklave Qutub-ud-din-Aibak nahm Benares ein. Als 1206 der FÜrst von Gur ermordet wird, wählen seine Truppen Qutub zum Oberbefehlshaber. Unter seiner Herrschaft wird das erste wichtige Baudenkmal des Islam in Indien, die Moschee Quwwat-al-Islam, heute unter dem Namen Qutub-al-Minar bekannt, begonnen.
Ende des 14. Jahrhundets fallen die Mongolen unter ihrem Führer Timur-Lenk, auch als Tamerlan in die Geschichte eingegangen, in Nordindien ein, ziehen sich jedoch bald wieder zurück, nachdem lokale Regierungsdynastien eingesetzt wurden. Einer der unzähligen Enkelsöhne Timurs, Babur, erobert auf der Suche nach einem Reich das Sultanat Delhi. Aus den späteren Nachfolgekämpfen geht Akbar, ein Abkömmling Baburs, als Sieger hervor. In bitterer Erinnerung an die plündernden Horden Tamerlans wurden auch die Heere der Nachfolger Timurs für Mongolen gehalten und nach einer Lautverschiebung entstand so die Bezeichnung "Moghul".
Mit dem Großmoghul Akbar, "König des Islam, Asyl der Menschheit, Befehlshaber der Gläubigen, Schatten Gottes auf dieser Welt, Abu-Fath Jalal-ud-din Muhammad Akbar, Padishah-i-Ghazi (dessen Königreich Gott ewig erhalte)" steuerte das Reich der aus Afghanistan eingefallenen Eroberer dem Höhepunkt seiner Macht zu. Obwohl Muslim von Herkunft und Erziehung, steuert er einen toleranten und mystischen religiösen Kurs, oft in krassem Gegensatz zu seinen geistlichen Beratern. Er förderte bildende Künstler, Architekten und Dichter ohne Rücksicht auf ihr Glaubensbekenntnis und befreite sogar die Hindus von der auf Nichtmuslims eingehobenen Steuer. Agras überdrüßig, regiert Akbar 1570 - 1585 in Fatehpur Sikri, der aus dem Nichts in einer staubigen Ebene erschaffenen Residenzstadt; 1599, als die Wasserversorgung Fatehpur Sikris versagt, zieht er wieder nach Agra um, regiert dort bis 1605. Der fromme Wunsch, der in seinem offiziellen Titel ausgesprochen wurde, erfüllte sich nicht; der Niedergang des Reiches begann bereits mit seinem Sohn Jahangir Nur-ud-din, einem poetischen und wankelmütigen Säufer, der 1605 seinem Vater auf den Thron nachfolgte.
"Ich brauche nichts als ein Viertel Wein und ein Pfund Fleisch" soll sein Wahlspruch gewesen sein. Vor allem an persischer Miniaturmalerei interessiert, überließ er die Regierungsgeschäfte weitgehend seiner Lieblingsfrau Nur Jahan (Licht der Welt).
Nur Jahan erbaute für ihren Vater Itimad-ud-Dhaula, Großvezir des Kaisers Jahangir ein am Nordufer des Jamuna Rivers gelegenes Mausoleum, das von vielen als architektonischer und künstlerischer Vorläufer des Tadj Mahal angesehen wird. Jahangir, dem die Miniaturmalerei viel wichtiger war, als die Architektur, stellte ihr unbegrenzte Mittel zur Verfügung, möglicherweise, um die Ermordung ihres ersten Mannes wiedergutzumachen.
Shah Jahan, Sohn Jahangirs, seit 1628 Großmoghul, wandte sich total von der Toleranz seines Großvaters ab. Unter dem Einfluß seiner islamischen Ratgeber machte er die Religionsedikte Akbars wieder rückgängig, zerstörte Hindutempel und wandelt den Charakter seiner Herrschaft mehr und mehr zum egoistischen Eigensinn. Von 1638 bis 1650 errichtet er die Rote Feste in Delhi und die große Freitagsmoschee.
Die neue Stadt in Delhi - Shahjahanabad - bestehend aus der Roten Feste und den umgebenden Wohnvierteln wurde am Freitag, den 9. Mahavam 1048 n.H. (1638) begonnen und nach einer Bauzeit von 9 Jahren fertiggestellt - ein Zeitraum, der unter Berücksichtigung der damaligen Bautechnologie schwer vorstellbar ist.
Obwohl Abu Fazl, der Hofhistoriker des Kaiser Akbar, seine Epoche minutiös schilderte - er notierte sogar die Lieblingsrezepte und Würzgewohnheiten berühmter Menschen - dürfte er sich für die Bauwut seines Herrschers nicht interessiert haben. Es sind von ihm nur allgemeine Bemerkungen über die neuen Bauordnungen überliefert, die Akbar installierte. Über Technologien, Kosten oder Gehälter schrieb er leider kein Wort. Aus der Ära Aurangzebs sind allerdings einige Informationen über Baukosten und Gehälter erhalten geblieben.
So kostete die Errichtung des
Roten Forts in Agra (Preise in Rupien) :
Burgmauer und Graben 2 100 000
Bazare, Werkstätten 400 000
Wohnräume des Kaisers 2 800 000
Divan-i-Khas 1 400 000
Harem und Garten 550 000
Divan-i-Am 200 000
Baderäume 600 000
Paläste der Damen 700 000
total ca 10 000 000 Rp
Um diese dürren Zahlen mit der Realität vergleichen zu können,
einige Zahlen über Materialkosten und Gehälter :
Roter Sandstein 175 kg 1 Rp
gebrannte Ziegel 1000 Stk 3/4 Rp
Dachziegel 1000 Stk 2 Rp
Glas 1 Scheibe 1/10 Rp
Gehälter :
Holzarbeiter 1.25Rp /Monat
Soldaten 2.5 - 10 Rp /Monat
Dienerinnen
im Harem 20 Rp /Monat
Angehörige des kaiserlichen
Harems1000-1600 Rp/Monat
geschätzter Umrechnungsfaktor (1986/87) :
1 Rupee = 2 US$
Rechnen wir die Bausumme des Roten Forts auf Basis eines Maurergehaltes um, unter der grob vereinfachenden Annahme monatlicher Bruttopersonalkosten von öS 20.000, so kommen wir auf die fantastische Summe von ca 100 Milliarden Schilling.
1630 stirbt Mumtaz Mahal (Perle des Palastes), seine Lieblingsfrau, im Alter von 39 Jahren bei der Geburt ihres 14. Kindes. Seine Trauer, die er in der Errichtung des Tadj Mahal unsterblich werden ließ, trug nicht wenig zum Untergang des Reiches bei. 20.000 Experten aus ganz Asien und sogar Europa wurden in Agra konzentriert, um dieses Wunderwerk zu errichten.
Aus den vagen Angaben der Chroniken ist zu entnehmen, daß die Errichtung der Mausoleumsanlage insgesamt 18.5 Millionen Rupees verschlang, davon der Zentralbau etwa 5 Millionen Rp. Die Differenz wurde für Nebengebäude, Gärten und Toranlagen ausgegeben. Mumtaz Mahal hinterließ zwar ein Privatvermögen von 100 Lakh Rupees (10 Millionen), es wurde jedoch kein Groschen dieses Geldes für den Bau des Grabmales verwendet. Wie in feudalen Gesellschaften seit urdenklichen Zeiten üblich, wurden die Untertanen mit Sonderabgaben belegt. 30 Dörfer in der Umgebung Agras wurden gezwungen, aus ihren Einnahmen jährlich 40 Lakh Rupees (4 Millionen) zur Finanzierung des Baues abzuführen.
Die Söhne des desinteressierten Shah Jahan verstrickten sich früh in eine vorgezogene Entscheidung über die Thronfolge, da offensichtlich Jahans Interessen kaum über seine architektonischen Träume hinausgingen. Kurz nach der Fertigstellung des Tadj Mahal ging Aurangzeb 1586 aus dem mörderischen Wettstreit der Söhne als Sieger hervor und verbannte den abgesetzten Shah Jahan in die Rote Feste in Agra. In seiner Suite mit Blick auf das Tadj Mahal verbrachte Jahan die letzten Lebensjahre als Gefangener, von wenigen seiner Diener umgeben, von der Welt schnell vergessen. Sein Projekt, auch für sich selbst ein Pendant in schwarzem Marmor am anderen Ufer des Jamuna River zu bauen, blieb eine Seifenblase.
Aurangzeb jagte dem Traum eines gesamtindischen Reiches weiter nach und blutete den Norden aus, um endlich den Süden dem Reich einzuverleiben. Die Eroberung gelang, doch das Reich war durch die Kriegsaufwendungen und Prachtbauten zu geschwächt, um in der Folge dem persischen Eroberer Nadir Shah widerstehen zu können, der 1739 Delhi plünderte. Aurangzeb stirbt 1707, keinem seiner Nachfolger gelingt es, die vielfältigen Völkerschaften unter Kontrolle halten zu können oder durch kluge Führung zu einem Staat zu vereinen, wie es Akbar gelang. Die Rajputenfürsten in der heute Rajastan genannten Landschaft erheben sich; an der Westküste gewinnen die Marathen zunehmend an Macht und begründen ein neues Reich. Dazu kommt der steigende Einfluß der Kolonialmächte, allen voran der der Engländer. Sie machen sich die Uneinigkeit der Reiche und das Gegeneinander der Völker zunutze und gehen aus den Machtkämpfen als Sieger hervor. Am 1. Januar 1857 wird Victoria als Kaiserin von Indien proklamiert. Das Zeitalter der Moghuln ist endgültig zu Ende.

Zum Verständnis der Bauwerke, die im Verlauf der Moghulherrschaft errichtet wurden, ist der Gegensatz der architektonischen Auffassung bei Hindus und Moslems wichtig : während für die Hindu-Architekten jedes Bauwerk unter theologischen Aspekten entworfen und gebaut wurde, hatten die islamischen Bauten keinerlei transzendentale Bedeutungen. Ein Hindutempel ist ein steingewordenes Glaubensbekenntnis, in dem auch das kleinste Detail in Beziehung zum Ganzen steht. Die Moscheen, die die afghanischen Eroberer bauten, waren in erster Linie Versammlungsraum, sakral oder profan verwendbar. Grundrisse und funktionale Details der Moscheen erinnern an die jahrhundertealte Tradition asiatischer Karavanseraien : ein rechteckiger Umfassungsbau mit Arkaden, die sich in den Innenhof öffnen, mächtige Torbauten in den Seiten des Rechteckes, der Brunnen meist im Zentrum des Innenhofes. Aus dieser Auffassung heraus hatten die islamischen Bauherrn auch keinerlei Probleme, Hinduhandwerker zu beschäftigen und die Trümmer abgerissener Tempel als Baumaterial zu verwenden.
die große Wüste, die weite Teile des südlichen Californien bedeckt und sich bis nach Mexico hinunterzieht. Hier kann man als Autofahrer erleben, was eine weite Landschaft ist.
Bullfrog
Gila Bend
Organ Pipe
Cactus National
Park
Parker
Why
lernten wir nur als Namen kennen, mehr als das Busterminal sahen wir nicht. Dafür fiel eine Horde Hilfsbereiter über uns her, die uns in den nächsten Minibus in Richtung Probolinggo zerren wollen, unser Gepäck für uns tragen wollen, unsere Haut angreifen wollen, und Erdnüsse, Bananen, Chips, Fruchtsäfte und Eis verkaufen wollen. Aus der ersehnten Pause wird nichts, wir flüchten vor so viel umzingelnder Hilfsbereitschaft in die enge Geborgenheit eines überfüllten Minibusses.
auf dem Rückweg vom Markt in Tourou nach Maroua, über die Schotterstreifen, die hier als Straßen ausgegeben werden, ist ein Mittagessen in Mokolo eingeplant. Eines der schlimmsten Poulet Marathon, das man sich vorstellen kann, dazu verschrumpelte Pommes Frites - nach einer halben Stunde Wartezeit. Und das alles um CFA 3.000.- pro Person. Das ist Nepp.
Frauen, der Mond ist schließlich ein weibliches Symbol.
Mondsteine 1
Halbedelsteine, auch Adular oder Wasseropal genannt. Dieses Feldspatmineral wird in Sri Lanka in den Sedimentseifen der Flußbetten in abenteuerlichen Minen gewonnen.
Mondsteine 2
heißen die schützenden Schwellensteine, die in den alten ceylonesischen Palastruinen zu sehen sind. Halbkreisförmige, fein skulptierte Steinplatten, auf denen Elefanten und andere heilige Tiere des Eingang der Gebäuder vor Dämonen und anderen bösen Geistern schützten.
oder Weiße Nonne nennen die Guatemalteken ihre Nationalblume - Lycaste skinneri alba.
In der Natur ist diese wunderbar blühende Orchideen heute kaum mehr zu finden, zu viel Primärwald wurde den Kaffee- und Kardamom-Plantagen geopfert. Wenn es wenigstens Mais oder Bohnenfelder wären, da hätten die Bauern vielleicht mehr davon.
Die Normalformen der Lycaste skinneri sind cremeweiß mit verschieden ausgeprägten rosa Streifungen und Flammungen, die alba-Form hingegen prangt in jungfräulichen weiß und streckt ihre Sepalen in einem perfekten Dreieck wie die gefaltete Haube einer Klosterfrau in die Luft.
das sind lokale Attraktionen von zweifelhaftem Wert. Die ausländischen Touristen, die Affen nur aus Tiergärten kennen, sind anfänglich begeistert von den putzigen Tierchen, bis sie deren wahre Intentionen kennenlernen.
der Berg des Hl Michael in der Normandie ist ein ganz eigenes Erlebnis, wenn man das in der Abenddämmerung sieht. Aus dem rot schimmernden Wattenmeer erhebt sich wie ein Kristall der überbaute Felsen, wo von Uferbefestigungen über Wohnbauten die Klosterkathedrale sich wie ein in den Himmel gerichteter Pfeil erhebt.
1986 - Beim Hotel Rossija, einem gigantischen Glaspalast, entlassen wir den Taxler und spazieren in Richtung Roter Platz. Neben der modernistischen Glasfassade des Hotels wirken die museal restaurierten Kirchen, die bei der Modernisierung Moskaus übrigbleiben durften, ganz merkwürdig. Außen gründlich überholt und frisch getüncht, innen Rumpelkammern.
Der Anblick des Roten Platzes mit Basiliuskathedrale und Kremlmauer in der Abendsonne löst in mir einen leichten Reiseschock aus. Die Ortsveränderungen im Jet-Zeitalter laufen so rasch ab, daß man sie seelisch kaum verkraften kann. In der fotogenen Abendstimmung sieht alles wie Kulissen aus einem Werbefilm aus. Der Platz ist fast menschenleer, nur einige Spaziergänger genießen das schöne Wetter. Die Sowjetmacht sorgt für Ordnung. Auf dem ganzen Platz ist Rauchverbot und Milizionäre sorgen dafür, daß es auch eingehalten wird.
Unser Rundgang um den Kreml wird unterbrochen - um 22:00 Uhr wird der Park geräumt. Da trotz der späten Stunden keiner Hunger hat, wird der ursprüngliche Plan, Essen zu gehen, abgeändert. Wir begeben uns in die Unterwelt und fahren mit der Metro spazieren.
Es gibt zwar keine offiziellen Stadtpläne und keine offiziellen Metroübersichten wie etwa in London oder Paris, das Steckennetz ist jedoch in jeder Station angeschlagen. Trotz unserer löchrigen Kenntnissen der kyrillischen Schrift finden wir uns bald recht gut zurecht. Vor allem die Stationen aus der ersten Bauphase, der Zwischenkriegszeit, sind eine faszinierende Mischung aus Art-Deco und sozialistischem Realismus. Ans Rokkokko erinnernde Stuckornamente an den halbrunden Gewölben, in einer Station sogar indirekt beleuchtete Mosaikglasfenster mit Motiven aus der Industrie und Landwirtschaft.
Das Faszinierendste ist aber die Frequenz der Züge und die ungeheure Masse an Werktätigen, die noch spät in der Nacht durch die Unterwelt flutet. Alle drei Minuten zischt ein Zug in die Station; damit alle das auch kontrollieren können, läuft eine Digitaluhr über dem Tunnelausgang mit. Maximalverspätung ca. zehn Sekunden.
Der Informationszettel in der Hotelreception erweist sich bei der Rückfahrt als guter Wegweiser. Von PLOSHAD SVERDLOVA neun Stationen bis zur Endstation RETCHNOY VOKZAL und dann mit dem Bus 551 bis zum Flughafen zurück. Die Ausflüge in die Katakomben der Metro dauerten doch länger als erwartet, es ist schon nach 23:00 Uhr, als wir den Nachtbus besteigen. Durch ägyptische Finsternis - Straßenbeleuchtung ist in den Vororten Luxus und deshalb nicht angebracht, zuckeln wir aus der Stadt. Immer wieder steigen Menschen aus oder ein; mir ist schleierhaft, wie Fahrgäste oder Fahrer wissen, wo sie sind, da wir in der Schwärze nicht einmal die Straße erkennen, auf der wir fahren.
Nach einem Mitternachssnack im Buffet des Flughafens - ausgezeichneter Shrimpsalat, mit geschmuggelten Rubeln erstanden - lassen wir uns ergeben in die Betten fallen, die mit jungen Hunden ausgestopft scheinen.
Frühstück im Hotel Sheremetjevo - wie von einem böswilligen Aktionisten geplant. Das Brot ist alt, die Eier zwar siedendheiß, jedoch offenbar nur kurz gebadet, da sie innen total flüssig sind. Die meisten Mitglieder unserer Truppe verlassen nach einer Tasse Heißgetränk, Kaffe kann man es leider nicht nennen, fluchtartig das Hotel, um in die Stadt zu fahren. Kurz darauf wird für alle eine recht ordentliche Germmehlspeise serviert. Christine will einen Schuß Milch in den merkwürdigen Kaffe, der Kellner schlägt sofort zu und gießt wie aus einer Gießkanne ein, nur der Gupf fehlt ...
Eine der maliziösen Stories, wie sie auf Reisen beliebt sind und immer wieder zählt wrden, berichtet später von einem ähnlichen Hotelfrühstück in Leningrad, bei dem zwar Eier serviert wurden, aber einer der Gäste auch Eierbecher wünschte. Über mehrere Hierarchien der Verantwortung wurde der unübliche Wunsch ans Personal nach oben delegiert, keiner wollte sich der Herausforderung der Eierbecher stellen, bis schließlich der Hotelmanager mit einem ganzen Servierwagen Eierbecher dahergefahren kam ...
Heute verzichten wir aufs Taxi, die Verbindung mit Bus und Metro ist kaum langsamer. Bis auf die abgetrennten Bereiche, in denen das Zentralkommitte zu Hause ist und die Gegend rund um den großen Sitzungssaal dürfen die Touristen fast alles im Inneren des Kreml besichtigen. Als Touristenattraktion und vielleicht als Kulturgut pflegt die atheistische Sowjetunion die Kirchen im Kreml recht gut. Die Fassaden sind frisch geweißt, die Kuppeln neu vergoldet, die Fresken im Inneren restauriert. Nicht auszudenken, wie kalt hier ein Weihnachtsgottesdienst gewesen sein mußte, Steinfußboden, einige Stunden stehen, sogar jetzt im Sommer saugen Wände und Boden die Wärme des Vormittages auf.
Die Wachablöse vor dem Lenin-Mausoleum ist ein fantastisches Beispiel menschlicher Dressur. Die automatenhafte Präzision, mit der die Posten in ihrem theatralischen Stechschritt auf- und dann wieder abmarschieren, sucht sicher seinesgleichen. Merkwürdig, wie sich die historischen Strukturen wiederholen. Jeden Tag stehen Schlangen mit Menschen aus allen Republiken vor dem Mausoleum, um den Überresten ihres Staats- und Religionsgründers Lenin ihre Ehre zu erweisen. Den Zaren wurden sie nach dem Petersburger Aufstand los, jetzt hat das alles nur einen anderen Namen ...
Gegenüber dem Mausoleum liegt das Kaufhaus GUM, der Stolz der sozialistischen Konsumenten. Ein beschaulicher Ort mit Arkaden unter einem Glasdach, wo in jeder Abteilung die dort erhältlichen Waren zu netten Pyramiden hinter Glas aufgebaut sind. Immer nur eine Sorte Konservendosen oder Keksschachteln. Wir dürfen nicht ungerecht sein, Gerngross ist das natürlich keiner, aber im ersten Kaufhaus des Landes hätte ich mir schon mehr Angebote und Auswahl vorgestellt. Noch dazu, wo alle Touristen unweigerlich hier hereinschneien.
Auch hier im Kaufhaus herrscht natürlich strenges Rauchverbot, wie auf wichtigen Plätzen oder in allen Metro-Stationen. Finde ich gut.
1987
Gorbies Perestrojka ist bis in den Flughafen vorgedrungen - lang lebe der Genosse Vorsitzende ! So schnell, freundlich und zuvorkommend waren die Zollbeamten und Paßkontrolleure noch nie. Mit der Sowjetmacht noch nie in Berührung gekommene Reisende fanden die Abfertigung der Reisenden noch immer östlich angehaucht, mir kamen sie fast wie in Frankfurt vor.
In Wien beim Abflug wunderschönes Sommerwetter, hier in Moskau ist es merklich kühler und leicht bewölkt. Der Flug verlief ganz normal, bis auf die üblichen Digitalmanöver der sowjetischen Piloten beim Anflug. Mir scheint, die Piloten der Aeroflot müssen immer den Ernstfall probieren.
Mit den zwei Stunden Zeitdifferenz von Wien nach Moskau hat das biologische Verwirrspiel begonnen, das immer mit weiten Flugreisen verbunden ist. Es ist jetzt kurz nach 17:00 Uhr, in etwas mehr als drei Stunden werden wir über Tashkent nach Delhi abreisen.
Mr. Po
war unser Fahrer, als wir an die 2.000 km über die teilweise kaum beschreiblichen Straßen von Myanmar fuhren. Seinen richtigen Namen haben wir entweder nicht erfahren oder uns nicht gemerkt; macht aber nichts, der kleine Burmese war ein Goldstück. Zeitweilig war er von den stundenlangen Fahrten durch Schlaglöcher schon recht geschlaucht und verbarg das mit asiatischem Gesicht. Warf sich dann einen seiner vorher besorgten Betel-Bissen ein, um für die nächsten 100 km fit zu sein.
Mt. Lookitthat
auch so ein utopischer Ort, erfunden von Larry Niven. Ein Bergplateau, einige km2 groß, einige tausend Meter über einer für Menschen total unwirtlichen und lebensfeindlichen Planetenoberfläche. Die ersten Siedler, die dort landeten, waren so baff, daß sie eben sagten : "Hey, look at that ..." und so kam der Berg zu seinem Namen. Wie sich dann dort eine faschistische Gesellschaftsordnung mit forcierter Organspende als Bestrafung entwickelte und wieder gestürzt wurde, ist bei Larry Niven nachzulesen.
ist das Hauptheiligtum des
Nat-Kultes in Myanmar.
Die Nats könnte man als Naturgeister bezeichnen, die eine Symbiose mit
dem buddhistischen Panteon eingegangen sind. Die 64 Nats, das sind die Hauptgeister
dieser Naturreligion, die sich nahtlos in den buddhistischen Glauben einfügt,
sind eine Mischung aus althergebrachten Geister, Heroen, Heiligen und anderen
Vorstellungen, die sehr direkt auf das Leben der Menschen Einfluß nehmen
können.
Nats-Schreine gibt es im ganzen Land, aber hier ist ein ganzer zuckerhutartiger Berg den Nats gewidmet. Das, was allgemein als Mt. Popa bezeichnet wird, ist ein ausgewitterter Vulkanschlot, der am Fuß des eigentlichen Mt. Popa wie ein Zuckerhut aus der Ebene ragt. Am Fuß von Devotionalien- und Obstständen und natürlich diversen Gaststätten umwimmelt, schlingt sich eine überdachte Treppe außen an dem Felszacken zu den Tempels auf der Spitze empor. Auch entlang der Treppe sind jede Menge Andenkenstände und einige Schreine zu finden, außerdem eine ganze Anzahl von Affen, die hier von den Pilgern gefüttert werden und sich dementsprechend aufführen, wenn ein Aufsteigender nicht seinen Tribut an Erdnüssen verrichtet.
Die Besichtigung der Gipfelschreine wurde durch einen der seltenen Monsoon-Wolkenbrüche arg behindert, denn die wasserfallartigen Regenfälle wollten nicht und nicht nachlassen und so waren die Schreine nicht nur von Betenden, sondern auch anderen Besuchern total überfüllt. In traditioneller Manier sind die Statuen der Nats in grottenbahnartig farbigen Panoramen hinter Glas aufgestellt, mit vielen farbigen Fetzen bekleidet und mit Spenden eingedeckt.
Wie tief der Nat-Glaube in den Burmesen verankert ist, möge eine kleine Anekdote unseres Fahrers, Mr. Po verdeutlichen, dem die Nats mehrfach im Traum erschienen waren und ihm nahelegte, kein Fleisch mehr zu essen. So lange er dieses Ansinnen nicht erfüllte, ging es ihm immer wieder körperlich schlecht, erst seit er vegetarisch lebt, geht es ihm gut.
Muadzam Shah
ist eine vollsynthetische Stadt in Malaysia, mitten in Ölpalmenplantagen, die sich bis zum Horizont erstrecken. Der relative Wohlstand, den Malaysia heute erreicht hat, veranlaßt die einzelnen Staaten, die sich vielfach noch immer als Emirate fühlen, immer wieder seltsame Installationen in die Landschaft zu stellen (Shah Alam).
Mucuy Alta
Ausflugsziel nahe Mérida, oberhalb der Ortschaft Mucuy, die an der Straße zum Paso Pico de Aguila liegt. Hier gibt es schöne Picknickplätze, einen Stützpunkt der Nationalparkverwaltung, eine experimentelle Forellenzucht. Und außerdem beginnt hier der Weg, der in der Folge (ca 12 Stunden) bis auf den Gipfel des Pico Bolívar führt.
Die ersten Kilometer des Weges, der durch den Wald des Nationalparks Sierra Nevada de Mérida führt, erlebte ich; der Wald war wunderschön, die bergsteigerischen Ambitionen des O-Kurt und des Hugo konnte ich nicht teilen, ich betrachete die Bäume und Orchideen, die amerikanischen Vogelfreunde, die kleinen dunklen Flecken im Geäst mit Feldstächern nachschauten - was muß ich den Berg bezwingen...
rufen in allen islamischen Gegenden fünfmal am Tag zum Gebet. Die Allah'hu akbar, Allah ... Rufe werden bald zum vertrauten Bestandteil des Alltages, die man angenehm registriert.
Seltsam ist nur, daß bei all der Normung - die Muselmanen haben sich die Probleme, die aus einer Übersetzung der Kur'an resultieren würden, klugerweise nicht angetan - die Melodien der Muezzin von Land zu Land verschieden erscheinen.
Besonders eindrucksvoll war dieses Morgenkonzert in Probolinggo. Von allen Seiten sangen sie ihr Allah'u Akbar, durch- und übereinander. Klang wie eines der a capella Stücke von György Ligeti, bei denen man nicht weiß, ob es elektronische Musik ist oder nicht. In meiner Schläfrigkeit und im Halbschlaf dachte ich mir, das wäre eine tolle Geräuschkulisse für eine Verfilmung von Dantes Inferno:
Blick über die zusammengewürfelten Dächer einer Stadt, in rotes Licht getaucht (eine Stadt aus glühendem Eisen) und diese wimmernden Stimmen, die Stimmen der verdammten Seelen ... Nur das Vogelgezwitscher und die vielen krähenden Hähne paßten nicht so recht zu diesem Szenario.
die Hauptstadt des Weißwurstlandes hat keines großen Eindrücke hinterlassen. Das ist sicher ungerecht, denn München hat sicher viel zu bieten.
Das erste Mal war ich wahrscheinlich in keiner sehr guten Stimmung, seelisch und emotional zerrissen, das zweite Mal durfte (mußte) ich an einer Messe teilnehmen.
Beides keine gute Ausgangsbasis
Musholla
heißen die Koranschulen, die in allen Orten des muselmanischen Indonesien zu finden sind. Hier wird nicht nur das heilige Buch der Muselmanen vorgetragen, sondern oft auch andere, weltliche Fächer. Nicht wenige dieser Schulen werden von den sunnitischen Ölstaaten mitfinanziert, um den Keim des Fundamentalismus gar nicht erst Fuß fassen zu lassen.
Mustafapasa
ist eine kleine Ortschaft, einige km von Ürgüp entfernt. Früher sieß das Dorf einmal Sinasos, aber in der Folge des sogenannten Bevölkerungsaustausches 1921/22 wurde der Ort umbenannt. Ein zweifelhafter Lichtblick in den jahrhundertelangen und bis heute andauernden Auseinandersetzungen zwischen Griechen und Türken war ein großer Menschentausch, in dem die beiden Staate die jeweiligen Sprach- und Kulturinseln, die seit undenklichen Zeiten bestanden hatten, bereinigten.
Der erste Blick läßt Mustafapasa wie einen Ort voller Ruinen aussehen - viele Dörfer in Kappadokien sehen so aus - doch bleibt man ein wenig dort, sieht das alles anders aus. Nicht zuletzt durch die Gastfreundschaft der Menschen. Läßt sich der Greißler beim Bäcker eine Pfanne voller Spezial-Ziegen-Güveç garkochen und läft uns ganz einfach ein, mitzuessen. Mit frischem Ekmek ein Hochgenuß (das sollte ich eigentlich unter Kulinarisches einreihen). Von den Runden Raki, die ich ablehnen mußte, ganz zu schweigen.
Das Mittagessen, das wir dort ahnungslos einnahmen, hatte eine ganze Reihe von Ereignissen in sich, aber das ist eine andere Geschichte.
Mit diesem Begriff verbinden sicherlich die meisten Leute Indinaner- oder Cowboygeschichten aus dem Wilden Westen Amerikas und die wilden Pferde, die es dort gibt (oder einmal gab).
Daß es auch ein winziges Königreich im Himalaya gibt, da sich so nennt, wissen die wenigsten - woher auch?
Im letzten Jahr des alten Jahrtausends wurde die Idee, nach Mustang zu reisen, konkret; genauer, aus dem verschwommenen Wissen, daß es Mustang auf der Weltkugel gibt, wurde ein Reisewunsch. Der allerdings bald abgeändert wurde, als die dazu notwendigen Umstände konkreter wurde.
So war es dann halt eine kleine Trekking-Tour im Norden Nepals, die uns bis an die Pforten des Mustang führte. Die Nepalis definieren das etwas komplizierter, denn irgendwo unterhalb von Marpha beginnt das "Untere Mustang", das dann nördlich von Kagbeni "Oberes Mustang" heißt. Das illustriert auch die Zugangsmöglichkeiten, denn bis Kagbeni darf man mit einer normalen Trekking-Lizenz des Annapurna-Sactuary wandern, darüber hinaus wird’s teuer und kompliziert.
Mustang ist eigentlich ein
Anachronismus, der irgendwie in einem schmalen Freiraum politischer Verwicklungen
zwischen Nepal und der VR China überlebt hat. Im 2. Weltkrieg errichteten
hier westliche Geheimdienste Außenposten, die irgendwelche Bewegungen
in Zentralasien beobachten sollten - das klingt alles nach "Shangri La"
und anderen fantastischen Geschichten. Heute ist das Königreich offenbar
zu unbedeutend, um in die politischen Machtspiele einbezogen zu werden, die
etwa zwischen Indien und China (siehe auch Ladakh) gespielt werden.
Hier soll es noch einige der alten Formen tibetischer Lebenskultur geben, die
sich in Trachten und Festen manifestieren. Das auch zu sehen, erfordert einigen
Aufwand, der in Dollars und körperlicher Anstrengung zu erbringen ist.
Man benötigt eine eher teure Bewilligung der nepalischen Regierung, eine
echte Expedition, die alles was Mensch und Tragtier benötigt, aus dem nepalischen
Tiefland heraufschleppt, denn die Bewohner Mustangs können sich gerade
selbst am Leben erhalten und nichts an Besucher verkaufen und einiges an Kondition,
denn die Gegend schaut auf den Fotos echt wild aus.
Schon Kagbeni, der nördlichste Punkt unserer Wanderung, ist eine karge Oase in einer total unwirtlichen Gegend - schaut man dann vom Dach des alten Tempel nach Norden, erstreckt sich das Schotterbett des Kali Gandaki in die Ferne, bis das Flußbett und die kahlen Felsufer im Dunst verschwimmen. Von dort sind es dann einige Tagesmärsche in die tibetische Hochebene hinein, bis man zum Hauptort des Königreiches kommt.
Man kann auch mit einem der kleinen Flieger, die Jomson ansteuern, hinein- oder herausfliegen, aber die Absturzrate soll so bei 25 % liegen und das ist auch nicht lustig.
Im Heimatmuseum in Jomson ist einiges an Fotos von Festen in Mustang und über die Königsfamilie zu sehen - ein Besuch muß schon toll sein, obwohl mir heutzutage mehr und mehr bewußt wird, daß die alten Rituale und Feste nur noch durch Tourismus-Sponsoring am Leben erhalten werden können und dadurch ihre Wurzeln in unserer globalisierenden Welt verlieren müssen.
der Muttertempel Besakih liegt auf etwa 950 m Seehöhe am Südabhang des Gunung Agung. Gerade in der richtigen Höhe, damit sich die Wolken, die aus der Südsee kommen, in den Wäldern festsetzen können. Rings um den Parkplatz, der am Ende der steilen Stichstraße liegt, entlang der weiterführenden Straße zum Tempeleingang natürlich Reihen von Andenken- und Fetzenläden, die die Pflichtbesuche der Touristen zum wichtigsten Tempel Balis ausnützen wollen. Mit einer im ganzen Land nie gesehen Dichte an Klosetts wollen sie offenbar die Touristen dazu bewegen, ins Geschäft zu kommen. Der Nebel, der sicherlich viele Tage des Jahres über den Berghängen liegt, läßt die Vorgärten der Häuser entlang der Straße üppig wachsen. Orchideen, anfangs mit einer halben Kokosschale an eine Mauer genagelt, klammern sich mit meterlangen Wurzeln ans bemooste Mauerwerk und recken ihre Blütenstämme in die Höhe.
Das Tempelareal ist gottseidank nicht zugänglich, die neugierigen Besucher dürfen nur durch die Tore und über die Mauern lugen. Da angeblich jedes größere Dorf Balis hier einen Schrein unterhält, ist der ganze heilige Bereich mit kleinen und großen Tempelchen gepflastert. Die vielstöckigen Dächer mit ihrer schwarzen Kokosfaserdeckung recken sich wie Scherenschnitte vor den dünnen Konturen der im Nebel verschwindenden Bergkanten.
Auf der zweiten Reise in dieses Land legten wir 1995 an die 2.000 km mit einem uralten Toyota-Minibus ohne Stoßdämpfer zurück und reisten von Yangon über Meiktila, den Inle Lake, Taunggyi, Kalaw, Mandalay, Maymyo, Bagan, Mt. Popa, Magui, Prome wieder nach Yangon, von dort mit einem Flieger nach Sandoway und Ngapali Beach und dann von Yangon wieder nach Hause.
Wörtlich bedeutet der Name Schnell und Stark, eine Bezeichnung die ich nach den drei Wochen nicht ganz unterschreiben kann. Schnell geht in diesem Land gar nichts; stark sind die Menschen vor allem in seelischer Hinsicht, weil sie seit mehr als 100 Jahren die unterschiedlichsten und meist nicht wohlwollenden Regime ausgehalten haben, ohne ihre Gutmütigkeit und Freundlichkeit zu verlieren.
In einem Hotel fiel mir die englischsprachliche Zeitung The New Light of Myanmar in die Hände (Ausgabe vom 14.November 1995 = 6th Waning of Thadingyut, 1357 ME, was immer das für ein Datum nach dem Mondkalender ist), die bewies, wie international sich das neue Myanmar geben will.
Neben vielen Artikeln und Bildern, die Uniformierte zeigten, war auf der zweiten Seite immerhin eine Notiz über die gescheiterten Koalitionsverhandlungen im fernen Austria, immerhin nicht mit Australia verwechselt, daß Austrian Chancellor will not oppose Snap Poll - also Neuwahlen am 17. Dezember 1995.
Wenn man sich einen Atlas zur Hand nimmt und die hinterindischen Länder nachschlägt, sehen die meisten der Länder gar nicht so riesig aus, wie sie dann in Wirklichkeit sind. Der indische Subkontinent dominiert alle unseren Kartenwerke, die mehr auf Europa oder Amerika zentriert sind. Allein die Nord-Süd-Ausdehnung Myanmars, das an seiner Nordgrenze einen mehr als 5.000 m hohen Bergriesen in den Himalaya-Ausläufern sein eigen nennen darf und bis zum Isthmus von Kra hinunterreicht ist gewaltig.
Legt man dann noch den Zustand der Straßen und der Verkersmittel als Maßstab an, kann die Durchquereung einer Strecke, die man in Mitteleuropa in einem langen Tag bewältigen kann, locker eine Woche dauern.

Ein aufgedrängter und durch nichts abzuschüttelnder Knabe lockt uns in ein Hotel, "very nice", dessen Zimmer noch die Reste der gestrigen Abendmahlzeit samt Asche zieren. Unter den gleichgültigen Blicken der Hotelleute und den unwirschen des Knaben erkunden wir das nächste Hotel, wo wir dann auch bleiben. In der Hotelhalle thront der Chef in einer imposanten Sitzkasse, alles und jeden im Auge behaltend. Der Knabe nervt uns noch minutenlang mit seinen Wünschen nach Bakschisch, offenbar dafür, daß er uns hierher begleitete.
Abends schlendern wir durch den Basar von Mysore, schaulustig und auf der Suche nach einem Gasthaus, das einladend aussieht. Ein großer Teil des Basars ist fest aus Stein gebaut, Stände wie die Halle selbst. Natürlich jede gibt es hier Menge Früchte und Gemüse, viele Sorten Bananen - dunkelgrüne, gelbe und rötliche, meterlange Gurken, Berge von Girlanden aus leuchtendgelben Blüten und viele andere Dinge, deren Zweck wir nur erraten können. Am meisten fallen uns einige Stände ins Auge , die nur Farben in schreienden Tönen verkaufen. Wofür sie verwendet werden, bleibt uns ein Rätsel.
Beim Abendessen beschließen wir nach langer Diskussion, den Abstecher nach Norden, nach Belur/Halebid und Sravanabelagola, doch zu streichen. Es tut uns leid, die berühmten heiligen Stätten der Jains auszulassen, doch der bisherige Streß beim Reisen schreckt uns ein wenig. Später wird sich herausstellen, daß unsere Probleme nur kleine Anfängerschwierigkeiten waren.
Mit einem Taxi fahren wir auf den Chamundi-Hill zum Nandi-Tempel. Bald lassen wir die Stadt hinter uns. Durch die zum Teil engen und gewundenen Gassen macht Mysore einen durchaus großstädtischen Eindruck. Auf der Straße, die sich den Hügel hinaufwindet, sieht das ein wenig anders aus. Schon nach wenigen Minuten sind wir im Grünen und sehen auf eine putzige und verwinkelte Stadt mit einem Maharadjapalast hinunter. Der Felsenstier Nandi steht hier in der freien Natur, an einem Berghang, mit leuchtendgelben Blumen bekränzt. Ringsherum eine Herde Affen in Warteposition, um alle Gläubigen und Touristen anzubetteln. Vor allem um die Köstlichkeiten, das von einer älteren Frau in einem Korb angeboten werden; Erdnüsse, Gurken und Obst, das vor allem in den Mäulern der Affen landet. Der diensthabende Brahmane in der üblichen Adjustierung - weißer Dhoti, die heilige Schnur als Zeichen seines Standes um den Oberkörper geschlungen, ausrasierte Stirn und goldene Ohrringe mit Steinen - ordnet die Blumenketten und Räucherstäbchen auf der Plattform des Stiers.
Der Winterpalast des Rajah, den wir im Verlauf des Vormittags besuchen, ist eine merkwürdige Mischung aus traditioneller indischer Architektur und britischen Einflüssen aus dem 20. Jahrhundert. Die Ehrenwachen vor den Toren in einer fast britischen Army-Uniform, der Rest des Personals in einer Fantasieuniform aus 1000 und 1 Nacht. Die halbe Stunde, die wir mit allen anderen Besuchern warten müssen, bis die Tore für den Nachmittag geöffnet werden, vertreiben wir uns mit Menschenbetrachtungen und Auseinandersetzungen mit den allgegenwärtigen Händlern. Unter den Wartenden ist auch ein gelangweilt aussehender Mensch mit Einkaufskorb und einem interessanten Turban, der sich bei näherem Hinsehen als bizarre Frisur entpuppt - in Rasta-Manier zu Rollen verfilzt und wie ein Turban aufgewickelt. Außerdem sind hier Lepra-Kranke bettelnd unterwegs, einige ohne Finger und Zehen. Die elsternartig weiß-braun gefleckten Menschen, die man hier immer wieder sieht, müssen Lepra-Infizierte in einem frühen Stadium sein, bei denen die Krankheit zum Stehen gebracht werden konnte. Die Händler sind hier vor allem mit Sandelholzgegenständen - für die Mysore ja berühmt ist - unterwegs. Außerdem bieten sie ungegerbte, eingesalzene Pythonhäute in Mengen und zu tollen Preisen an. Einer will sogar eine ca 20 cm lange Babypython verkaufen, die sich um seine Finger windet.
Der Palast selbst ist eine wunderliche Mischung aus pompösen Repräsentationsräumen mit herrlichen Kunstwerken und in Jahrzehnten angehäuftem europäischem Edelkitsch. Fotografieren ist streng verboten, vielleicht, damit die elenden Postkarten, auf denen man den Palast gerade noch erkennen kann, an den Touristen gebracht werden können.
siehe auch Somnathpore
wer mehr sehen & lesen will, muß sich die CD beschaffen